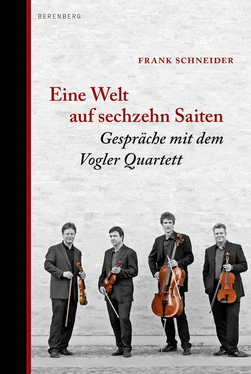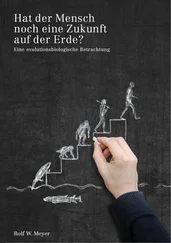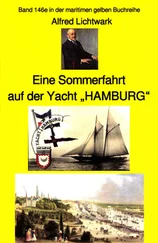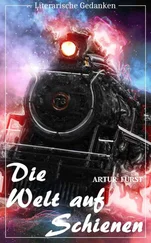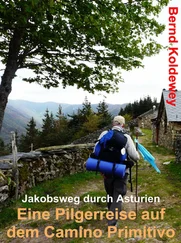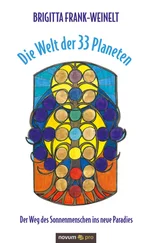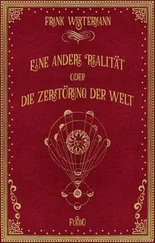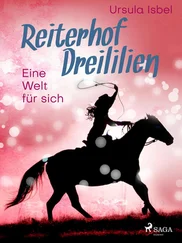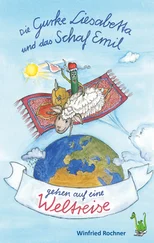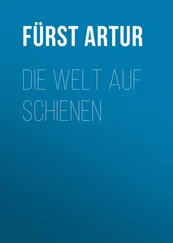Wohin ging die erste Fahrt?
FR: Nach Roussillon in Südfrankreich. Den Wagen haben wir in Hofheim am Taunus, wo er stand, erst ausgiebig bestaunt und dann zur Jungfernfahrt bestiegen. Ich hatte mit meinem Trabant die meiste Fahrerfahrung und durfte deshalb einen ersten Streckenabschnitt bewältigen. Danach wurde in genau gleichen Zeitabständen gewechselt, und gemeinsam drehten sich bei jedem Spurenwechsel die Köpfe in die gleiche Richtung nach hinten. Wir wollten nicht schneller als 130 km/h fahren, aber es wurden in diesem neuartigen Freiheitsrausch auch schon mal 200 km/h. Es war, die Musik nicht gerechnet, eine bis heute unvergessene Geschichte, die viel über DDR-Mentalität, auch unsere damals noch jugendliche, erzählt.

Roussillon 1987

Westberlin Mai 1986, mit vom Preisgeld in Evian erstandenen Hifi-Anlagen
Zu den Gaben des Staates an begabte Nachwuchskünstler gehörten besondere Stipendien mit der Absicht, herausragende Leistungen zu prämieren und zu stimulieren. Man sollte aber dazu wissen, dass jeder Student in der DDR ein Grundstipendium bekam – es belief sich auf 210 Ostmark pro Monat und garantierte angesichts spottbilliger Mieten und niedriger Lebensmittelpreise ein im Grunde sorgenfreies Auskommen. Wie verhielt es sich mit dem Leistungsstipendium, das Sie zusätzlich zum normalen erhielten?
TV: Es wurde uns als Auszeichnung für den gewonnenen Wettbewerb in Evian zugesprochen, so wie jedem Preisträger eines internationalen Wettbewerbs. Dieses »Mendelssohn-Stipendium« belief sich auf über 400 Mark im Monat und ergab zusammen mit dem Grundstipendium fast das durchschnittliche Nettoeinkommen eines normalen Arbeiters oder Angestellten. Es war mehr als genug, wenn man noch die Preisgelder selbst und die laufenden Konzertgagen in Ost und West hinzurechnete. Als wir uns nach der Verleihungs-Zeremonie zur ersten Quartett-Probe wiedersahen, meinte einer von uns, wir sollten doch alle einmal unsere Konten beschauen. Zu unserer großen Verblüffung war der monatliche Betrag doppelt überwiesen worden, einmal vom Ministerium für Kultur, ein zweites Mal von unserer Musikhochschule, offenbar ohne voneinander zu wissen. Wir warteten noch den nächsten Monat ab – wieder doppelte Zahlung –, und wahrscheinlich wäre das endlos so weitergegangen, wenn nicht protestantisch-preußisches Pflichtbewusstsein und eine anerzogene Ehrlichkeit uns dazu angehalten hätten, davon Meldung zu machen. Im Gegensatz zu einigen anderen uns damals bekannten Fällen, wo man die Sache weiterlaufen ließ. Ohne Dank oder anderen Kommentar blieb es bei uns dann bei nur einer Zahlung.
FR: Hm … wir dachten aber, dass die Stasi unsere Ehrlichkeit testen wollte, haben ausführlich darüber beraten und kamen zu dem Schluss, dass man dies als Einzelstipendiat vielleicht noch »übersehen« haben könnte, wenn es auffliegt, nicht aber zu viert. Also haben wir es gemeldet, denn das konnte ja nur ein Test sein. Wir fanden später heraus, dass es schon jahrelang bei allen Stipendiaten so gelaufen war.
In gewisser Weise waren die Vorzüge Ihres Lebens in der DDR-Hauptstadt eine kleine Kompensation für die enormen Anstrengungen, die Sie auf sich nahmen, um als Berufsquartett zu bestehen. Ich denke dabei gar nicht in erster Linie an die Strapazen des Reisens oder die unerhörte Konzentration, die ein Konzertabend abverlangt. Sie waren von Evian de facto mit vier geprobten Stücken zurückgekommen und brauchten doch erst noch ein Repertoire, mit dem Sie professionell konzertieren konnten. Also müssen Sie in den ersten Jahren eigentlich ununterbrochen neue Werke einstudiert haben. Wo ist das geschehen?
SFO: Geprobt haben wir in der Regel bei meinem Vater in Berlin-Weißensee, der als Bischof eine Dienstwohnung hatte. Sie lag in einem enggeschossigen, langgestreckten Gebäude, das eher einer Baracke ähnelte. Innen sah es aus wie ein DDR-Neubau, mit relativ niedrigen Decken, aber auch einer ganzen Menge mehr oder weniger großer Räume. Eines der Wohnzimmer bot ausreichend Platz für uns – darin konnten wir bis spätabends üben, so oft und so lange wir wollten. Direkt daneben lag das Arbeitszimmer meines Vaters, der nach dem Tod meiner Mutter 1987 diese menschlich-akustische Belebung wohl nicht ungern sah und sie sogar einmal kurioserweise quasi dienstlich zu nutzen wusste. Als er einen Routinebesuch vom Ständigen Vertreter der Bundesrepublik bekam – es war damals Hans Otto Bräutigam –, bat er uns, irgendetwas Kräftiges und Lautes zu spielen, damit eventuell mitlauschende Sicherheitsbehörden größere Schwierigkeiten hätten, die Gespräche der beiden zu verstehen.
Ist das eine Vermutung oder wart Ihr tatsächlich verwanzt?
SFO: Wir wohnten Parkstraße 21 in direkter Nachbarschaft zur Parkstraße 22, in der die SED-Kreisleitung beheimatet war. Man hätte mit einem Richtmikrofon direkt auf unsere Fenster zielen können. Aber ich bin dem niemals nachgegangen.
FR: Aber ja, ihr wart verwanzt, ich erinnere mich. Da keiner von uns ein Telefon zu Hause hatte, bat ich einmal für einen dringenden Anruf um Benutzung des Diensttelefons im Büro deines Vaters. Als ich meine Nummer gewählt hatte, knackte es kurz in der Leitung und eine Stimme sagte – sie klang wie von nebenan: »Legen Sie bitte auf und wählen Sie noch einmal neu.« Da hatte sich einer verstöpselt, und erst beim zweiten Versuch klappte die Verbindung. Ein klarer Fall.
SFO: Im Grunde hat sich an der Proben-Lokalität bis heute wenig geändert, denn ich wohne wieder in der Parkstraße, allerdings in einem anderen Haus. Dort haben wir einen Probenkeller, der sehr geräumig und perfekt ausgestattet ist. Den nutzen wir, sooft es nötig ist. Wenn es zwischenzeitlich nicht möglich war, zu Hause zu üben, konnten wir manchmal, aber nicht sehr oft, in die Musikhochschule gehen; zumeist aber haben wir dann in der Stephanus-Stiftung in Weißensee proben können und die Miete in Form eines jährlichen Konzerts entrichtet. Diese kirchliche Stiftung, ein Pflegeheim für Senioren, ist nach der Wende stark umgebaut worden; Baulärm und Presslufthämmer haben uns nicht abhalten können, sie mit Klängen neuer Musik zu kontern, aber es war für uns damals eine ganze Zeit lang eine extrem stressige Situation.
Sie mussten sich, um konzertieren zu können, die Quartett-Literatur gleichsam von null auf hundert aneignen. Was und wie haben Sie geprobt?
TV: In der Tat hat uns Evian mit vier Stücken entlassen, es kamen noch ein Mozart und ein Beethoven dazu, die wir auch geprobt und als eine Art Reserve im Gepäck hatten. Ein viel zu kleiner Grundstock für eine Konzert-Karriere! Uns ist dann aber das ein Jahr währende, schikanöse Reiseverbot während des Studiums in gewisser Weise zum Vorteil ausgeschlagen, denn in dieser Zeit konnten wir uns nun erst einmal eine Reihe neuer Werke erarbeiten. Dennoch standen wir vor der veränderten Situation, dass der Mentor, Professor Feltz, der die Stücke für Evian intensiv mit uns erarbeitet hatte, danach nicht mehr in gleicher Weise zur Verfügung stand und wir gewissermaßen allein auf uns gestellt waren. Wir empfanden das, namentlich im Hinblick auf die großen, vielgespielten, aber schwer zu realisierenden Brocken wie etwa Schuberts »Der Tod und das Mädchen«, als eine ziemlich riskante Situation für uns Neulinge. Natürlich haben wir zur Kontrolle die Stücke hin und wieder Herrn Feltz oder auch meinem Vater einmal vorgespielt, um sicher zu sein, dass wir in der Stilistik der Interpretationen nicht ganz danebengegriffen hatten. Aber die eigentliche formale, inhaltliche, dramaturgische Durchdringung der Werke, auch die technischen Festlegungen vom Tempo über Dynamik und Agogik bis zum Bogenstrich, das alles musste nun überwiegend im internen Dialog unter uns vieren überlegt und festgelegt werden. Damals war es so, dass wir gegenüber den Veranstaltern meist selbst bestimmen konnten, wie unser Konzertabend aussehen soll, das heißt, es konnten die Stücke sein, bei denen wir uns besonders wohl fühlten, weil sie hinlänglich geprobt waren. Darunter befand sich stets ein Werk der neuen Musik, für die wir uns durch den Sieg in Evian mit dem Stück von Ligeti besonders prädestiniert fühlten – eines unserer Markenzeichen eigentlich bis heute.
Читать дальше