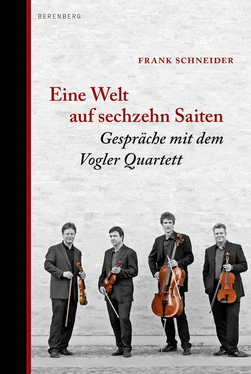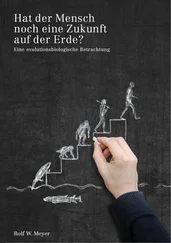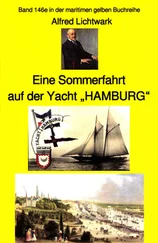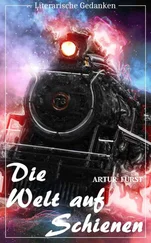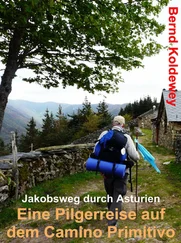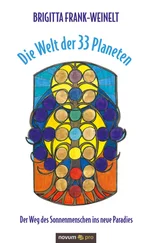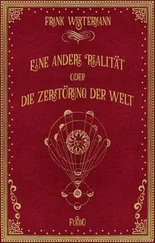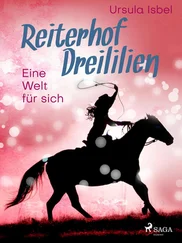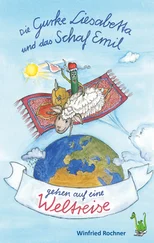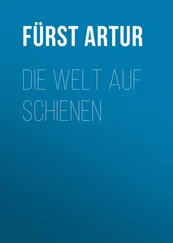Frank Schneider - Eine Welt auf sechzehn Saiten
Здесь есть возможность читать онлайн «Frank Schneider - Eine Welt auf sechzehn Saiten» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Eine Welt auf sechzehn Saiten
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Eine Welt auf sechzehn Saiten: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Eine Welt auf sechzehn Saiten»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Eine Welt auf sechzehn Saiten — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Eine Welt auf sechzehn Saiten», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
TV: Es war in der DDR außerhalb der sogenannten Intershops für Waren aus dem westlichen Ausland eigentlich nicht erlaubt, bares Westgeld als Zahlungsmittel zu verwenden. Man durfte das offiziell verdiente Westgeld nur auf einem Konto der Staatsbank der DDR haben und in Form von sogenannten Forumschecks wieder abheben. Forumschecks – das war eine Ersatzwährung, die eins zu eins zur D-Mark stand und mit der man im Intershop einkaufen konnte. Alles andere war im Prinzip illegal, aber es hat nie jemand auch wirklich kontrolliert, ob man Bares besaß und damit einkaufte, weil man es eben auch nahm. Der Staat war scharf auf jede Mark, in welcher Form auch immer! Und es war ein Widerspruch bis zum Nonsens, dass die Künstleragentur nie danach fragte, wie wir das handhabten. Natürlich brachten wir Bares über die Grenze mit nach Hause und hätten, entsprechende Summen vorausgesetzt, sogar Immobilien oder Autos en masse erwerben können – von Handwerker-Leistungen ganz zu schweigen, die man am Ende oft nur noch über bares Westgeld bekam.
Ich nehme an, dass Ihnen das Ausmaß Ihrer Privilegierung durchaus bewusst war. Das mag in vielerlei Hinsicht angenehm gewesen sein, gab es aber nicht auch Probleme, sie Ihrer Mitwelt plausibel zu machen?
SFO: Ja, das war durchaus der Fall. Wenn wir zu Hause oder im Kreis von Freunden von unseren Westreisen berichteten, gab es als Reaktion oft nur lange Gesichter. Auch meine Freundin war irgendwann erschöpft von der Begeisterung über das, was nicht sie, sondern der Partner erleben durfte. Also lernte man, seinen Überschwang zu dämpfen und zu kontrollieren, was man wie erzählt oder vielleicht gar nicht.
FR: Bei mir war das ähnlich. Natürlich freuten sich meine Familie, meine Eltern und mein Bruder ganz prinzipiell darüber, dass einer aus der Familie es geschafft hatte, die Verhältnisse sozusagen zu überlisten und mit zwei einander feindlich gesinnten Systemen zu leben. Doch wenn man in Erzählungen zu ausführlich, zu detailliert die andere Seite ins Paradiesische steigerte, verrieten die Augen eine Art Unbehagen und Missmut, die zur Rücksicht auf die Zurückgebliebenen ermahnte. Wir hatten im Dienstpass ein Dauervisum, mit dem man praktisch jeden Tag nach Westberlin fahren konnte. Ich bin aus Neugier eine Zeitlang – ohne Geige – fast jeden Abend zu einem Freund gefahren. Wir sind ins Kino, in die Philharmonie, den Tiergarten oder eine Kneipe gegangen. Solche Erlebnisse auf der falschen Seite der Mauer konnte man daheim wirklich niemandem erzählen!
TV: Wir standen permanent mit einem Bein im Osten und mit dem anderen im Westen und lebten mit zwei Währungen, die offiziell nicht kompatibel, aber in Phantasiegrößen illegal zu wechseln waren – was das Leben zu Hause noch einmal um vieles preiswerter für uns machte. Solche Privilegien (mit ungewollten Nebeneffekten) gewährte die DDR einer gewissen exklusiven Schicht von Künstlern und Wissenschaftlern, weil sie einerseits hoffte, dadurch deren Laune zu heben und den stets zu befürchtenden Weggang nach dem Westen zu minimieren. Andererseits wollte sie als ein weltoffener Kulturstaat gelten, der natürlich, wenn auch nur auf dem Papier, die Freiheit der Kunst anerkannte und die Freizügigkeit im Umgang mit den Künstlern, wenn auch strikt auf Spitzenkräfte beschränkt, damit unter Beweis stellte. Diese Art eines der Umwelt gegenüber etwas entfremdeten Lebens schweißte jedoch das ohnehin durch die Arbeit und das Reisen geförderte Gefühl von uns vieren als einer verschworenen Gemeinschaft noch enger zusammen; rückhaltlos über alles sprechen konnten wir ohnehin nur in unserem eigenen Kreis.
Gab es seitens der Agentur bei der Auswahl ihrer Engagements politisch begründete Bevorzugungen oder Vermeidungen einzelner Weltreligionen und gab es namentlich irgendeinen Proporz im Verhältnis von in- und ausländischer Präsenz?
SFO: Nicht dass ich wüsste. Wir haben überall in Europa und ab 1989 sogar in Amerika dort spielen können, wohin man uns eingeladen hatte. Für andere Sparten gab es möglicherweise Auftrittsbeschränkungen für die Bundesrepublik und noch stärker für Westberlin, aber für uns nicht. Wir haben auch in Westberlin gespielt, sogar Konzerte, die vom Sender Freies Berlin live übertragen worden sind, und wir haben in diesem Sender auch Aufnahmen produzieren können. Dort hat uns mal eine Journalistin anlässlich eines Interviews gefragt, ob wir ein freies Quartett seien. Sie meinte das im Hinblick auf den rechtlichen Status freischaffender Künstler, aber Frank hatte sofort mit süffisantem Bezug auf die politische Dimension die Gegenfrage parat: »Wie meinen Sie das – frei?«
TV: Innerhalb der DDR haben wir natürlich auch gespielt. Da gab es die Konzert- und Gastspieldirektion, das Inlands-Pendant zur staatlichen Künstleragentur. Sie vermittelte Auftritte in großen und kleinen Städten, oft hießen die Formate »Stunde der Musik«. Wir traten dort auf mit schönen, aber manchmal auch kuriosen Erlebnissen. Einmal sind wir nach Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern gefahren, wo ein kleiner Saal mit nur 15 Plätzen so ärmlich gefüllt war, dass genau so viele Stühle besetzt waren, wie Musiker auf dem Podium saßen. Vier vereinzelt sitzende Leute gegen eine musizierende Viererbande, das hätte eine theatralische Performance à la John Cage werden können, mit gegenseitigen kommunikativen Verlautbarungen oder Verstörungen, wenn nur dieses Rumpf-Publikum nicht so total verschüchtert dagesessen hätte und wir nicht so frustriert gewesen wären.
Wie haben Sie eigentlich die oft erheblichen Strecken bewältigt, die zwischen Berlin, Ihrem Wohnort, und den Orten Ihrer Konzerte liegen? Flugzeug? Eisenbahn? Autos?
TV: Alles, aber vor allem: Wir hatten ein gemeinsames Auto! Die DDR baute zwar selbst Autos, aber man musste auf sie, je nach Typus, zehn, zwölf oder mehr Jahre warten. Bei uns sah es nach dem Studium so aus: Wir hatten alle die Fahrprüfung gemacht, aber wir besaßen, mit Ausnahme von Frank, keinen fahrbaren Untersatz. Die Lösung bestand wiederum in einem Privileg: einige Auserwählte in der Kunst und in anderen Bereichen konnten, wenn sie zahlungsfähig waren, einen Westwagen bekommen. Wir erfuhren, dass der Dresdner Startrompeter Ludwig Güttler so etwas vermitteln könne (siehe S. 350 f.). Wir nahmen Kontakt mit ihm auf, und es stellte sich heraus, dass er tatsächlich etwas Passendes in Frankfurt / Main zu stehen hatte, einen Opel Senator mit Drei-Liter-Maschine, wunderbarer Reisewagen mit Vollausstattung. Der Deal musste zunächst beim Ministerium beantragt werden, und da unsere Gründe offensichtlich stichhaltig klangen, wurde nach monatelangem Warten, wieder ausnahmsweise, die Einfuhr eines Autos aus dem sogenannten nichtsozialistischen Währungsgebiet genehmigt. Zwei Bedingungen gab es: erstens Hinterlegung des Kaufpreises auf einem Konto der Staatsbank der DDR (was die Einzahlung der Summe in D-Mark bedeutete) und zweitens Vorlage des Fahrzeugbriefes im Original.
Was ja vollkommen verquer ist, denn Westgeld gab es doch als offizielles Zahlungsmittel eigentlich gar nicht.
TV: Eben, aber das war der Knackpunkt – vielleicht von uns ein Missverständnis damals –, dass wir im Prinzip ein Konto brauchten, um den Kaufpreis zu hinterlegen, und zusätzlich die gleiche Summe ein zweites Mal in bar, um das Auto zu kaufen und den Fahrzeugbrief zu bekommen. Den Kauf für 16.000 DM besorgte uns Ludwig Güttler mit einem Vorschuss, die gleiche Summe zahlten wir aus unserem eigenen Kapital in der Staatsbank der DDR ein, zuzüglich eines Zolls für den Gebrauchtwagen in Höhe von 18.000 Mark der DDR. Ich eröffnete also ein Valuta-Konto und zählte das Westgeld in baren Tausendern von unseren mitgebrachten Gagen auf den Banktresen – umringt von neugierigen Leuten, die in der Schlange standen, um polnische Zloty oder ungarische Forint einzutauschen und sich wohl argwöhnisch wunderten, wie reich manche Leute mit fremder Währung werden konnten. Jedoch kam der wirklich schwierige Punkt erst, als ich später das Geld wieder einlösen wollte, um unsere Schuld bei Güttler abzutragen. Das aber war überraschenderweise trotz der Genehmigung zur Wageneinfuhr nur entweder eins zu eins in DDR-Mark oder in Forumschecks für die Intershops möglich. Großer Schreck und erneute Eingabe, ganz nach oben, erneutes langes Warten, endlich auch diesmal ausnahmsweise Genehmigung! Wieder in der Bank ein quasi öffentlicher Vorgang vor Publikum, und ich vergesse weder die kalte Wut des Beamten, mit der er mir den Packen Westgeld auf den Tresen knallte, noch die an Lynchjustiz grenzende aufgereizte Stimmung der zuschauenden Menge, die nach solchen Summen baren Sehnsuchtsgeldes nur mit Erbitterung lechzen konnte. Auch Güttler war not amused, so lange auf sein Geld warten zu müssen, und beschied uns mit dem Wink: »Ihr Idioten, warum habt ihr das Geld überhaupt eingezahlt!«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Eine Welt auf sechzehn Saiten»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Eine Welt auf sechzehn Saiten» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Eine Welt auf sechzehn Saiten» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.