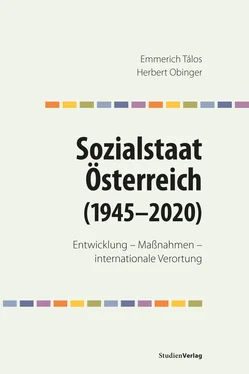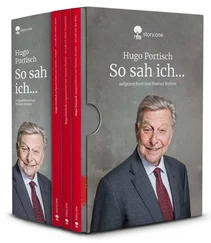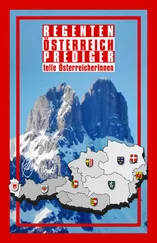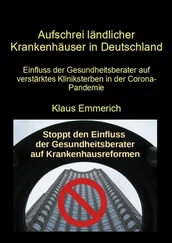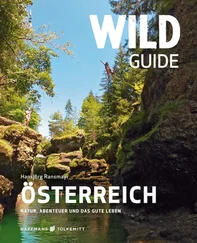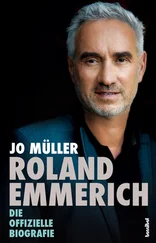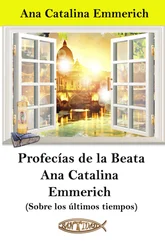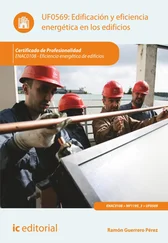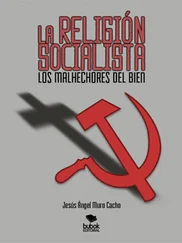Verwaltung durch Selbstverwaltung
Die Durchführung der Sozialversicherung oblag den zuständigen Versicherungsträgern. Deren Zahl betrug Ende der 1990er Jahre insgesamt 28, davon 19 Krankenkassen und 9 Versicherungsanstalten ( Tabelle 1.2.). Den weitreichendsten Schritt zur Reduktion der traditionellen Palette von Sozialversicherungsinstitutionen brachte die Schwarz/Türkis-Blaue-Regierung im Jahr 2018.
Tabelle 1.2. Die österreichische Sozialversicherung
| Die österreichische Sozialversicherung Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger |
| Unfallversicherung |
Krankenversicherung |
Pensionsversicherung |
|
9 Gebietskrankenkassen |
Pensions-Versicherungsanstalt der Arbeiter |
| Allgemeine Unfallversicherungsanstalt |
10 Betriebskrankenkassen |
Pensions-Versicherungsanstalt der Angestellten |
|
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues |
|
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft |
| Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen |
| Sozialversicherungsanstalt der Bauern |
| Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter |
|
|
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates |
Quelle: Soziale Sicherheit 7/8 (1999), 597.
Als Dachverband fungierte der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, dem die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Sozialversicherung und die Vertretung dieser Träger in gemeinsamen Angelegenheiten zukam. Seit den Anfängen der Sozialversicherung im ausgehenden 19. Jahrhundert gilt in organisatorischer Hinsicht das Prinzip der Selbstverwaltung. Die Vertreter der Versicherten wurden im Unterschied zu Deutschland in Österreich nicht gewählt, sondern im Zeitraum von 1947 bis 1999 von den gesetzlichen Interessenvertretungen, den Kammern, entsandt – wobei traditionell in den meisten Organen die Zahl der Arbeitnehmervertreter/innen überwog. Am Beispiel des Hauptverbandes aufgezeigt: bis 1999 war die Vorstandskonferenz aus siebzehn Vertretern der Dienstnehmer und zehn der Dienstgeber, der Verbandsvorstand aus sechs bzw. vier, das Präsidium aus zwei bzw. einem Vertreter zusammengesetzt. Nur in der Kontrollversammlung gab es mit sieben Vertretern eine Mehrheit der Dienstgeber (gegenüber vier der Dienstnehmer).
Die Verwaltung wurde näherhin von folgenden Organen wahrgenommen: der Hauptversammlung (beim Hauptverband: Verbandskonferenz), dem Vorstand als geschäftsführendem Organ, der Kontrollversammlung sowie von Ausschüssen. Durch eine Reform der Organisationsstruktur mit der 52. ASVG-Novelle (in Kraft 1994) sollte dem Ziel einer verstärkten Versichertennähe Rechnung getragen werden – und zwar mit einer verbesserten Abgrenzung von Geschäftsführung und Kontrollorgan, mit einer deutlichen Verringerung der Zahl der Versicherungsvertreter in den Entscheidungsgremien (von 2701 auf 1017) und mit der Einbindung von Vertretern der Pensionisten und Menschen mit Behinderung (auf dem Weg von Beiräten). Der Hauptverband bestand nunmehr aus vier Organen: der Verbandskonferenz, dem Verbandsvorstand, dem Verbandspräsidium und der Kontrollversammlung. Auf Grund der dem Präsidium bzw. dem Präsidenten übertragenen Aufgaben wurde das Verbandspräsidium organisatorisch verselbständigt. Als Organe der einzelnen Sozialversicherungsträger fungierten die Generalversammlung, der Vorstand, die Kontrollversammlung und Ausschüsse. Einschneidende Veränderungen erfuhr diese Organisationsstruktur der Sozialversicherung unter beiden ÖVP-FPÖ-Regierungen.
Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt aus verschiedenen Quellen: Die Aufwendungen der Sozialhilfe werden aus den steuerlichen Einnahmen der Länder und Gemeinden, die der aktiven Arbeitsmarktpolitik in erster Linie aus den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen gedeckt. Die Finanzierung der familienpolitischen Leistungen erfolgt zum Großteil durch so genannte Dienstgeberbeiträge (als Prozentsatz der Lohnsumme), die Leistungen der Pensions- und Krankenversicherung in erster Linie durch Versichertenbeiträge, so genannte Arbeitnehmer- und Dienstgeberbeiträge. Seit der Einführung der Sozialversicherung im späten 19. Jahrhundert bildet die Lohnsumme die Basis für die Dienstgeberbeiträge. Es handelt sich dabei also um einen Lohnkostenbestandteil und nicht um eine zusätzliche Leistung der Unternehmen für die Beschäftigten. Der Bund trägt erst seit der Zweiten Republik maßgeblich zur Finanzierung der Pensionsversicherung bei. Es besteht diesbezüglich eine gesetzliche Verpflichtung.
Die Form der Finanzierung ist die des Umlageverfahrens: die laufenden Ausgaben einer Periode werden durch die laufenden Einnahmen aus derselben Periode gedeckt. Diese Einnahmen werden in erster Linie aus Beiträgen der Versicherten aufgebracht, die damit wieder Ansprüche auf eine zukünftige Altersversorgung erwerben. Die derart institutionalisierten Generationenverhältnisse werden meist mit dem Begriff „Generationenvertrag“ bezeichnet:
„Dieser fiktive Vertrag besteht darin, dass sich die erwerbstätige Generation zur Zahlung der Leistungen an die in Pension befindliche Generation verpflichtet unter der Annahme, dass sie selbst, wenn sie das Pensionsalter erreicht hat, von der dann erwerbstätigen Generation die Leistungen in gleicher Weise finanziert erhält …
Alle eingehenden Beiträge werden im Wesentlichen sofort wieder ausgegeben. Wie man sieht, kann dieses System nur funktionieren, wenn die erwerbstätige Generation in der Lage ist, die Pensionen für die Leistungsempfänger zu finanzieren. Offensichtlich ist diese Art der Finanzierung stark von der Altersstruktur der Bevölkerung abhängig …
Ändert sich die Altersstruktur in Richtung einer Überalterung der Bevölkerung, dann geht dies bei einer Finanzierung der Pensionsversicherung nach dem Umlageverfahren zu Lasten der Erwerbstätigen“ (Wolff 1989, 120).
Dieser „Generationenvertrag“ stellt einen Umverteilungszusammenhang zwischen dem überwiegenden Teil der erwerbstätigen und ehemals erwerbstätigen Personen dar. Gegenstand dieses Generationenverhältnisses (siehe Kaufmann 1997, 19 ff.) ist ein intergenerationaler Ausgleich. Ein intragenerationaler Ausgleich wird damit nicht bewirkt.
Der „Generationenvertrag“ fußt traditionell auf einem hohen Maß an Beschäftigung sowie auf der Akzeptanz der Bereitstellung der notwendigen finanziellen Ressourcen für die Sozialleistungen durch Beiträge der versicherten Erwerbstätigen und ihrer Arbeitgeber, zum kleineren Teil auch durch Zuschüsse aus dem staatlichen Budget. Die Sicherung des Generationenzusammenhalts ist damit an Bedingungen geknüpft, die in den Nachkriegsjahrzehnten weitgehend gegeben waren.
1.4.2. Armenfürsorge – Sozialhilfe
Ebenso wie die Sozialversicherung und das Arbeitsrecht bewegte sich die Armenfürsorge nach 1945 in jenen Bahnen, die im ausgehenden 19. Jahrhundert grundgelegt wurden. Das Reichsheimatgesetz aus 1863, das in den nachfolgenden Landesgesetzen näher konkretisiert wurde, steckte die formalen und inhaltlichen Konturen der Armenfürsorgepolitik ab – nämlich die Einbettung in die Zuständigkeit der Länder und Gemeinden bei Orientierung am Subsidiaritäts- und Individualisierungsprinzip.
Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 traten an Stelle der österreichischen die deutschen fürsorgerechtlichen Vorschriften. Diese blieben nach 1945 bis zur Neugestaltung der einzelnen Rechtsgebiete als österreichische Rechtsvorschriften in vorläufiger Geltung. Bis 1948 nahm der Bund seine nach der Verfassung von 1920 vorgesehene Grundsatzkompetenz nicht wahr. Die reichsdeutschen Fürsorgevorschriften traten als Bundesgesetz außer Kraft und die Bundesländer erlangten wieder Gesetzgebungskompetenz. Diese wurde von den Bundesländern nach 1948 nur in der Weise genutzt, dass sie die reichsdeutschen Vorschriften als Landesgesetze übernahmen.
Читать дальше