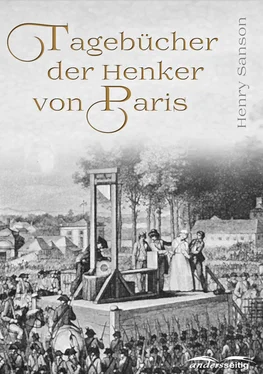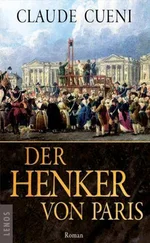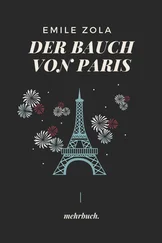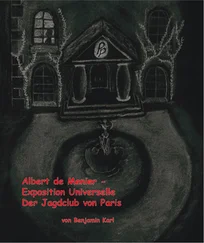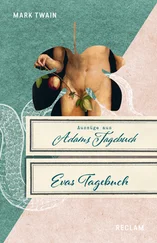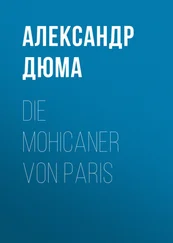Diese großen Namen, die in der Menge umhergingen, gelangten auch zu meinem Ahnen, der erstaunt war, darunter nicht den des Marquis von Créquy zu hören. Aber dieses Erstaunen dauerte nicht lange. Plötzlich entstand an einem Ende des Platzes ein großes Geräusch, und zwei Kutschen, die noch pompöser aufgeputzt waren, als die ersten, erschienen und stellten sich neben diesen auf.
Dies war endlich der Marquis von Créquy. Er ließ den Wagenschlag öffnen und stieg mitten auf dem Platze in der Uniform eines Generalobersten und ersten Inspekteurs der königlichen Truppen aus; er trug die Insignien des goldenen Vlieses sowie die Großkreuze des heiligen Ludwig und des heiligen Johann von Jerusalem auf der Brust. Trotz des tiefen Schmerzes, der auf seinem Gesichte lag, ging er festen Schrittes über den Platz.
Die Menge machte ehrfurchtsvoll vor dieser großen Persönlichkeit, bei der Ludwig XIV. Pate gestanden hatte, Platz.
Es schien, dass das bei der Hinrichtung beauftragte Magistratsmitglied nur diese Erscheinung erwartet hatte, um dem grausamen Verfahren ein Ziel zu setzen; denn sobald es Herrn von Créquy erblickte, verließ es den Balkon des Rathauses und zog sich zurück, was heißen sollte, dass die Gerechtigkeit nun ihren Lauf gehabt habe.
Der Marquis kam gerade auf meinen Ahnen zu und machte ein sehr strenges Gesicht dabei.
Dann warf er einen düsteren Blick auf ihn und fragte fast drohend:
»Mein Herr, was ist aus Ihren Versprechungen geworden?«
»Hoher Herr,« erwiderte Charles Sanson, »diesen Morgen um acht Uhr lebte der Herr Graf von Horn nicht mehr und die Barre meiner Leute hat nur noch einen Leichnam getroffen.«
Der Geistliche neigte sich zu dem Ohr des Herrn von Créquy und bestätigte dasjenige, was mein Ahne soeben versichert hatte.
»Es ist gut,« sagte er in sanfterem Tone, dem man eine große Erleichterung anhörte, »unser Haus wird sich wohl erinnern, dass, wenn es nichts von dem Regenten oder der Gerechtigkeit des Parlaments erlangen konnte, es doch der Menschlichkeit des Henkers einen außerordentlichen Dank schuldet.«
Man beschäftigte sich sogleich damit, den Körper des Grafen von Horn loszubinden, um denselben in eine der Kutschen, welche der Marquis von Créquy mitgebracht hatte, zu schaffen.
Dieser arme Leichnam war so verstümmelt, dass die Glieder herabhingen und sich vom Rumpfe lösen zu wollen schienen.
Herr von Créquy wollte durchaus, wie als eine Art von Protest gegen die Grausamkeit des Urteils, selbst eines der herabhängenden Beine halten, welches nur noch durch einige Fasern blutiger Haut mit dem toten Körper zusammenhing.
Als diese traurige Pflicht erfüllt war, setzten sich die Wagen wieder in Bewegung und zogen hintereinander nach dem Hotel der Gräfin von Montmorency-Logny, einer geborenen von Horn, wo die Überreste des Grafen in einen Sarg gelegt und dieser auf ein Trauergerüst gestellt wurde. Er blieb daselbst achtundvierzig Stunden stehen, von zahlreicher Geistlichkeit, welche das Totenamt verrichtete, umgeben.
Diese Begebenheit brachte die größten Persönlichkeiten im Staat lebhaft gegen den Regenten und seine Günstlinge auf; sie half Law und seinem System, dessen Katastrophe unvermeidlich war, gar nichts.
War der Graf von Horn wirklich unschuldig?
Man sagt, der Herr Graf von Horn und der Chevalier von Milhe hätten dem Juden keineswegs in der Absicht, ihn zu morden und auszuplündern, ein Rendezvous gegeben, sondern nur um die Wiedererstattung einer ansehnlichen Summe in Bankaktien, die ihm der Graf wirklich anvertraut habe, zu erlangen; der Jude habe nicht allein das ihm Anvertraute ganz abgeleugnet, sondern sich sogar so weit vergessen, Anton von Horn in das Gesicht zu schlagen. Da habe sich der junge Mann, der von seinen Ahnen ein leicht entzündliches und aufbrausendes Blut geerbt, nicht mehr halten können, habe ein Messer ergriffen, das gerade vor ihm auf dem Tische in dem Wirtshause gelegen, und damit auf den Juden einen Stich geführt, der denselben nur an der Schulter verwundete. Der Chevalier von Milhe habe den Mord zu Ende geführt und sich der Brieftasche bemächtigt; der Graf habe um keinen Preis auf eine Teilung des Geldes eingehen wollen.
Was Charles Sanson anbetraf, so schnitt er in dem letzten Augenblicke, den er bei dem leblosen Körper zubrachte, eine Haarlocke von dem so schnell kalt gewordenen Haupte des jungen Mannes. Er legte sie in eine Hülle und adressierte sie an die Marquise von Parabere mit den wenigen Worten:
»Das versprochene Andenken.«
Cartouche
Der Verbrechertyp des 18. Jahrhunderts.
Am 15. Oktober 1721 hatte Paris das Fieber wie am Tage nach einem großen Siege. Die ganze Bevölkerung war auf den Straßen; auf den Promenaden, in den Kaufläden, Wirtshäusern und selbst in den Salons begegnete man sich nur mit einer Nachricht, die noch immer eine Menge von Ungläubigen fand:
»Cartouche ist ergriffen worden.«

Cartouche ist das Ideal der Diebe des 18. Jahrhunderts geblieben. In der Sphäre des Verbrechens repräsentiert er vollständig die Übergangsperiode, in der er lebte. Man findet in diesem Übeltäter etwas, das an den Straßenräuber des Mittelalters und an den Gauner unserer Zeit erinnert. Wie der erstere greift er oft zur brutalen Gewalt, aber die List bleibt doch seine Lieblingswaffe, darin ist er vollkommener Meister. Er hat schon einen Begriff von allen den Vervollkommnungen, die seine Nachfolger in die immer schwieriger werdende Kunst, sich des Gutes anderer zu bemächtigen, brachten, und man kann von ihm sagen, dass er der Vorgänger der Diebe unserer Generation gewesen sei.
Die Kraft der Kühnheit Cartouches, sein an Entwürfen so fruchtbarer Geist, seine körperliche Geschicklichkeit, die Energie, mit der er allen Entbehrungen und Anstrengungen widerstand, besonders aber seine wahrhaft ausgezeichnete Schlauheit bezeichneten ihn natürlich als Chef aller dieser Banden, die eine ebenso große Menge tätig Handelnder als Verbündeter aller Art zählten.
Gewisse Abenteuer, bei denen der Aristokratie angehörige Personen eine Rolle spielten, die den Salons hinlänglichen Stoff zu Klatschereien gaben, brachten ihn in die Mode; eine glückliche Entweichung, einige originelle Streiche machten ihn populär.
Der zum Nachteil des Erzbischofs von Bourges begangene Diebstahl belustigte eine Zeitlang alle Neuigkeitskrämer.
Der Herr Kardinal von ???Gesvres, Erzbischof von Bourges, verreiste von Paris und wurde etwas oberhalb von Saint-Dénis durch die Truppe Cartouches angehalten und ausgeplündert. Man nahm ihm sein geistliches Kreuz und den Priesterring, zehn Louisdor, die Seine Eminenz in der Börse hatte, eine Pastete von Rotkehlchen und zwei Flaschen Tokaierwein, die er Herrn von Breteuil abgewonnen hatte, ein ziemlich mageres Lösegeld für einen solch edlen Fang.
Die satirische Laune der Zeit machte hierüber ihre skandalöse Chronik.
Man behauptete, dass die Diebe den Abbé Cerutti, der bei dem Prälaten im Wagen saß und noch sehr jung und recht hübsch war, für eine Dame im Priesterrock angesehen hätten und dass, als der Herr Kardinal sich sehr beleidigt über eine solche Vermutung gezeigt, Cartouche seine Untergebenen mit den Worten zurechtgewiesen habe:
»Ich will euch lehren, vor der Geistlichkeit Ehrfurcht zu haben. Seht doch diese verteufelten Kerle, die den Kardinal von Bourges angreifen! Wißt ihr nicht, dass er nie seinen Zehnten annehmen will, wenn die Felder seiner Zinszahler verhagelt sind?«
Die Frau Marquise von Beauffremont wurde auch die Heldin einer dieser wenig authentischen Geschichtchen. Man behauptete, dass sie einen Freipaß gegen die Nachtdiebe besäße und dass es erstaunenswert sei, welchen Kredit sie bei Cartouche habe; hier folgt der Grund für diese hübschen Vorteile.
Читать дальше