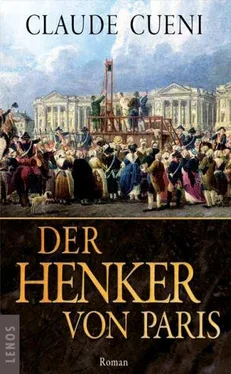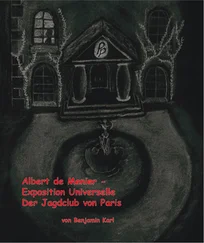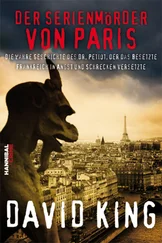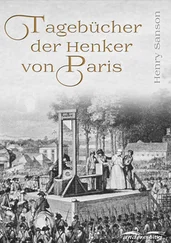Für Clovis, Dina, Emmanuel
Gegen Mitternacht – man schrieb das Jahr 1737 – fegte ein gewaltiger Sturm über die Normandie. Es regnete in Strömen. Krachend schlug der Blitz in einen bewaldeten Hügel ein und erhellte für einen Sekundenbruchteil den Reiter, der durch die Nacht preschte. Er schlug seinen Rappen wie von Sinnen, als wollte er dem sintflutartigen Regen entkommen, der sich über die Landschaft ergoss. Nun spaltete ein Blitz nach dem andern den Nachthimmel und entlud sich krachend über den Hügeln. Bäume knickten ein wie Streichhölzer. Der schwarze Hengst heulte kurz auf, als sie ein kleines Gehöft passierten. Der verwitterte Anstrich schien blutrot. Der Reiter gab dem geschundenen Tier erneut die Sporen. Es riss unwillig den Kopf hoch. Weisser Schaum spritzte durch die Nacht und wurde sogleich weggewaschen. Der Reiter preschte weiter auf der überfluteten Landstrasse nach Neufchâtel im Pays de Bray, während der Regen tosend auf ihn niederprasselte. Plötzlich sah er ein gelblich flackerndes Licht zwischen den Bäumen, die Umrisse eines Gasthofes. Im gleichen Augenblick knickte sein Pferd mit den Vorderbeinen ein, und er flog in weitem Bogen über den Kopf des Tieres hinweg. Sein Körper klatschte in eine Pfütze und schlitterte noch einige Meter weiter, bis er schliesslich mit dem Kopf gegen einen vom Sturm abgeknickten Baumstamm krachte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er bemerkte, dass er den Sturz unverletzt überlebt hatte. Dann kamen die Schmerzen. Sein Rappe lag erschöpft und wimmernd am Wegrand und versuchte vergeblich, sich zu erheben. Hilflos ruderte das Tier mit den Beinen und warf dabei den Kopf wiehernd in die Höhe. Ein letztes Mal. Dann klatschte er in den Schlamm und regte sich nicht mehr. Es war stockfinster.
Der Reiter erhob sich langsam und verharrte eine Weile in gebückter Haltung. Keuchend schaute er zu seinem Pferd. Dann bemerkte er die Satteltasche: Sie hatte sich offensichtlich vom Ledergurt losgerissen und lag ihm zu Füssen. Er öffnete sie und entnahm ihr eine schwere doppelläufige Pistole mit Radschloss. Er hatte sie beim Pharospiel gewonnen. Plötzlich glitt er aus und rutschte erneut über den schlammigen Erdboden. Auf den Knien suchte er nach seiner Waffe, die ihm aus der Hand geflogen war. Er fand sie. Erleichtert näherte er sich auf den Knien dem Rappen. Fast zärtlich fuhr er ihm über die Nüstern. Er setzte die Pistole an die Schläfe des Pferdes und drückte ab. Man hörte kein Aufschlagen des Hahns. Das Zündpulver war nass. Erneut zerriss ein kräftiger Donner die Stille der Nacht. Krachend schlugen weitere Blitze in der Nähe ein. Der Reiter erhob sich. Kübelweise ergoss sich der Regen über seine durchnässte Uniform. Doch er war nicht den langen Weg geritten, um hier aufzugeben.
Er stampfte über den aufgeweichten Lehmboden und näherte sich Schritt für Schritt dem gelblichen Licht. Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Hatte Gott seine Gebete erhört? Er stiess die Tür des Gasthofes auf. Im Innern sassen einige düstere Gesellen an einem langen Tisch. Die anderen Tische waren leer. Bis auf einen: An einem kleinen, runden Tisch in der Ecke sass ein Hüne von Mann allein vor einem hölzernen Becher.
Der Reiter schloss die Tür hinter sich. Nun waren alle Blicke auf ihn gerichtet. Denn auch er war von ungewohnt hohem Wuchs. Er hatte eine aufrechte, stolze Körperhaltung und halblanges braunes Haar. Jetzt bemerkte er den Wirt hinter dem Tresen. Dieser sah ihn nicht gerade freundlich an. Die Gesellen am langen Tisch musterten die Hose des späten Gastes. Sie war vom Schlamm verschmutzt. Dennoch konnte man die Farben des Regiments des Marquis de La Boissière erkennen, die sich vom Gurt bis hinunter zu den schlammverspritzten Stiefeln abzeichneten. Es war eine Offiziershose.
»Wo sind wir hier?«, fragte der Reiter.
Niemand gab ihm eine Antwort.
Er wandte sich an den Wirt: »Gib mir was zu trinken.«
»Das haben wir nicht«, sagte der Wirt nach einer Weile.
»Wein. Rotwein.«
Der Wirt nahm eine Flasche und füllte einen Becher voll. Der Reiter kramte eine Münze aus seiner Tasche und legte sie auf den Tresen. Der Wirt musterte das Geldstück. Es war ihm unbekannt.
»Sie wurde in Nouvelle-France geprägt«, sagte der Offizier, und als wollte er sich endlich die gebührende Autorität verschaffen, fügte er hinzu: »Ich bin Leutnant Chevalier de Longval, Jean-Baptiste Sanson de Longval.«
Der Wirt senkte verunsichert den Kopf. Respektvoll wich er einen Schritt zurück. Langsam schob er den Becher über den Tresen und fragte: »Hast du in Indien gekämpft?«
»Wir nennen es Amerika, aber die Eingeborenen, die nennen wir Indianer. Ich weiss nicht, was richtig ist. Hauptsache, wir verstehen uns.«
Der Wirt nickte und sagte nach einer Weile: »Wir mögen hier keine Fremden.«
»Ich war nie wirklich weg. Ein Jahr vielleicht.«
Der Wirt schüttelte den Kopf. »Ich habe schon einige gesehen, die drüben waren. Das sind nicht mehr die gleichen Leute, wenn sie zurückkommen. Die reden dann dummes Zeug. Denn drüben, da gibt es keine Könige. Da ist jeder sein eigener König. Das habe ich mal gehört.«
»Ja«, murmelte Leutnant Sanson, »es gibt sogar welche, die sich von Frankreich abspalten wollen. Dafür ziehen sie in den Krieg und sterben. Sie wollen Freiheit.«
Der Wirt musterte ihn skeptisch und wandte sich dann von ihm ab. Er brachte den Gästen am langen Tisch einen neuen Krug Wein.
»Wo ist der Rest deiner Armee?«, stichelte einer der Gesellen und zeigte seine schwarzen Zahnstummel. Nun lachten die Saufkumpane. Es war ein raues, respektloses Lachen. Wie eine verschworene feindliche Truppe sassen sie an ihrem Tisch und lauerten auf seine Antwort.
»Desertiert«, fragte einer, »oder bringst du uns den Krieg?«
Der Leutnant trank seinen Becher in einem Zug leer und trat an den langen Tisch. »Messieurs, mein Regiment ist in der Nähe von Dieppe stationiert. Es ist das Regiment des Marquis de La Boissière. Ich bin im Auftrag meines Kommandanten unterwegs. Ich habe eine dringende Depesche für Paris.« Er nahm Haltung an und legte seine rechte Hand auf den eisernen Korb seines langen Degens. »Ich brauche ein frisches Pferd.« Er schaute den Wirt fordernd an.
»Siehst du hier irgendwelche Pferde?«
»Er hat nur uns«, grölte einer der Gesellen. Die anderen kicherten besoffen vor sich hin.
»Wie bist du denn hergekommen?«, fragte der Wirt.
»Mein Pferd liegt draussen im Schlamm. Es hat sich das Bein gebrochen.« Er wurde allmählich ungeduldig. »Ich wollte ihm den Gnadenschuss geben, aber das Zündpulver ist nass.«
Nun schauten alle zu jenem Gast hinüber, der einsam am kleinen, runden Tisch in der Ecke sass. Doch dieser blickte nicht auf. Er starrte in seinen Becher. Sein Haupt war kahl.
»Frag ihn«, sagte der Wirt unwirsch, »vielleicht hat er ein Pferd für dich. Bei uns kannst du eh nicht bleiben. Wir haben keine Gästezimmer.«
»Ich brauche auch eine Waffe, mein Pferd muss erlöst werden.«
»Sehe ich aus wie ein Waffenhändler?«, brummte der Wirt. »Frag ihn. Er kennt sich aus mit Tieren. Er weiss, wie man ein sterbendes Pferd erlöst.«
Die Männer am langen Tisch lachten erneut.
»Fünf Sou«, brummte der Hüne in der Ecke.
Leutnant Sanson kramte einige Münzen aus der Tasche und legte sie auf den Tresen.
»Gib es ihm selber«, sagte der Wirt mit einem seltsam verächtlichen Unterton.
»Nein«, erwiderte der Hüne, »lass es auf dem Tresen. Er soll mir dafür nochmals Wein bringen.«
Der Leutnant schob einen leeren Becher über den Tresen. »Gib ihm Wein.«
Der Wirt nahm den Becher und stellte ihn wieder auf den Kopf. »Er trinkt aus seinem eigenen Becher.«
Der Leutnant blickte hinüber zu den Gesellen am langen Tisch. Sie schwiegen. Stumm starrten sie ihn an. Er nahm die Weinkaraffe und ging langsam zu dem Mann in der Ecke. Er blieb vor seinem Tisch stehen und schenkte ihm Wein nach.
Читать дальше