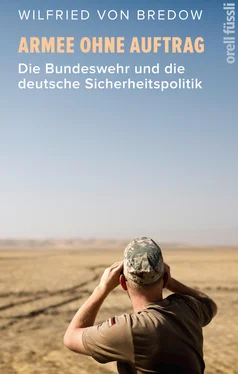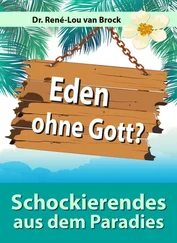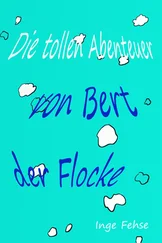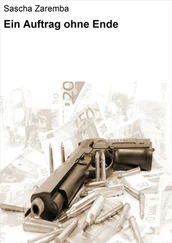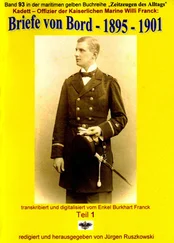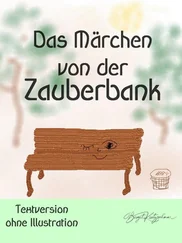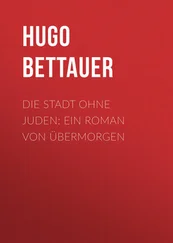In ihrem ersten Teil stehen die Veränderungen der politischen Weltlage und die Schwierigkeiten im Vordergrund, ihnen mit angemessenen Konzepten und Strategien für internationale Sicherheit zu begegnen. Der unübersichtlich gewordenen Lage und Entwicklung der Weltpolitik kommt man nämlich mit überalterten Vorstellungen über Frieden und Sicherheit nicht bei. Wenn Staaten und ihre Regierungen über keine wirklich langfristigen Konzepte und Orientierungsrahmen für ihre Außen- und Sicherheitspolitik verfügen, kann das, optimistisch interpretiert, ihre Flexibilität erhöhen. Andererseits reduziert sich dadurch ihre Verlässlichkeit. Beides zu optimieren, ist nicht ganz einfach, vor allem bei internationalen Krisen und Konflikten.
Deutschland befindet sich mit seinen Schwierigkeiten in der Sicherheitspolitik keineswegs völlig allein auf weiter Flur. Das ist nach einem Blick auf andere Staaten auf der weltpolitischen Bühne wichtig festzuhalten, wenn es auch kein Trost ist. Denn die Schwierigkeiten und Probleme Deutschlands haben ein besonders scharfes Profil, weil sich hier vieles mehr und grundlegender als anderswo zu ändern hätte. Die vergleichsweise recht komfortable wirtschaftliche und politische Situation des Landes hat aber gerade nicht dazu geführt, dass sich der sicherheitspolitische Diskurs durch ein bemerkenswertes Maß an zukunftsbezogener politischer Einbildungs- und Urteilskraft auszeichnet. Stattdessen ist er träge, repetitiv, zuweilen rechthaberisch und Ausdruck einer kollektiven Ruhebedürftigkeit, gelegentlich nur unterbrochen durch kurze Phasen kollektiver Panik. Alles in allem angesichts der gegenwärtigen und vor uns liegenden Aufgaben völlig unangemessen.
Im zweiten Teil geht es um die Organisationsrahmen deutscher und europäischer Sicherheit, nämlich die NATO, die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Europäischen Union und nationale Sicherheitsvorkehrungen. Zwei komplementäre Fragen drücken hier zunächst aufs politische Gemüt: Inwieweit sind die Maßnahmen und Handlungen der von den USA dominierten NATO mit den europäischen Eigenanstrengungen für die Sicherheit Europas vereinbar? Wie ergänzen und wo widersprechen sich amerikanische und europäische Vorstellungen zur Stabilisierung der internationalen Sicherheit? Der Themenkomplex Europäische Sicherheit erweist sich zudem auch deshalb als unübersichtlich, weil die (Führungs-)Rolle Deutschlands in der Europäischen Union einerseits notwendig, andererseits aber umstritten ist, nicht zuletzt in Deutschland selbst.
Der am ausführlichsten geratene dritte Teil beleuchtet die Schwierigkeiten, die Deutschland damit hat zu akzeptieren, dass die Streitkräfte in der Tat ein wesentliches, ja ein unabdingbares Instrument der Sicherheitspolitik sind. Am liebsten würden die Deutschen sie als eine Art Technisches Hilfswerk einsetzen. Die Bundesregierungen haben nach 1990 immer wieder Anläufe zur Reform der Bundeswehr gemacht und ihre Angehörigen damit einem Dauerstress ausgesetzt. Das hat in den letzten Jahren zu einer unguten Problem-Kumulation bei Waffen und Geräten, der Hardware , aber auch in den Köpfen mancher Soldaten, der Software , geführt. Damit müssen wir jetzt fertig werden.
Rein betriebswirtschaftliche und organisations-reforme-rische Lösungen der akuten Probleme greifen ebenso zu kurz wie heftige Schnitte in der Spitzenpersonal-Politik. Stattdessen muss ein größerer Umweg eingeschlagen werden. Es braucht eine kühle Analyse der Ziele, Interessen, Möglichkeiten und erfolgreichen Methoden der deutschen Sicherheitspolitik. Erst dann kann die Grundvorstellung von der Rolle der Streitkräfte als Instrument der Politik angemessen korrigiert werden. Auf dieser Basis können dann Fragen wie »welche Bundeswehr benötigen wir?« und »was darf oder soll sie uns kosten?« sinnvoll beantwortet und danach die nötigen Entscheidungen getroffen werden.
Weltpolitische Klimaverschlechterung
Alle reden vom Klima und sind besorgt über den globalen Klimawandel. Das betrifft nicht nur das Wetter, sondern auch das politische Klima. Als sich die ohnehin immer brüchiger gewordene Ost-West-Bipolarität um 1990 aufgelöst hatte, drängten sich neue Schlüsselbegriffe zur Kennzeichnung der weltpolitischen Entwicklung auf: Paradoxe Globalisierung, Verblassen des internationalen Regelkonsens, Überdrehung der Finanzmärkte, Staatsabschwächung und Staatsverfall auf mehreren Kontinenten, Scheitern der US-amerikanisch geführten Weltordnungspolitik, Aufstieg der Volksrepublik China, wachsendes Destruktionspotenzial religiös begründeter Politik, neue Formen der Kriegsführung. Wahrlich unübersichtlich, das alles! Oder anders gesagt: Die Welt von heute hat es mit einem höheren Maß an Gefahren und Unsicherheit zu tun. Das trifft auch dann zu, wenn man in Rechnung stellt, dass die direkte nuklearstrategische Konfrontation der damaligen weltpolitischen Vormächte USA und UdSSR in dieser Form heute nicht mehr existiert.
Zugleich hat sich in den letzten Jahren die Zahl jener existenziellen Weltprobleme erhöht, die mit Aussicht auf Erfolg nur mittels gemeinsamer Politik gelöst oder wenigstens gemildert werden können. Aber wie sollen zum Beispiel umwelt- und klimapolitische Ziele erreicht werden, wenn die – metaphorisch so bezeichnete – weltpolitische Klimaverschlechterung weiter anhält?
Kleiner historisch-politologischer Exkurs
Weltpolitik, die diesen Namen sozusagen geografisch zu Recht trägt, gibt es noch gar nicht so lange, erst seit drei, vier Jahrhunderten. In den Zeiten davor blieb die im Bewusstsein der Menschen und für die Politik eines Staates relevante Außenwelt in der Regel territorial beschränkt. Die »Welt« umfasste noch nicht den gesamten Globus. Die Erde als politisch vorstellbare Einheit gab es noch nicht. Die Menschen kamen erst langsam dazu, global zu denken. Trotzdem existierten und konkurrierten kleine und große Reiche, gab es expansive Kulturen; und freilich jede Menge Kriege und Feldzüge. Manche, wie etwa die Alexanders des Großen, halfen, das Weltbewusstsein der Zeitgenossen erheblich zu erweitern.
Wenn sie das gesamte Beziehungsgefüge der Staaten und anderer grenzüberschreitend aktiver Organisationen und Akteure beschreiben, benutzen die Politologen den Begriff des internationalen Systems . Er ist zunächst rein formaler Natur und soll ein Gebilde kennzeichnen, dessen Zusammenhang und Zusammenhalt inhaltlich auf der allgemeinen Anerkennung eines mal kleineren, mal etwas größeren Minimums von Regeln und Umgangsformen der beteiligten Staaten besteht. Daraus ergibt sich schon rein aus Gründen der wechselseitigen Betroffenheit, der Macht des Faktischen, die Notwendigkeit zur Kommunikation untereinander. Die muss nicht freundlich sein, denn die Konkurrenzen und Interessenkonflikte bestehen ja auch innerhalb eines solchen internationalen Systems. Aber ein Mindestmaß an gültigen Regeln, rechtlich fixiert oder informell, darf nicht unterschritten werden.
Früher blieben internationale Systeme groß-regional beschränkt, etwa das der griechisch-römischen Zeit des Mittelmeerraums. Seit dem 15./16. Jahrhundert expandierte das eurozentrische internationale System des Mittelalters schrittweise über den ganzen Erdball. Es führte im 17. Jahrhundert festere rechtliche und politische Umgangsregeln ein und wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu dem ersten wirklich globalen, d. h. erdumspannenden internationalen System.
Diese Expansion beruhte auf politischen, wirtschaftlichen und technologischen Impulsen, allesamt in sich konfliktreich. Der Erwerb von Kolonien und ihr Zusammenbinden in überseeische Besitztümer ging nicht ohne brutale Eroberungs- und Unterwerfungskriege ab, zugleich aber auch nicht ohne Kriege zwischen den konkurrierenden europäischen Mächten um die Vorherrschaft in Europa. Historiker wie Paul Kennedy haben diesen quasipermanenten Streit um die Vorherrschaft und die Anstrengungen der einzelnen Staaten, sich in der Rangfolge der mächtigsten Staaten besser oder sogar möglichst ganz oben zu positionieren, als einen der Gründe ausgemacht, warum gerade das europäische internationale System sich globalisiert hat.
Читать дальше