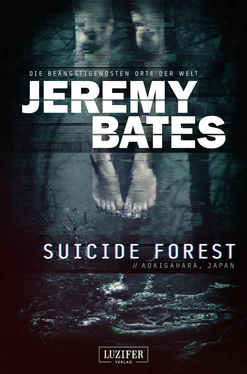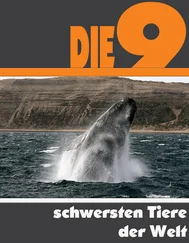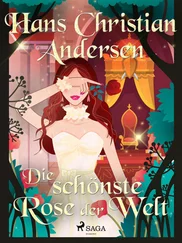Jerome Tyler, den die Polizei am Tag nach Garys Tod festgenommen hatte, war wegen vorsätzlichen Mordes an den Pranger gestellt worden. Das Gerichtsverfahren hatte nur eine Woche gedauert. Die Geschworenen waren nach einer Stunde mit einem einhelligen Urteil in den Saal zurückgekehrt: lebenslänglich mit Aussicht auf Bewährung nach zehn Jahren.
Damals hielt ich dies für extrem ungerecht, denn Jerome war ein kaltblütiger Mörder und verdiente keine mildernden Umstände, sondern nur den Tod – Auge um Auge.
Ich hatte Fantasien darüber nachgehangen, wie ich ihn eigenhändig umbringen würde; das half mir abends beim Einschlafen. In jedem dieser Gedankenspiele tötete ich ihn auf eine andere Art, aber niemals sofort. Es dauerte stets lange, war also ein ausgedehnter Vorgang. Währenddessen redete ich mit ihm und verspottete ihn, hielt mein Leben im Angesicht seines Todes hoch und zeichnete ein deutliches Bild der Nichtigkeit, die ihm blühen würde.
Heute lasse ich mich nicht mehr auf solche Fantasien ein, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich Jerome verziehen hätte. Es gibt einfach keinen Grund mehr, noch einen Groll gegen ihn zu hegen. Denn nach sieben Monaten im Gefängnis fand man ihn mit dem Kopf in einer Kloschüssel und mit sieben Messerstichen im Rücken. Als offizielle Todesursache wurde Ertrinken angegeben.
So hatte ich es mir zwar nie vorstellt, aber es sollte mir recht sein.
Zwanzig Minuten später stießen wir auf ein weißes Band. Es war locker um den Stamm eines kleinen Baumes gewickelt und führte im rechten Winkel von uns fort in den Wald hinein. Wir betrachteten es, wobei wohl jeder von uns seine ganz eigenen Mutmaßungen anstellte.
»Ist das auch eine Orientierungshilfe der Polizei?«, fragte Mel neugierig.
»Entweder das, oder ein Selbstmörder hat es gespannt«, behauptete Tomo.
»Warum sollte das jemand tun, der sich umbringen will?«
»Damit man seine Leiche findet?«, vermutete Neil.
Tomo schüttelte den Kopf. »Nein, damit er wieder rauskommt.«
»Das finde ich unlogisch. »Wenn er Suizid begehen will, Tomo, muss er doch wohl den Rückweg nicht kennen.«
»Manche sind noch nicht entschlossen, sondern denken noch darüber nach.«
»Also ziehen sie so etwas hinter sich her, falls sie es sich anders überlegen mit dem Selbstmord?«
»Ja, Mann«, bestätigte er und setzte sich in Bewegung, um dem Band zu folgen.
»Warte!«, rief Mel. »Wo willst du denn hin?«
Er drehte sich um. »Wir dem Band folgen, richtig?«
»Weißt du vielleicht, was uns am Ende erwarten könnte?«, fragte Neil.
»Sei nicht wieder Feigling.«
Neil schaute ihn verärgert an. »Nenn mich nicht so.«
»Wie, Feigling?«
Während wir an dem Band entlanggingen, versuchte ich, mich in den Kopf einer Person hineinzuversetzen, die alleine in diesen Wald kommt und eine solche Rettungsleine hinter sich herführte, damit sie umkehren konnte, wenn sie sich dazu besann, in die Zivilisation zurückzukehren. So jemand litt bestimmt schon seit einer ganzen Weile. Wer sich umbrachte, tat dies nur selten spontan, sondern erst nach reiflicher Überlegung. Aber was genau bewog Menschen dazu, ihr Leben selbst zu beenden? Der Tod eines Lebensgefährten oder eines Kindes? Finanzieller Ruin? Gesundheitsprobleme?
Oder einfach nur eine Menge Pech?
Ich stellte mir vor, wie solche Leute spätnachts im Dunkeln an ihrem Computer saßen, vielleicht eine Zigarette rauchten und unterschiedliche Selbstmordarten recherchierten, auch über diesen Wald oder zumindest einen Weg dorthin und über Parkgelegenheiten. Dabei bekam ich sofort eine Gänsehaut an den Armen.
Recherche fürs eigene Ableben …
Der Mensch, der sich wie Gott aufführt.
Ich bemerkte, wie ich ganz allmählich schneller geworden war. Zuerst dachte ich, dies rühre daher, dass ich zügig vorankommen wolle, um während der restlichen Zeit, die uns hier noch blieb, so weit wie möglich zu gehen, doch dann wurde mir bewusst, dass es noch einen tieferen Grund hatte, denn der Wald schien mich geradezu in seine Umarmung zu ziehen wie der empfindsame Wald, der mir im Kopf herumgegeistert war.
Mir fiel zuerst gar nicht auf, dass ich die anderen hinter mir gelassen hatte, bis Mel meinen Namen schrie.
Sie lag bereits zwanzig Fuß zurück und war bis zum Hals in den Boden eingesunken. Die Unterarme hatte sie verzweifelt um eine verdrehte Wurzel geschlungen, wahrscheinlich das Einzige, was sie davor bewahrte, noch tiefer in die Erde zu sacken.
Soweit ich es erkannte, als ich sie erreichte, war sie in einen der vulkanischen Krater getreten, weil man diese unter dem Gewirr aus Wurzeln und Abraum nicht erkennen konnte. Seinen Durchmesser schätzte ich auf knapp sechs Fuß, doch dies sicher zu sagen war schwierig, weil man kaum erkennen konnte, wo der feste Boden genau aufhörte. Spontan hätte ich es auch für eine Jagdfalle halten können, die Trapper mit Zweigen und Laub getarnt hatten, bloß dass sie dem Wald selbst erwachsen und nicht von Menschenhand erschaffen worden war.
»Hast du dir wehgetan?«, fragte ich, während sich meine Gedanken überschlugen, um eine Möglichkeit zu finden, sie herauszuholen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie mit vor Panik weit aufgerissenen Augen. Sie drehte suchend den Kopf hin und her, weil sie sich an etwas anderem als der Wurzel festhalten wollte. Ich kniete dort nieder, wo ich den Rand des Lochs vermutete. Mel war leider zu weit weg, um mich nach ihr ausstrecken zu können. »Wie tief ist es?«
»Das weiß ich auch nicht.« Sie versuchte, nicht panisch zu klingen, doch das misslang ihr gründlich. »Ich spüre auf jeden Fall keinen Boden unter mir.«
»Schaffst du es irgendwie von selbst da raus?«
Sie bemühte sich einen Augenblick lang und wandte sich in alle Richtungen, bis die Wurzel, an der sie hing, verrutschte, sodass sie auf einmal mehrere Zoll tiefer sackte.
Sie schrie erschrocken auf.
Ich hechtete vorwärts und packte ihre Handgelenke. Das war natürlich äußerst dämlich; eine instinktive Reaktion. Jetzt lag ich nämlich auf dem Bauch und hing mit dem Oberkörper über der Kante, weshalb ich keinen Halt fand, um Mel herauszuholen, und mich alleine auch unmöglich selber wieder zurückziehen konnte.
Unter uns sah ich zwischen dem toten Laub und den Zweigen nichts als Dunkelheit.
Wie tief ist es wohl?
»Lass mich nicht los«, wisperte sie voller Furcht.
»Das werde ich nicht.«
Nun hörte ich Neil und Tomo näherkommen.
»Passt auf!«, warnte ich sie.
»Meine Fresse«, sagte ersterer.
»Oh Shit!«, fluchte der Japaner. »Der Wald will sie fressen, fuck.«
»Haltet meine Beine fest«, bat ich, »damit ich nicht auch noch reinfalle.«
Einen Moment später spürte ich Hände an meinen Fußgelenken.
»Nicht loslassen!«
»Wie kommst du darauf, Mann?«, erwiderte Tomo.
»Mel«, sagte ich, während ich versuchte, Ruhe zu vermitteln, weil ich mich fühlte wie ein Esel auf sehr dünnem Eis. »Leg die Arme nun vorsichtig um meinen Hals und ich schlinge meine um dich. Dann werden uns Tomo und Neil rausziehen.«
»Ich kann aber nicht loslassen.«
»Doch, du kannst. Das Loch ist vermutlich sowieso nicht sonderlich tief. Denk einfach nicht daran.«
»Du hast doch selbst gesehen, wie tief diese Krater sein können.«
»Dieser hier ist aber eher klein. Komm schon, du schaffst das.«
Sie sah so ängstlich aus, als ob sie gleich in Tränen ausbrechen würde. Nachdem sie sich so weit umgedreht hatte, bis sie sich die Wurzel in eine Armgrube klemmen konnte, streckte sie die andere Hand nach mir aus und bekam nun endlich meinen Jackenkragen zu fassen. Ich schob meinen Arm daraufhin unter ihren.
»Gut«, sagte ich, um ihr Zuversicht zu spenden. »Jetzt das Gleiche noch einmal mit dem anderen.«
Читать дальше