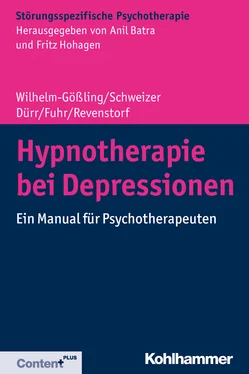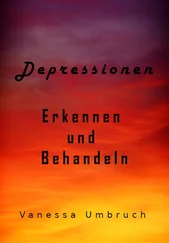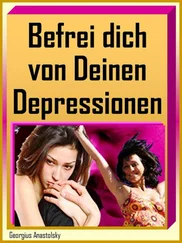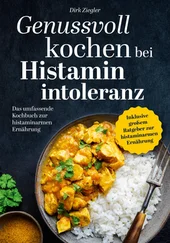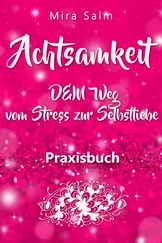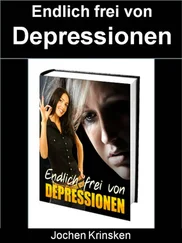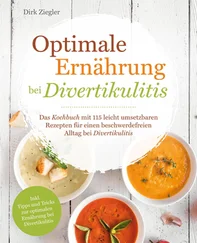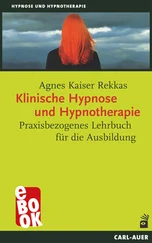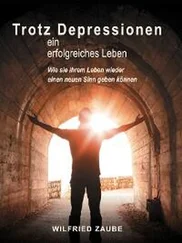Dirk Revenstorf - Hypnotherapie bei Depressionen
Здесь есть возможность читать онлайн «Dirk Revenstorf - Hypnotherapie bei Depressionen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hypnotherapie bei Depressionen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hypnotherapie bei Depressionen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hypnotherapie bei Depressionen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Hypnotherapie bei Depressionen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hypnotherapie bei Depressionen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2Die Bedeutung des Begriffs »Metapher«, wie sie im Buch verwendet wird, geht über die sprachwissenschaftliche Bedeutung hinaus und schließt stellvertretend auch »Parabeln« und »Erzählungen«, die mit bildhaften Übertragungen spielen, mit ein.
1 Einleitung
Kristina Fuhr
Bezogen auf die mit einer Krankheit gelebten Lebensjahre (Years lived with Disease/Disability, YLD), die regelmäßig von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhoben werden, sind psychische Störungen der Hauptgrund für chronische Erkrankungen in der europäischen Bevölkerung. Dabei stehen Depressionen mit etwa 7,5% im Jahr 2015 mit an vorderster Stelle für YLD (Global Health Estimates 2015; World Health Organization 2017). Es scheint, als wären die Prävalenzen für die Major Depressionen in den letzten Jahren angestiegen, wenn man beispielsweise die Prävalenzraten in den USA in den letzten Jahrzehnten miteinander vergleicht (Kessler et al. 2003; Kessler et al. 2012). Dabei wurden im Jahr 2003 Lebenszeitprävalenzen von 16–20% (Kessler et al. 2003), zehn Jahre später bereits von knapp 30% berichtet (Kessler et al. 2012). Die 12-Monatprävalenz dagegen liegt kontinuierlich um die 7–10% (Kessler et al 2003, 2012; Jacobi et al. 2014). Das Ersterkrankungsalter hat sich hin zu jüngeren Jahrgängen verschoben, die meisten Betroffenen erkranken bereits vor dem 31. Lebensjahr (Jacobi et al. 2004). Mehr als 300 Millionen Menschen leiden unter Depressionen und machen etwa 4,4% der Weltbevölkerung aus (World Health Organization 2017). In Deutschland liegen die Ein-Jahres-Prävalenzen ebenfalls bei etwa 10%, wobei in der Regel etwa doppelt bis zwei Drittel so viele Frauen im Vergleich zu Männern betroffen sind (Jacobi et al. 2014; Steinmann et al. 2012). In weniger als 20% der Fälle kann eine depressive Episode chronisch verlaufen, aber auch wenn es zu vollständigen Remissionen kommt, besteht oft ein erhebliches Rezidivrisiko. In mind. 50% aller Fälle kommt es nach einer ersten depressiven Episode zu weiteren Episoden, wobei das Rezidivrisiko mit jeder Episode ansteigt, nach der dritten Episode liegt es bereits bei 90% (Belsher und Costello 1988). Depressionen weisen außerdem sehr hohe Komorbiditätsraten auf, insbesondere mit anderen psychischen Störungen, so zeigen um die 60% mind. eine weitere und knapp 25% sogar drei oder mehr komorbide Störungen (Jacobi et al. 2014), häufig finden sich darunter Angststörungen (50%), aber auch substanzbezogene Störungen (30%), somatoforme Störungen oder Persönlichkeitsstörungen. Es zeigen sich aber auch Komorbiditäten mit verschiedensten körperlichen Erkrankungen, u. a. Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes (für einen Überblick siehe DGPPN et al. 2015, S. 18–19). Die gute Nachricht ist, dass die Dauer einer depressiven Episode durch eine Behandlung um etwa die Hälfte auf im Mittel 16 Wochen verkürzt werden kann (DGPPN et al. 2015). Die schlechte Nachricht ist, dass nur 42% aller Betroffenen eine adäquate Behandlung erhalten (Kessler et al. 2003; DGPPN et al. 2015).
1.1 Diagnose der Depression
Depressive Episoden sind gekennzeichnet von Traurigkeit und Interessensverlust (als Hauptkriterien), fast täglich anhaltend über mindestens zwei Wochen. Hinzu kommen Symptome wie Selbstwertverlust oder Schuldgefühle, Schlafstörungen und Appetitstörungen, Erschöpfung, Suizidgedanken, schlechte Konzentration, aber auch Antriebsstörungen. Die Symptome führen zu Beeinträchtigungen bei Arbeits- und Schulleistungen und in anderen Bereichen. Unterschieden wird zwischen einzelnen oder rezidivierenden Episoden, klassifiziert außerdem nach aktuellem Schweregrad. Je nach aktueller Ausprägung, früheren Episoden sowie Vorerfahrungen bzw. Präferenzen für eine bestimmte Behandlung, haben verschiedene Gesellschaften und Gremien in der nationalen Versorgungsleitlinie anhand der empirischen Evidenz verschiedene Behandlungsempfehlungen abgeleitet (DGPPN et al. 2015). Bezüglich der Diagnosestellung ist anzumerken, dass sich die Kriterien für eine depressive Episode im Großen und Ganzen auch bei den neuesten Entwicklungen der Klassifikationssysteme (z. B. DSM-5 und ICD-11) nicht verändert haben, auch wenn jede Depression anders aussehen kann, z. B. durch eine unterschiedliche Kombination der verschiedenen Symptome. Gerade das heterogene Bild der Depressionen (melancholischer Typus, atypische oder agitierte Form der Depression, Schlafstörungen, die im Vordergrund stehen oder auch chronische Verläufe etc.) macht es schwer, eine geeignete standardisierte Behandlung zu finden, welche die verschiedenen Symptombilder adäquat adressieren kann.
1.2 Leitlinienempfehlungen für die Behandlung
Die nationale S3-Versorgungsleitlinie zur unipolaren Depression (DGPPN et al. 2009, 2015) begründet ihre Empfehlungen zur Diagnosestellung und Behandlung durch die aktuelle Evidenz, die zudem im Expertenkonsensus erarbeitet und formuliert wurden. Vorrang wird dabei Übersichtsarbeiten sowie den Ergebnissen randomisiert-kontrollierter klinischer Studien (Randomized-controlled trials = RCTs) als wissenschaftlicher Grundlage für die wichtigsten Evidenzen und abgeleiteten Empfehlungen gegeben. Die aktuellste Leitlinienversion, Reports und Bearbeitungen sind unter https://www.leitlinien.de/nvl/abzurufen.
Die nationale Versorgungsleitlinie zur Depression ist eine der umfangreichsten Leitlinien und eine der wenigen, die sich speziell auf die in Deutschland am weitesten verbreitete psychische Erkrankung bezieht. Entsprechend detailliert werden hier die verschiedenen Behandlungsansätze vorgestellt, Hintergründe über das nationale Versorgungssystem gegeben und entsprechende Empfehlungen für die einzelnen Behandlungsansätze anhand deren Evidenz abgeleitet. Die Leitlinie empfiehlt z. B. bei leichten bis mittelschweren depressiven Episoden die Anwendung einer Psychotherapie. Dabei gelten die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) sowie die Interpersonelle Psychotherapie (IPT) als evidenzbasiert mit den meisten Studien und dem höchsten bzw. eindeutigsten Empfehlungsgrad. Insbesondere für die KVT liegen inzwischen die meisten Studien und Belege in Form von RCTs, aber auch diversen Meta-Analysen und anderen Überblicksartikeln vor (DGPPN et al. 2009, 2015). In der aktuellen Version der Leitlinie (DGPPN et al. 2015) werden Evidenzen für die Richtlinienverfahren, die vom Versorgungssystem abgedeckt werden (KVT, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Analytische Psychotherapie), aber auch für Systemische Therapie und Gesprächspsychotherapie dargestellt. In Deutschland ist die IPT jedoch weniger verbreitet und gehört nicht zu den Richtlinienverfahren, die von den Krankenkassen übernommen werden. Bei schweren Episoden wird explizit eine Kombinationsbehandlung von Antidepressiva und Psychotherapie empfohlen. Bei mittelschweren Episoden ist insbesondere die Vorgeschichte entscheidend für die Entscheidung zwischen einer Monotherapie mit Pharmapharmaka oder Psychotherapie. Die vorliegende Literatur belegt, dass bei leichten und mittelgradigen (teilweise auch bei schweren) Formen der depressiven Störung psychotherapeutische Verfahren kurzfristig ähnlich wirksam sind wie medikamentöse Therapien und langfristig sogar höhere Wirksamkeit insbesondere auf die Verhinderung von Rückfällen aufweisen (z. B. Hollon et al. 2005, DGPPN et al. 2015). Ein anderer Überblicksartikel konnte zeigen, dass psychologische Interventionen (KVT, Verhaltensaktivierung, aber auch IPT) gegenüber der üblichen Standardbehandlung, aber auch gegenüber einer strukturierten Pharmakotherapie überlegen waren (Cuijpers et al. 2011).
1.3 Psychotherapie bei Depression
Insgesamt zeigte sich im überwiegenden Teil der für die Leitlinie betrachteten Studien und Überblicksartikel entweder eine Überlegenheit oder Äquivalenz der Wirksamkeit von KVT im Vergleich zu anderen Behandlungsbedingungen. Einige der Meta-Analysen zeigten, dass die KVT in der Akutbehandlung gegenüber Warteliste, Pharmakotherapie und anderen Psychotherapieansätzen (IPT, psychodynamische Therapie, supportive Therapie oder Entspannungsverfahren) in der Reduktion depressiver Symptome im Mittel nach 16 Wochen überlegen war (z. B. Gloaguen et al. 1998; Gaffan et al. 1995). Andere hingegen fanden keine Unterschiede in der Wirksamkeit der KVT und der psychodynamischen Therapie oder anderer Ansätze (Shinohara et al. 2013; Mazzucchelli et al. 2009). Für die Leitlinie wurden nur zwei Meta-Analysen zitiert, die sich explizit mit der Wirksamkeit von psychodynamischen Kurzpsychotherapien befassten und eine äquivalente Wirksamkeit wie für die KVT oder IPT fanden (Crits-Christoh et al. 1992; Leichsenring 2001). Des Weiteren wurden auch systematisch verschiedene Psychotherapieformen in ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen, wie z. B. die KVT und die Psychodynamische Therapie, wobei sich eine äquivalente Wirksamkeit der psychodynamischen Therapie gegenüber der KVT zeigte, was als weitere Evidenz für die Wirksamkeit der Psychotherapie allgemein gewertet wurde (z. B. Driessen et al. 2014).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hypnotherapie bei Depressionen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hypnotherapie bei Depressionen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hypnotherapie bei Depressionen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.