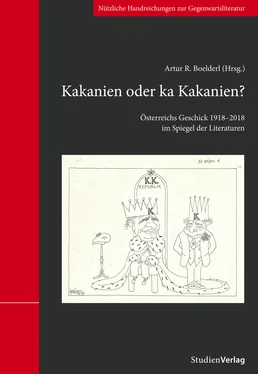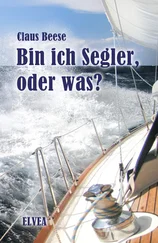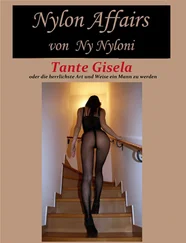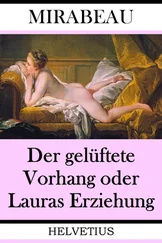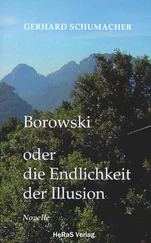Im Café Residenz gegenüber dem Eingang zu den Schauräumen im Schloss Schönbrunn. Touristen aus aller Welt laben sich hier an Sachertorte und Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und Guglhupf. Die Monarchie hat in diesem Kontext etwas Romantisches und Glamouröses, etwas Kultiviertes und Nostalgisches, vielleicht auch etwas Pickiges an sich. An der Wand hängt ein Bild mit zwei Porträts: Kaiser Franz Joseph und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Darunter steht: „In Treue vereint“.
Es handelt sich bei dieser Darstellung um ein Mittel der Kriegspropaganda, tausendfach reproduziert und in viele Haushalte verteilt, Kriegsmerchandising sozusagen. Auch in meinem Elternhaus gibt es ein mit demselben Bild verziertes kleines Deko-Kännchen, von dem in meiner Kindheit niemand mehr genau sagen konnte, was es bedeutete oder wie es in die Familie gekommen war. So wie wahrscheinlich kaum einer der Touristen an grauenvolle Kriegshetzerei denkt, wenn er unter den Augen der beiden Kaiser seinen Alt-Wiener Suppentopf löffelt.
Es gibt dennoch etwas, das mir an der k.u.k. Vergangenheit seit jeher gefiel: die Vorstellung, dass wir Österreicher „viele Völker sind“. Vielleicht lag es an meiner Geschichtslehrerin (der ich in dieser Stunde zuhörte), die die Monarchie als eine Art Prä-EU deutete und es nur für folgerichtig hielt, dass Otto Habsburg Abgeordneter im Europaparlament war. 1979 initiierte er eine Resolution, die durch einen leeren Stuhl im Europäischen Parlament auf die Völker hinter dem Eisernen Vorhang aufmerksam machte – und nahm dadurch die spätere Osterweiterung vorweg.
Vielleicht aber lag es auch an Otto Friedländers Buch „Letzter Glanz der Märchenstadt – Wien um 1900“, das mir das alte Wien als eine Weltstadt beschrieb, in deren Straßen eine bunte Vielfalt an Menschen zu sehen war: türkische Hausierer mit weichen Opanken an den Füßen und dem Fez auf dem Kopf, huzulische Hirten in gesticktem, weißem Pelz, polnische Juden mit langem Bart und in mit Zobel verbrämten Seidenkaftanen, armenische Mechitaristen, hannakische Ammen und ungarische Garden mit Pantherfellen und Reiherfedern. Wie absurd sind doch Ortstaferlstürmereien in einem Land, dessen Monarch einst seine Proklamationen mit „An Meine Getreuen Völker“ einleitete und in elf verschiedenen Sprachen veröffentlichen ließ.
In Heimito von Doderers Roman „Grenzwald“ wird eine Gruppe von österreichischen Offizieren im Laufe des Ersten Weltkriegs aufgefordert, sich doch einer Nation zuzuordnen. Da sie deutsch, tschechisch und ungarisch sprechen, kommen sie zu dem Schluss, eben einfach „Wiener“ zu sein.
Selbstverständlich war die Monarchie ein Herrschaftsgefüge, das seine Ansprüche zur Not auch mit Waffengewalt durchsetzte. Die Loyalität gegenüber dem Kaiser war unterschiedlich verteilt: Bei den galizischen Juden war sie hoch, bei den Tschechen tendierte sie gegen null. Und manchmal erlebt man auch viele Jahrzehnte nach dem Untergang des Habsburgerreiches so seine Überraschungen. 2007 durfte ich mit einer Delegation zum Zwecke des Kulturaustausches nach Sarajevo fahren. Eines Abends kam ich mit einem bosnischen Schriftstellerkollegen ins Gespräch und sagte irgendetwas Negatives über die habsburgische Okkupationspolitik in Bosnien-Herzegowina. Zu meiner Überraschung geriet er völlig in Rage und erklärte mir, ich hätte keine Ahnung von Geschichte: Die Habsburger seien mit Abstand das Beste gewesen, was diesem Land je passiert sei! Sie hätten Schulen, Spitäler, Theater gebaut, ein funktionierendes Eisenbahnnetz installiert und Sarajevo eine Stadtkanalisation geschenkt.
Ich versuchte, etwas einzuwenden, brachte die blutige Niederschlagung der Aufstände nach dem Berliner Kongress vor, der Österreich-Ungarn die Verwaltung der Region übertragen hatte, die Annexionskrise 1908 und nicht zuletzt den Umstand, dass der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand wohl nicht wegen extremer Beliebtheit der Habsburger in Sarajevo ermordet worden war – nun, wir hatten wohl beide Recht, so ist das nun mal mit der Geschichte.
Am Vormittag hatten wir jene Stelle nächst des Miljacka-Flusses besichtigt, wo der bosnische Serbe Gavrilo Princip mit seinen Schüssen den Anstoß zum Ersten Weltkrieg gegeben hatte. Unter den Kommunisten hatte er als Held gegolten, seine Fußspuren waren in den Gehsteig eingelassen gewesen, sodass man genau nachvollziehen konnte, wo er gestanden hatte, als er den Thronfolger traf. Nunmehr fanden wir die triumphalen Fußspuren entfernt: Im Bosnienkrieg galt Princip bosnischen Muslimen und Kroaten als serbischer Held, weshalb man ihm keine Bewunderung mehr zollen mochte. 2004 wurde an der Attentatsstelle eine Plakette angebracht, die nur mehr die nüchternen Fakten festhält. Auch die Geschichte hat eine Geschichte.
Wenn Österreicher die Grenze zu einem der ehemaligen Kronländer der Monarchie überqueren, kommt es vor, dass sie mit wehmütig-ironischer Geste sagen: „All das hat einmal zu uns gehört!“ In der Europäischen Union können wir wieder zusammengehören, diesmal auf freiwilliger Basis.
Aus: Bettina Balàka (2018): Kaiser, Krieger, Heldinnen. Exkursionen in die Gegenwart der Vergangenheit. Innsbruck: Haymon, 115–121. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags.
Pavol Rankov
Ich war Alexejs Mutter und die Last der Betreuung hatte ich zu tragen. So war es von der Natur vorbestimmt. Ich versuchte, mich während des Tagesdienstes ab und zu ein wenig zu verkriechen, um die Augen zu schließen und etwas zu schlafen, doch es gelang mir nur ganz selten. Als ich mich einmal hinter der Baracke kurz ins Gras duckte, kam gleich die Gefangene angerannt, die mit mir zusammenarbeitete, und rief, die Wachen würden schon nach mir suchen, weil Alexej wieder weine. Auch nachts musste ich auf der Hut sein und Alexej sofort beim ersten Greinen an die Brust legen, denn ich hatte Angst vor Liedchen. Sie hatte schon mehrmals gedroht, das Kind zu erwürgen, wenn es sie noch einmal aufwecke. Ich bat sie, wieder auf ihre alte Pritsche am anderen Ende der Baracke zu ziehen, wo das Weinen sie nicht so stören würde, doch das machte sie noch wütender. Doch auch die anderen murrten. Die Hündinnen zwangen eine der Frauen, Irina beim Appell zu bitten, das Kind aus der Baracke heraus zu schaffen. Irina schrie sie daraufhin an, sie solle sich um ihren Kram kümmern. Dass die Mutter mit dem Kind im sechsten Lagpunkt sei, habe die Lagerleitung festgelegt und über einen Befehl werde nicht diskutiert.
In der darauffolgenden Nacht wachte ich von einem Schlag ins Gesicht auf. Liedchen stand über mir und rief, es sei die letzte Warnung. Alexej weinte wieder, doch ich war so müde, dass ich es nicht mitbekommen hatte. Liedchen packte mich an der Kehle und begann, mich zu würgen. Sie schrie, sie werde das Kind umbringen, wenn es sie noch einmal wecke. Dann zog sie mich hoch und stieß mich in Richtung Wiege, ich solle mich gefälligst um den Sohn kümmern. Doch ihre Wut ließ nicht nach. Sie ging in der Baracke auf und ab, trat gegen die Pritschen und versetzte allen Gefangenen, an denen sie vorbeikam, einen Hieb. Es machte sie rasend, dass einige noch immer schliefen, während sie von dem Weinen längst aufgewacht war.
Am nächsten Abend legte ich Alexej gar nicht erst in die armselige Wiege, sondern ließ ihn bei mir, damit ich ihn sofort stillen konnte. Die Sirene, die den Abendappell ankündete, klang in meinen Ohren wie eine Sterbeglocke. Natürlich wagte ich nicht, ein Nickerchen zu machen. Ich hockte auf der Pritsche und versuchte zu beten, doch in meinem Kopf wirbelten Bilder aus der Vergangenheit herum. Mal sah ich vor mir den Rücken von Alexejs Vater, als er aus dem Fenster meines Zimmers sprang, mal Mutter, wie sie auf dem Vorplatz stand und dem Wagen hinterher sah, mit dem die sowjetischen Soldaten mich wegbrachten. Aus meinem Gedächtnis stieg auch das entstellte Gesicht der toten Kaisa auf und kurz darauf der stechende Blick der Wölfin, die sich mir im nächtlichen Wald in den Weg gestellt hatte.
Читать дальше