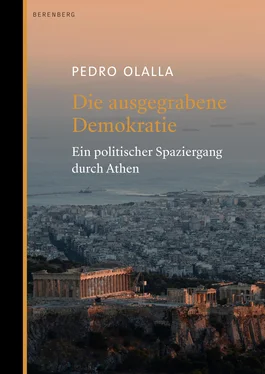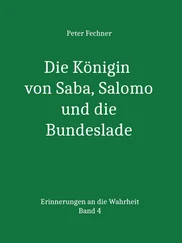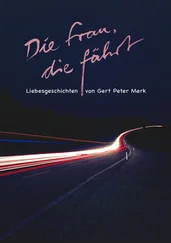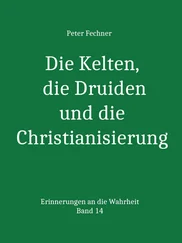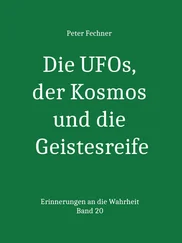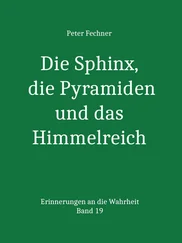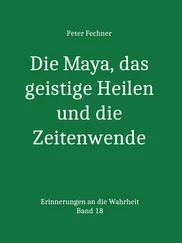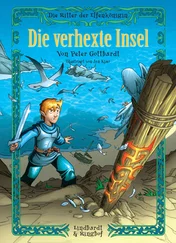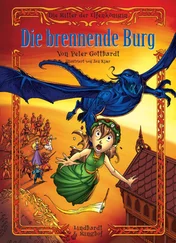Phratrios und Patroos: so hießen die olympischen Götter, wenn ihre Rolle als Beschützer der Phratrien betont werden sollte, jener jahrhundertealten Bruderschaften, die aus untereinander verwandten Familienclans bestanden. Unter diesem Beinamen wurde Apollon in besagtem Tempel als Stammvater der Ionier verehrt, denn wie es hieß, hatte er dort oben, in einer der Höhlen des heiligen Felsens, Ion gezeugt, den Stammvater der Athener. Daher feierte die Stadt nach dem Äquinoktium im Herbst, im Monat Pyanopsion, die fröhlichen Tage der Apaturia: das panhellenische Fest des Ioniertums. Die Feier wurde damit eröffnet, dass alle Phratrien ein abendliches Festmahl der Verbrüderung abhielten; am nächsten Tag brachte man den Schutzgottheiten in den Tempeln ein Opfer; und am dritten Tag wurden dem Clan alle Kinder vorgestellt, die im Laufe des Jahres geboren worden waren, und neue Mitglieder zugelassen, wenn die Phratrie sich darauf einigte, mit ihnen das Opferfleisch zu teilen.
Gegen diese Phratrien und andere althergebrachte Clanstrukturen richteten sich im Sommer des Jahres 508 vor Christus die mutige Sozialreform von Kleisthenes, den viele für den wahren Vater der Demokratie halten. Phratrien und Clans waren durch und durch klassengebundene Strukturen, über die der Blutadel traditionell seine Macht ausübte und sicherte. Schon Solon hatte gegen diese Strukturen angekämpft, indem er das politische Leben um vier Klassen herum organisierte, die sich eben nicht auf Abstammung gründeten; indem er allerdings Besitz zum Kriterium dafür erhob, wie groß die Teilhabe war, blieb Macht weiterhin sehr stark an Abstammung geknüpft und damit an Klasseninteressen. Kleisthenes hingegen begriff, obwohl er selbst dem Adelsgeschlecht der Alkmaioniden entstammte, dass er auf Solons Weg zu wahrer politischer Gleichheit nur dann vorankäme, wenn er endgültig die Vorherrschaft des Blutes brach.
Als das Volk Kleisthenes das Vertrauen schenkte, nahm dieser eine tiefgreifende Strukturreform in Angriff, deren Grundidee darin bestand, in allen Institutionen die gesellschaftlichen Schichten möglichst gut zu durchmischen, damit nicht mehr nur Gruppeninteressen vertreten wurden, sondern das Gemeinwohl im Vordergrund stand. Seine Strategie war ein Geniestreich. Er nahm die einhundertneununddreißig Demos, in die die Region Attika aufgeteilt war, und teilte sie neu auf in dreißig Gruppen, sogenannte Trittyen, nach rein geographischen Kriterien: zehn Stadt-Trittyen, zehn Binnenland-Trittyen und zehn Küsten-Trittyen. Dann ließ er per Los in jeder Region eine Trittye bestimmen und formte daraus zehn neue Phylen (Stämme), damit sich eine möglichst ausgewogene Mischung aus unterschiedlicher geographischer Herkunft, unterschiedlichem Familiengeschlecht, unterschiedlichen Vermögensverhältnissen und unterschiedlichen Interessen ergab. Um Diskriminierung aufgrund von Abstammung zu verhindern, sollte jeder nur noch seinen Eigennamen, den seines Vaters und den seiner Trittye tragen: Inachos, Sohn des Satyros, Heracleota. Apollonides, Sohn des Menodoros, Deradiota …
Diese zehn neuen Phylen (Stämme) ersetzten die vier althergebrachten, die sich von den von Ion gezeugten Söhnen herleiteten: Geleon, Aegikoreus, Argades und Hoples. Des Weiteren ersetzten sie die vier von Solon eingeführten timokratischen Klassen: Vermögende, Reiter, Bauern und Pächter. Diese neuen Einheiten bildeten auch die Grundlage für die Wahl der Archonten, Prytanen, Mitglieder des Rats, Mitglieder der Volksgerichte, der öffentlichen Schatzmeister und Beamten jeglicher Art. Sogar die Organisatoren der Panathenäen, die Musiker und die Tänzer, die an den verschiedenen Spielen teilnahmen, sollten über das System der neuen Phylen ausgewählt werden.
Kleisthenes respektierte die heilige Funktion der Phratrien, aber er schuf mit seiner Reform eine neue Gesellschaft, die zu der Hoffnung Anlass gab, dass sich so etwas wie politische Gleichheit tatsächlich verwirklichen ließ. Seine Reform war ein Triumph der Gleichheit über die Identität, der Gleichheit der Rechte und Pflichten über die Identität von Blut und Stamm. Identität war etwas, das vererbt wurde, also willkürlich war, festgelegt und häufig ausgrenzend; Gleichheit hingegen war etwas, das erkämpft werden musste, und daher die einzig mögliche Grundlage für die Idee der Staatsbürgerschaft.
VOR DEM DENKMAL DER EPONYMEN HEROEN
Einige Meter südlich des Apollontempels befindet sich eine Reihe von Kalksteinen, in die einmal die Pfeiler einer Einfriedung eingelassen waren. Heute steht davon nur noch ein kleiner Abschnitt, doch einst umsäumte sie das Denkmal der Eponymen Heroen, errichtet zu Ehren jenes Gleichheitsgedankens der Demokratie. Die Reste, die noch zu sehen sind, stammen nicht aus der fernen Zeit des Kleisthenes, sondern datieren zweihundert Jahre später. Damals standen hier zehn lebensgroße Bronzestatuen. Sie stellten die antiken Helden dar, die den zehn Stämmen Athens den Namen gaben. Sicherlich waren diese Helden schon zuvor mit einem Denkmal geehrt worden, vermutlich etwas weiter südlich, an der Grenze zur Agora.
Als Kleisthenes seine Reformen in Angriff nahm, ließ er zum Orakel von Delphi ein Verzeichnis schicken, in dem die Namen von hundert Helden früherer Zeiten eingetragen waren. Apollon selbst wählte über Pythia die zehn Helden aus, die den neuen Stämmen ihren Namen geben sollten: Hippothontis, Antiochis, Aiantis, Leontis, Erechtis, Aigeis, Oineis, Akamantis, Kekropis und Pandionis. Dort standen sie, auf diesen Steinplatten, die noch immer die Spuren ihrer Füße aufweisen. Zu beiden Seiten des länglichen Podiums, auf dem sie sich reihten, ragten auch die bronzenen Dreizacke zu Ehren des Orakels hervor. Und auf dem Podium, zu Füßen der Eponymen Heroen, war festgehalten, wie sehr die Stadt all jene schätzte, die ihr dienten und sie mit ihren Taten ehrten. An gleicher Stelle wurden die Bürger über öffentliche Angelegenheiten informiert, wurden Aufrufe für die Geschworenengerichte angekündigt und einmal im Jahr, auf Bronzetafeln, die Einberufungslisten der Epheben ausgehängt. Und am wichtigsten: Einige Tage vor jeder Volksversammlung wurden auf mit Kalk geweißelten Tafeln die Gesetzesvorhaben vorgestellt, damit jeder Bürger über sie nachdenken konnte, bevor er das Wort ergriff und seine Stimme abgab.
Dieser Komplex mit seinen Statuen und Inschriften ist das bestmögliche Denkmal, um das Andenken an Kleisthenes in Ehren zu halten, um seine Fortschritte hin zu echter politischer Gleichheit zu würdigen, in einer Gesellschaft, in der bis zu zwei Drittel der Bürger nur über dürftige Mittel und begrenzte Teilhabe am politischen Leben verfügten.
Wie aber konnte ein Einzelner eine Reform durchsetzen, die die obere Klasse ihrer Privilegien beraubte und an den Grundfesten der Gesellschaft rüttelte? Es waren stürmische Zeiten damals. Auf Solons Eunomia war die populistische Tyrannis des Peisistratos gefolgt, und auf diese die noch viel despotischere seiner Nachfolger. Im Sommer des Jahres 508 vor Christus, angesichts der Gefahr, dass der Archon Isagoras und seine Anhänger eine autoritäre Oligarchie errichten könnten, beschloss Kleisthenes, sich auf unbekanntes Terrain vorzuwagen: Er ergriff auf der Pnyx das Wort und schlug tiefgreifende, nie dagewesene Reformen vor, die die Macht in vollem Umfang auf die Gemeinschaft aller Vollbürger übertragen sollte. Isagoras’ Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Er schloss einen Pakt mit König Kleomenes von Sparta – dem er freundschaftlich verbunden war –, woraufhin dieser mit einem Teil seines Heeres in Athen einmarschierte und Isagoras an die Spitze einer oligarchischen Regierung setzte, deren dreihundert Ratsmitglieder ein offenes Ohr für die Interessen Spartas hatten. Kleisthenes flüchtete aus der Stadt, und siebenhundert Familien, die Isagoras auf eine schwarze Liste setzte, wurden in die Verbannung geschickt. Der Oligarch versuchte sofort, den von Solon geschaffenen Rat der Vierhundert aufzulösen. Glücklicherweise begriffen die meisten Athener, was auf dem Spiel stand, und hatten den Mut, sich dagegen zu erheben. Sie belagerten die Akropolis, wo sich Isagoras, seine Anhänger und die spartanischen Helfershelfer zwei Tage lang verschanzt hielten. Am dritten Tag wurde ein Waffenstillstand vereinbart, und Isagoras, die Spartaner und ihr König durften frei abziehen. Die Verbannten kehrten nach Hause zurück, und das Volk, das die Macht an sich gerissen hatte, ernannte Kleisthenes zu seinem Anführer und Beschützer.
Читать дальше