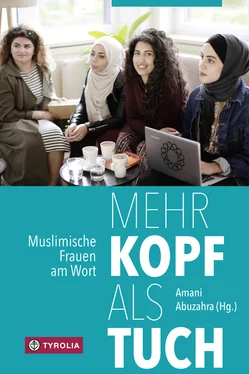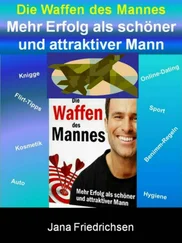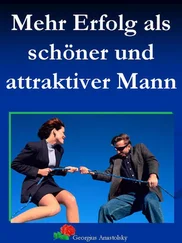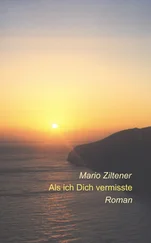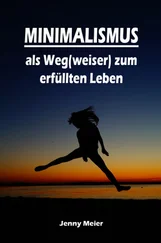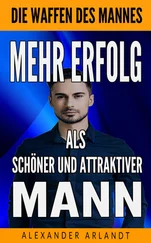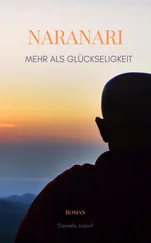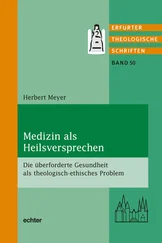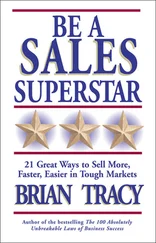Von Ost nach West
in 25 Minuten.
Von Station zu Station
ein Stück Integration,
mit Komplikation
als Sensation
für Perfektion;
aber sicher ist
die unbekannte Endstation.
1 Terkessidis, Mark (2010): Interkultur. Berlin, 6. Aufl., S. 7.
2 Beck-Gernsheim, Elisabeth (2007): Wir und die Anderen. Kopftuch, Zwangsheirat und andere Missverständnisse, Frankfurt a. Main, S. 79.
3 Maalouf, Amin (2000): Mörderische Identitäten. Frankfurt am Main, S. 27f.
4 Mecheril, Paul (Hg.) u. a. (2010): Handbuch Migrationspädagogik. Weinheim und Basel, S. 81.
5 Humboldt, Wilhelm von (2007): Werke in fünf Bänden (1960–81), Bd. V, hg. von Andreas Flitner und Klaus Giel. Darmstadt, S. 111.
Mein anderes Europa
Amani Abuzahra
Ich bin etwas aufgeregt. Es ist eine der ersten Lesungen meines Buches „Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft“ . Der Saal ist gut gefüllt mit einer bunt gemischten Zuhörerschaft. Ich werde begrüßt, vorgestellt und halte anschließend meine Lesung. Die Zeit vergeht wie im Flug. Als ich fertig bin, habe ich ein gutes Gefühl; die wichtigsten Stellen habe ich klar artikuliert und bin nun gespannt auf die Reaktionen des Publikums.
Es meldet sich ein Mann mittleren Alters, der zunächst weit ausholt, über sich und seinen wissenschaftlichen Werdegang erzählt, um dann seine Frage zu formulieren. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme in unterschiedlichen Kontexten, ob in einem Dialog im Alltag, im Rahmen einer Podiumsdiskussion oder unter einem meiner Postings auf Social Media, ja sogar in einem Workshop für DoktorandInnen, als ich meinen Forschungsschwerpunkt präsentierte. Die Frage lässt viele nicht los. Sie ist eine immer wiederkehrende. Aber für mich keine irritierende. Sie zeigt mir vielmehr die Irritation meines Gegenübers. Die Frage verdeutlicht, was ich bei meinen GesprächspartnerInnen oder manchen im Publikum auslöse.
Zurück zur Lesung: Es handelt sich also um die erste Rückmeldung, die ich nach meinen Ausführungen von dem Zuhörer erhalte: „Warum kritisieren Sie nicht Ihre eigene Gesellschaft? Warum bemängeln Sie nicht zuerst Ihre Gemeinschaft, bevor Sie uns kritisieren?“ Diese Fragen sind eigentlich keine Fragen, vielmehr ein Kommentar. Es stört ihn, dass ich in meinem Buch unter anderem Europa und Österreich kritisiere – die europäische Gesellschaft. Ob das nicht authentischer wäre, wenn ich meine eigene kritisiere, will er wissen?
Ich erwidere fragend, was er denn unter „meine eigene“ subsumiere? Und frage mich weiter: Ist wohl eine Gesellschaft gemeint, die sich jenseits der Landesgrenzen Europas verorten lässt – vermutlich gar ein sogenanntes „muslimisches“ Land (wie auch immer man das definieren mag)? Oder etwa gleich „der Islam“ oder „die muslimische Gemeinschaft“, wenn er „meine Gemeinschaft“ anspricht? Oder zielt er mit der Frage nach „meiner Gemeinschaft“ auf die der PhilosophInnen ab, deren ich mich durch mein Studium und Forschen zugehörig fühle?
Ich bin erstaunt. Eigentlich irritiert mich ja der Duktus dieser Fragen nicht (mehr). Und doch bin ich überrascht, da ich mir dieses Denken in „Wir“ versus „Ihr“ in diesem Rahmen nicht erwartet hätte. Naiv, ich weiß.
Durch seine Fragen zieht er eine Trennlinie: „Wir“ versus „Ihr“. Sollte ich mich demnach nicht viel mehr in Demut üben und dankbar sein, in Europa zu leben statt Kritik auszuüben, so der Grundton der darauffolgenden Diskussion.
Und hier kommt der springende Punkt: Das ist mein Europa. Mein Österreich. Meine Gemeinschaft. Und insofern erachte ich meine vorgelegte Kritik in diversen Formen auch immer als eine Selbstkritik. Indem ich von diesem, meinem Recht Gebrauch mache, widerspreche ich auch dieser Unterteilung, die den Anschein erwecken soll, es stünden sich zwei in sich geschlossene Pole gegenüber: „die Muslimin“ versus „die Europäerin“, oder „der Islam“ versus „der Westen“. MuslimInnen erachten sich als vitaler Bestandteil Europas: eingesessen oder zugewandert, verbunden aufgrund der Tatsache, dass hier der Geburtsort liegt oder sie hier sozialisiert sind. Für viele ist Europa ein Ort, an dem sie ihre Zukunft sehen.
MuslimInnen nehmen insofern des Öfteren eine Rolle der GrenzgängerInnen ein. Denn obwohl sie sich verbunden fühlen, sich in der Mitte der Gesellschaft wahrnehmen, kann es durchaus sein, dass sie in der medialen und politischen Debatte am Rand der Gesellschaft verortet werden. An der Grenze sind Beobachtungen aus einer gewissen Distanz möglich, die bestimmte Missstände oder Entwicklungen sichtbar(er) machen. Die Verortung an der Grenze birgt also eine Chance.
In diesem Sinne möchte ich einige Anmerkungen zu Europa aus meiner Perspektive machen: aus der Mitte der Gesellschaft, aber auch vom Rand aufgrund der Erfahrungen der Fremdverortung.
Europa steht am Scheideweg. Zwischen Rassismus und Hoffnung. Zwischen Extremismus und Zuversicht. Zwischen Populismus und Frieden.
Der Philosoph Jacques Derrida nimmt als Pendler zwischen Algerien und Frankreich sowohl eine Innen- als auch Außenperspektive auf Europa ein. Der Grenzgänger beschreibt in „Das andere Kap“ ein Europa, das sich in einem Zustand zwischen Hoffnung und Bedrohung befindet. Nämlich Hoffnung darauf, dass eine Zeit kommt, in der Ausgrenzung im Namen der Religion oder Nationalität als überholt gilt, und zugleich Furcht davor, dass Fanatismus jeglicher Couleur überhandnimmt. Die Sorge steigt, dass Nationalismus am Erstarken ist und eine Politik, die exkludiert. Zugleich gibt es Gegenstimmen und Menschen, die für ein Miteinander eintreten. Welchen Lauf das Friedensprojekt Europa nehmen wird, ist aktuell ungewiss.
Der Politikwissenschaftler Dominique Moïsi zeichnet in seinem Buch „Kampf der Emotionen. Wie Kulturen der Angst, Demütigung und Hoffnung die Weltpolitik bestimmen“ eine Landkarte der Emotionen. Europa sei geprägt von Angst. Dies lässt sich vor allem an der Zunahme der Sicherheitskontrollen und Beschneidung der individuellen Freiheit messen, so Moïsi. Die gefühlte Unsicherheit (gefühlt deswegen, weil im Vergleich zu anderen Ländern europäische Länder als die sichersten und friedlichsten gelten, laut dem Global Peace Index 2016, erhoben vom Institute for Economics and Peace, IEP) bewirkt, dass die Menschen nach einfachen Antworten sowie Halt und Orientierung suchen. Diese werden mitunter von rechtspopulistischen Parteien geboten, mit simplen (Ant-)Worten in einer zunehmend komplexer werdenden Welt, die nicht selten auf Europas Identität abzielen.
Ein großes und vor allem umkämpftes Thema ist die Zugehörigkeit zu Europa: Wem „gehört“ Europa, wer wird als zugehörig erachtet, wer als fremd und wer bleibt außen vor? Die europäische Identität wird zur Verhandlungssache. Verschiedene AkteurInnen verhandeln, wofür Europa steht. Die Fähigkeit zur Etablierung eines bestimmten Europabildes im historischen und gegenwärtigen Kontext ist eine Machtfrage. Dieses fortzuschreiben ist ebenso eine Frage, wessen Geschichte erzählt und wem zugehört wird. Welche Perspektive geht dabei verloren oder wird unterdrückt und welche verstärkt?
Die feministische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie warnt in ihrem TedX-Talk „Die Gefahr der einzigen Geschichte“ mit folgenden Worten: „Macht ist die Fähigkeit, die Geschichte einer anderen Person nicht nur zu erzählen, sondern sie zur maßgeblichen Geschichte dieser Person zu machen.“
Die Auseinandersetzung mit dem Werden und der Formierung Europas und das Verhältnis zum „Anderen“ kann sich am Beispiel der Konstruktion des „Orients“ und der Reduzierung und steten Wiederholung einer Geschichte offenbaren. Die Theorie der postkolonialen Studien besagt, dass die Bildung Europas ohne Konstruktion des „Anderen“ nicht denkbar wäre. (Dhawan/Said).
Читать дальше