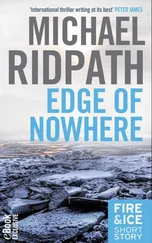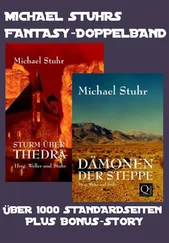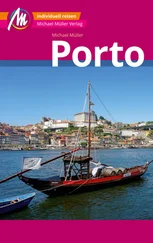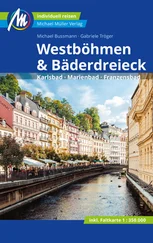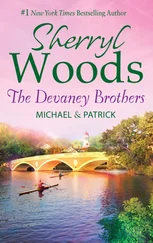Worin eigentlich seine Arbeit besteht, hat R. inzwischen verstanden. Er räumt Geschirr, Gläser, Flaschen von den Tischen. Aber er konnte für sich die Phantasie durchsetzen, er sei nicht das Faktotum, sondern der Chefkellner.
Eisenstadt. Das belegte Brot, garniert, im Schlosscafé besteht aus einer gebutterten Graubrotschnitte, die mehrere Wurstscheiben – eine Art Salami – bedecken. Auf den Wurstscheiben wiederum liegen, diese nicht gänzlich verhüllend, Käsescheiben – eine Art Emmentaler –, die, wie die Wurst, verschwitzt ausschauen.
Die Käsescheiben bedecken auf der einen Seite der Brotschnitte Gurkenscheiben, während die andere mit einem Streifen Mayonnaise aus der Tube verziert wurde, ein Streifen, der mit rotem Paprikapulver bestäubt ist.
Messer und Gabel wurden nicht serviert. Das Brot ist quer in Streifen geschnitten, die man einzeln mit der Hand aufnimmt, wobei die Mayonnaise auf die Papierserviette tropft, die unter dem Brot liegt, weshalb man sie hinterher nicht zum Abwischen der Finger verwenden kann.
Auf einer Treppe, die nur schlecht in das Haus Scheinerstraße 6 passt, steht Peter Herzberg. Ob R. mal kommen könne? In einem Zimmer, das ungefähr das ist, in welchem einst Jürgen Felz arbeitete und jetzt Klaus Kunkel sitzt, versammelt sich der Personalrat. Man wolle R. ausdrücklich, das hält eine Art Resolution fest, Unterstützung zusagen für die Schallplatte mit konkreter Poesie, die er produziert habe. Peter Herzberg hat es vorgelesen und schaut R. beifallheischend an. Wenig später befinden sich alle im Schwimmbad, trotz des kalten und regnerischen Wetters. Gisela Steinbacher, die Chefsekretärin, erklärt R. auf das handgreiflichste ihre Liebe, aber er wacht auf, bevor er sie verschmähen kann.
R. hat Brigitte Landes geheiratet – es war ein dringlicher Wunsch, der sich aber, als er erfüllt ist, als schlechterdings unrealisierbar erweist. Nicht nur, dass sie bei ihren Eltern leben, die sich andauernd im Zimmer aufhalten, diese Eltern erwarten außerdem von R. eine Erneuerung der christlichen Lyrik und finden das, was R. pflichtschuldigst hinschmiert, alles andere als befriedigend. Mit Kathrin redet R. ausführlich und sarkastisch über die unmögliche Situation, die ja umso unmöglicher ist, als Kathrin und R. weiterhin verheiratet sind.
Elisabeth Berres kommt zu Besuch – so kann man das nicht sagen. Auch wenn sie sich auf das Sofa setzt, geht es im Grunde nur um ein Vorbeieilen; wenn sie reden, geht es bloß um einen Wortabtausch en passant, wie bei einer Zufallsbegegnung auf der Straße. »Warum hast du überhaupt Slawistik studiert?«, fragt Kathrin. – »Kannst du nicht was Einfacheres fragen?«, antwortet Elisabeth Berres klagend.
Sie macht bald Ferien und fährt nach Polen. Sie werde Lebensmittel, Wurst- und Fleischkonserven, Käse mitnehmen, zur Selbstversorgung und für den Kleinhandel. R. kommt es so vor, als wäre das als verschärfte Reise in die Depression geplant, die schon unentwegt an ihr zehrt; ihm kam das Slawistik-Studium damals so vor, als sei es materialisierte Depression.
»Hier riecht es ja so durchdringend gut«, spottet Kathrin und schnüffelt in die Luft, »sind Sie das? Haben Sie sich parfümiert?« – »Wieso?«, fragt Goetz, gleichzeitig verlegen und stolz, »das mache ich doch immer.«
R. hat es nie bemerkt und bemerkt es auch jetzt nicht.
Bernd Dürr hat sich eine helle Sommerhose und eine Sonnenbrille gekauft – bislang trug er ausschließlich Bluejeans, und seine Sonnenbrille war eines dieser archaischen Modelle mit kreisrunden Gläsern im Drahtgestell. »Das Ende der Jeans-Periode.«
Vor allem habe ihn irritiert, dass, wenn er mit Gabi Dürr ein Lokal betritt, regelmäßig alle sie beaugenscheinigen, während man ihn übersieht. Als er jetzt mit der neuen Sonnenbrille durch die Innenstadt spazierte, fand er freilich trotzdem bei niemandem Beachtung.
Der Hund taucht. »Der Hund taucht ja«, sagt die ältere Dame, »der geht ja mit dem Kopf unter Wasser.« Der Hund taucht weiterhin: nach der sandgefüllten Plastikflasche, die Kathrin immer wieder für ihn in die Isar wirft.
»Das habe ich noch nie gesehen«, sagt die ältere Dame, »schadet das denn den Ohren nicht?« – »Die werden sowieso nass«, sagt Kathrin und wirft die Plastikflasche neuerlich ins Wasser, woraufhin der Hund wiederum taucht.
»Erstaunlich«, sagt die ältere Dame. »Hat er noch keine Ohrenentzündung gehabt?« – »Nein«, antwortet R. kurz, verärgert. Warum? »Doch«, hätte er antworten sollen, »leider schon öfter«, und dann hätte sie die ältere Dame darüber aufgeklärt, dass das vom Tauchen komme. Sie hätte sie darüber belehrt, dass sie den Hund nicht zum Tauchen anreizen sollten mit der sandgefüllten Plastikflasche – dann hätten sie auch keine Probleme mit seinen Ohren.
Landshut. Im Gasthaus Zur goldenen Sonne fangen an einem Stammtisch plötzlich zwei Männer zu singen an. Mit Stimmen, die nicht ungeübt klingen, insbesondere die des einen, fetteren, der eine Brille trägt und eine gebackene Frisur.
Was singen sie (die um die 40 sind) unter dem Beifall der anderen Männer und zur wohlwollenden Erheiterung des übrigen Lokals? Arien aus dem »Zigeunerbaron«, »Funicolì funicolà«, ganz am Schluss ein bisschen »And when the saints go marchin’ in«.
Wie tradieren sich diese Melodien? R. kennt sie ja selbst, bloß die Texte nicht. So wenig wie die singenden Männer.
»Gibt es eine FAZ?«, fragt R. – »Nein, die ist noch nicht da, überhaupt ist die Post noch nicht da«, antwortet Frau K.
Später ist sie da, und die FAZ liegt vor Frau K. auf ihrem Schreibtisch. Als R. herantritt, holt sie gerade ein Manuskript aus seinem Kuvert. – »Geben Sie mir mal die FAZ.« – »Gleich; ich will sie erst selber lesen.« – »Lesen Sie doch zuerst das Manuskript.« – »Nein; lesen Sie es.« – »Um Gottes willen.«
Es entsteht ein richtiger Streit mit Anschreien, und als R. spätabends Kathrin, die gerade aus Köln zurückkehrt, davon erzählt, freut sie sich: »Du und deine Frau K., eine richtige Bürofeindschaft.«
Zuerst wird das Zeit-Magazin durchgeblättert, wobei eigentlich nur die Cartoons von F. K. Waechter und, gegebenenfalls, Hans Traxler genauer studiert werden; ein Text ist im Zeit-Magazin schon seit unvordenklicher Zeit nicht mehr gelesen worden.
Dann folgt Die Zeit selbst, wobei es sich im Wesentlichen ebenso um Durchblättern handelt: ganz gewiss des politischen und des Wirtschaftsteils. (Regelmäßig aber ein sehnsüchtiger Blick auf die Ausschreibungen der Universitäten in Berlin.) Manchmal wird ein Artikel im Feuilleton gelesen (hier schaut R. vor allem nach, ob jemand ihn zitiert); ebenso wird mit den Artikeln in der Abteilung »Modernes Leben« verfahren.
Dann ist der Stern dran, und hier ist zwischen Durchblättern und Lesen glücklicherweise nicht mehr genau zu unterscheiden, denn im Wesentlichen handelt es sich ja um Bilder mit kurzen, rasch fassbaren Unterschriften. Zuweilen wird ein Text in der Abteilung »Diese Woche« studiert und – am sorgfältigsten von allem – das Fernsehprogramm für die nächste Woche.
Erding. Abendessen mit Erika Quandt und Fritz Posau. Kathrin erzählt von Gertraud Busch, ihren ersten Auftritten als Psychotherapeutin, und Erika Quandt berichtet, dass sie mehrere Jahre lang eine dieser Körperpsychotherapien absolviert habe. – »Warum?« – »Aus Neugier.« – »Aber bloß aus Neugier macht man doch so etwas nicht.« – »Ich war halt sehr depressiv.«
Kathrin beginnt eine kräftige Verteidigung der Psychoanalyse, und Erika Quandt versucht zu erklären, dass ihr Therapeut genau wie ein Analytiker verfahren sei. Dann gesteht sie, dass sie von der Psychoanalyse niemals etwas habe erwarten können, denn schon der Gedanke, Reden helfe, sei ihr ganz fremd. – »Seitdem hat Erika«, so einer von Fritz Posaus wenigen Sätzen an diesem Abend, »viel weniger Depressionen. Und sie hat sich auch körperlich verändert.«
Читать дальше