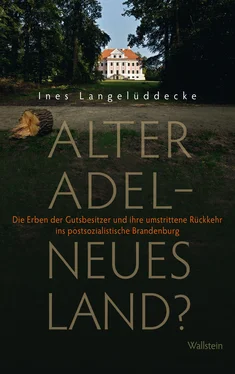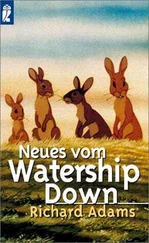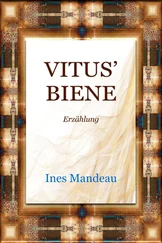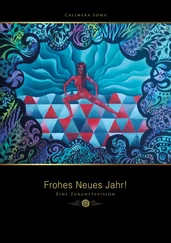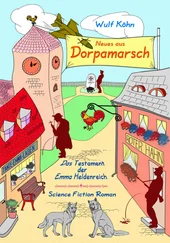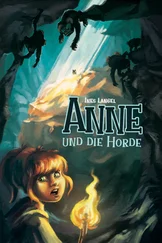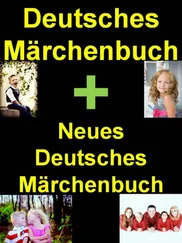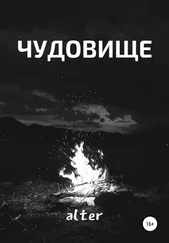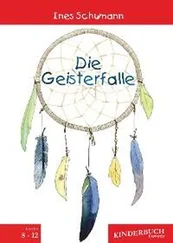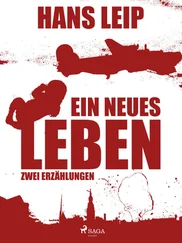In einer Deutung, die an Theodor Fontanes Gedicht über Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland[4] denken lässt, bezog sich Helene Kaiser in ihrem Brief auf die traditionelle Gutsherrschaft, in deren Rahmen sich die Angestellten unterordneten, dafür aber gutsherrschaftlicher Fürsorge gewiss sein konnten. So wie auf dem Grab des verstorbenen Gutsbesitzers in Ribbeck ein Birnbaum wächst und Früchte trägt, die die Kinder des Dorfes jedes Jahr wieder essen, so konnten in Siebeneichen Frauen und Kinder auf den Feldern des Gutes wenigstens noch einmal die Mohrrüben ernten, die Botho von Sierstedt im Frühjahr kurz vor Kriegsende hatte aussäen lassen. Diese letzte Ernte im Herbst 1945 beschrieb Helene Kaiser im Rückblick als bedeutendes Ereignis der Nachkriegsmonate. Zugleich versorgte sie den enteigneten Gutsbesitzer, der mittlerweile im Rheinland lebte, auch mit Neuigkeiten darüber, wie sich die Verhältnisse im Dorf verändert hatten:
»In Siebeneichen würde sich manch einer freuen, wenn ›der Chef‹ bald wieder käme. Aber leider sind auch welche dabei, die Sie einst ihre Getreuen nannten, die heute sagen: ›Mir geht es so viel besser.‹ Ein paar Neubauten sind auch schon in Siebeneichen entstanden.«[5]
Die Adelsfamilie und die Dorfbewohner waren 1948 noch verbunden durch die gemeinsame Geschichte, die der Enteignung vorausgegangen war.[6] Daran erinnerte Helene Kaiser in ihrem Brief über die Zonengrenze hinweg. Zugleich hatte mit dem Umbruch von 1945 eine neue Zeit begonnen, in der sich die Verbundenheit der früheren Angestellten mit dem Gutsherrn, der nicht mehr im Dorf lebte, allmählich lockerte. Für Botho von Sierstedt erfüllte sich nicht mehr, was er in seinem Antwortbrief an Helene Kaiser vom 1. April 1948 ersehnt hatte: »Im tiefsten Herzen aber bleibt doch immer noch die Hoffnung, dass wir doch einmal noch die Heimat wiedersehn dürfen. Es gilt nur noch lang hübsch geduldig bleiben.«[7] Er starb 1982 in Köln. Der letzte Brief von Helene Kaiser stammt aus dem Jahr 1975, als sie aus einem Pflegeheim an den ehemaligen Gutsbesitzer schrieb.[8] Auch sie erlebte das Ende der deutschen Teilung nicht mehr. 1990 begegneten die Nachfahren des enteigneten Gutsbesitzers der Dorfbevölkerung von Siebeneichen. Jetzt erhoben beide Seiten, Adelsfamilie wie Dorfbewohner, Anspruch auf das ehemalige Gut. Teilweise kooperierten sie, beispielsweise bei der Wiederinstandsetzung der Dorfkirche, sie verhandelten aber auch und stritten über die Frage, wie die ehemalige Gutsanlage und die dazugehörigen Gebäude praktisch und symbolisch genutzt werden sollten.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 befanden sich in Brandenburg die großen landwirtschaftlichen Güter (mit Acker- und Waldflächen von häufig über 1000 Hektar) im Besitz der jeweiligen Adelsfamilie, oftmals seit Jahrhunderten.[9] Als Folge der Bodenreformverordnung, die auf Initiative der KPD und der sowjetischen Besatzungsmacht in Brandenburg am 6. September 1945 in Kraft getreten war, bildeten sich in den Dörfern Bodenreformkommissionen, die das Land der Gutsbesitzer und Großbauern, die über 100 Hektar besaßen, an landlose und landarme Bauern verteilten.[10] Die Gutsgebäude gingen in die neugeschaffene Rechtsform des Volkseigentums über. In der ersten Zeit nach der Enteignung dienten sie häufig als Unterkünfte für die sogenannten Umsiedler, später dann als Altersheime, Schulen, Kindergärten oder landwirtschaftliche Betriebe. Ungefähr 420 Gutsbetriebe in adligem Besitz waren 1945 in Brandenburg enteignet worden.[11] Nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung 1990 veränderten sich die Eigentumsverhältnisse in Ostdeutschland erneut. Etwa 30 bis 40 Adelsfamilien kehrten zwischen 1990 und 2010 nach Brandenburg zurück.[12] Die Nachfahren der enteigneten Gutsbesitzer kauften 1990 das Land und die Gebäude des ehemaligen Gutes aus staatlichem Besitz, denn die Enteignungen im Zeitraum zwischen 1945 und 1949 wurden nicht rückgängig gemacht.[13] Die Adelsfamilien sanierten die Gebäude, gründeten Unternehmen, engagierten sich in der Lokalpolitik und verhandelten mit der Dorfbevölkerung über die Verpachtung oder den Verkauf von Ackerflächen.[14] Schlösser, Kirchen, Friedhöfe, Parks, Felder und Wälder im ehemaligen Gutsdorf sind heute nicht nur private, sondern zumindest zum Teil auch öffentliche Räume.[15] Sie sind, wie die ehemalige Patronatskirche in Siebeneichen, immer auch Symbole einer standesspezifischen Familienerinnerung. In der Zeit der deutsch-deutschen Teilung waren sie für die Adelsfamilie mit dem Verlust ihres Gutes verknüpft. Die Gutsgebäude haben im Laufe der Zeit ihr Aussehen verändert. In ihrer Materialität weisen sie aber bis heute Spuren von Macht, Repräsentation und Reichtum auf. Sie zeugen von dem Willen der adligen Oberschicht, das Gutsdorf als Herrschaftsraum zu gestalten. Die Gutsanlagen mit ihrer repräsentativen Architektur befinden sich häufig im Zentrum der ehemaligen Gutsdörfer. Doch nicht nur für die Adelsfamilien, auch für die Dorfbewohner sind die Schlösser, Kirchen und Parks Bezugspunkte für die lokale Geschichte. Für beide Seiten verbinden sich damit Vorstellungen von Heimat und regionaler Zugehörigkeit.[16]
Forschungsgegenstand und Fragen
Drei brandenburgische Gutsdörfer, in denen seit 1990 wieder die enteigneten Adelsfamilien von einst leben, sind Gegenstand der Fallstudien, auf denen diese Untersuchung basiert.[17] Hier verlief die Geschichte nach 1945 und 1990 ganz unterschiedlich: In Siebeneichen wurde das Schloss nach Kriegsende zerstört und nicht wieder aufgebaut. In Kuritz ist das ehemalige Schloss heute ein kulturelles Zentrum, das dem Landkreis gehört. In Bandenow lebt die zurückgekehrte Adelsfamilie wieder im Gutsgebäude. Nach dem Ende der DDR trafen die adligen Rückkehrer in den drei Dörfern auf drei unterschiedliche Konstellationen: der Abbruch der Adelsgeschichte nach 1945 in Siebeneichen, die Weiterführung der vom Adel begründeten landwirtschaftlichen Traditionen in Bandenow sowie die Umwidmung der Adelsgeschichte in eine lokale Geschichtserzählung in Kuritz. Diese Unterschiede im Umgang mit der lokalen Adelstradition sind der Grund für die Auswahl dieser spezifischen drei Dörfer. Siebeneichen, Bandenow und Kuritz gibt es jedoch auch zahlreiche Gemeinsamkeiten im Umgang mit der Gutsgeschichte und den Gebäuden des Gutes.
Im Zentrum der Untersuchung stehen die Rückkehr dieser Adelsfamilien nach Brandenburg und die Begegnung mit den Menschen im Dorf seit 1990. Beide Gruppen sind durch eine geteilte Vergangenheit bis zur Enteignung 1945 miteinander verbunden, waren aber die folgenden 40 Jahre lang voneinander getrennt. Im ehemaligen Gutsdorf wurden wie unter einem Brennglas spezifische Probleme und Dynamiken sichtbar, die seit 1990 überall im Osten Deutschlands auftraten. Selten trafen Ostdeutsche und Westdeutsche so direkt aufeinander wie in diesen ehemaligen brandenburgischen Gutsdörfern.
Inwiefern versuchten die Nachfahren der 1945 enteigneten Herrschaftselite nach 1990, also 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, an ihre Familiengeschichte anzuknüpfen? Nahmen sie dafür Umbauten an den ehemaligen Gutsanlagen vor? Wie und mit welchen Ergebnissen verhandelten sie mit der Dorfbevölkerung über die Neuordnung des Gutes, das sich nach Enteignung und Bodenreform nun wiederholt veränderte? Welche Konflikte ergaben sich aus dem Problem, unter den neuen Bedingungen einer demokratischen Gesellschaft Gebäude zu rekonstruieren, die in ihrer Materialität auf die traditionelle Gutsherrschaft verwiesen?[18] Wie sprechen beide Seiten rückblickend über diesen Transformationsprozess im ehemaligen Gutsdorf? Wie unterscheiden sich dabei die Erzählungen der im DDR-Sozialismus aufgewachsenen Bewohner der Dörfer von denen der bundesrepublikanisch sozialisierten Adligen, den Nachfahren der »Junker und Ausbeuter«, wie sie im SED-Propagandajargon abschätzig genannt wurden?[19] Welche Narrative über den Raum sind auf beiden Seiten mit dieser Rückkehr des Adels nach Brandenburg verbunden?
Читать дальше