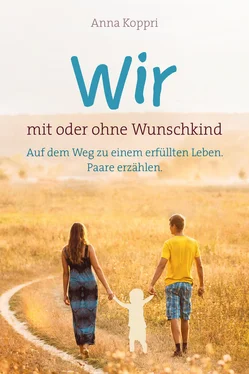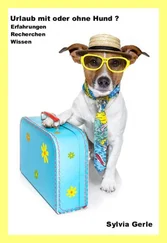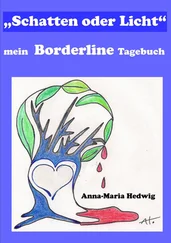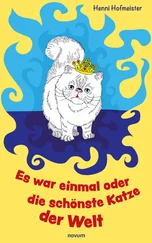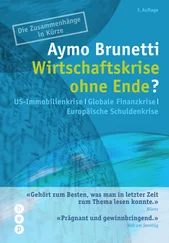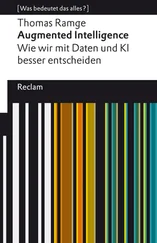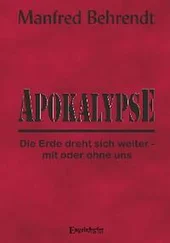Die Ärzte rechnen ihnen eine ganz normale durchschnittliche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 33 Prozent pro Versuch aus. Dadurch, dass einige Schwangerschaften sich nicht weiterentwickeln, bleibt letztlich die Chance von zirka 25 Prozent pro Versuch, dass sie ein Kind bekommen werden. Da beide eher nüchtern an die Sache herangehen und sich vor Enttäuschung schützen wollen, nehmen sie an, dass sie durch die drei Versuche, auf die sie sich einlassen wollen, im wahrscheinlicheren Fall kein Kind bekommen werden.
Ganz bewusst setzen sie sich auch mit der Frage auseinander, wie ihr Leben ohne Kinder aussehen würde und malen sich ein solches sehr positiv aus: ausschlafen, flexibel sein, Freiraum für eigene Projekte haben, reisen und ihre Gabe der Elternschaft für andere Menschen leben. Immer wieder begegnen ihnen auch andere Paare, denen keine Kinder geschenkt wurden, mit denen sie sich austauschen.
Daniel wird von den Ärzten geraten, sich operativ Samen aus den Nebenhoden entnehmen zu lassen, da es erfolgsversprechender sei, dort zeugungsfähige Spermien zu finden. Im April 2015 bekommt er schließlich einen Termin für diesen operativen Eingriff beim einzigen darauf spezialisierten Arzt der Stadt. Die OP findet unter Vollnarkose statt und bereitet Daniel auch noch Tage danach Schmerzen. Dadurch haben beide das Gefühl, dass auch Daniel seinen Teil an der Behandlung trägt und nicht Conni alle Eingriffe allein an ihrem Körper vornehmen lassen muss. Das schafft einen gewissen Ausgleich.
Die Samen werden eingefroren, für Transport und Lagerkosten müssen sie zum Großteil selbst aufkommen. Schon vor Beginn der Behandlungen hat das Paar zu einer Krankenkasse gewechselt, die sich nicht nur zu 50 Prozent, sondern zu 100 Prozent an den Kassenleistungen der ersten drei Befruchtungsversuche beteiligt. So entsteht für sie noch ein Eigenanteil von rund 1.000 Euro pro Versuch.
Erster Versuch
Leider verlässt ihre Ärztin noch vor Behandlungsbeginn die Kinderwunschklinik, um sich selbstständig zu machen. Bei ihren Nachfolgerinnen fühlen sich die beiden fachlich auch gut aufgehoben, doch wenn Conni ehrlich ist, merkt sie, dass sie sich bei ihnen nicht ganz so gut fallen lassen kann und weniger auf Augenhöhe behandelt fühlt. Trotzdem entscheiden sich die beiden, in der Klinik zu bleiben, weil sie dort schon so viele vorbereitende Schritte und Gespräche durchlaufen haben. Da für sie Daniels OP erst einmal den unangenehmsten Schritt darstellte, haben sie sich wenig Gedanken über mögliche Nebenwirkungen der Behandlungen und Hormoneinnahmen für Conni gemacht.
Im Frühsommer 2015 steht schließlich der erste Behandlungszyklus an. Mit leichter Anspannung und einer Tüte voll Medikamente machen sie sich auf den Weg zu einem Eheseminar, das zufällig im selben Zeitraum stattfindet. Just setzt Connis Periode direkt am ersten Seminartag ein, sodass sich das Paar abends ganz aufgeregt und auch ein bisschen feierlich in sein Zimmer zurückzieht, um die erste Hormongabe zur Stimulation der Follikelbildung zu spritzen.
Da sie so mit diesem ersten Versuch beschäftigt sind, können sie sich anfangs schwer auf das Seminar und die Gruppe einlassen. Zu allem Überfluss fällt Conni am nächsten Tag siedend heiß ein, dass sie nicht am ersten, sondern erst am zweiten Tag ihres Zykluses die erste Spritze hätte setzen sollen. Natürlich ist gerade Wochenende und in der Klinik ist niemand da.
Sie erreicht schließlich ganz verunsichert eine alte Schulfreundin, die Gynäkologin ist, und die ihr zusichert, dass der Tag früher kein Problem sein sollte. Trotzdem macht Conni sich psychisch großen Druck, dass der ganze Behandlungserfolg davon abhängt, ob sie alles richtig macht. Sie hat unterschätzt, wie sehr sie gedanklich mit dem Thema beschäftigt sein würde, und nimmt sich vor, für einen weiteren Versuch einen Zeitraum zu wählen, in dem sie parallel keine anderen Pläne haben.
Nach zehn Tagen Hormonspritzen, die Conni super verträgt, findet unter Vollnarkose die Eizellenentnahme statt. Sie ist zwar ein wenig aufgeregt, empfindet jedoch auch diesen Eingriff nicht als besonders belastend und ist froh, dass genug Zellen herangereift sind. Hinterher spürt sie nur ein leichtes Ziehen im Unterleib und hat ansonsten keine nennenswerten Beschwerden.
Nun sind sie gespannt, ob sich genug agile Spermien für die Befruchtung finden lassen. Ironischerweise ist die Qualität der frischen Spermien, die Daniel zusätzlich abgibt, besser, als die der eingefrorenen. Die Ärzte sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, sodass sich die beiden wenige Tage später erneut in der Klinik einfinden, um Conni die herangereiften Embryonen einsetzen zu lassen. Es tut dem Paar gut, fast jeden Termin gemeinsam wahrzunehmen, auch wenn Conni meist diejenige ist, die behandelt wird.
Die beiden sitzen im OP-Raum und erleben per Liveübertragung auf einem Bildschirm, wie im Labor eine befruchtete Eizelle mit einer Pipette aufgesaugt wird. Die Zellen haben sich bereits ein paar Mal geteilt. Begleitet wird der Prozess durch die Ansage der Biologin, dass dies „der Achtzeller von Herrn und Frau S.*“ sei, was dem Paar eine Gänsehaut beschert. Das ist der Embryo, der sich vielleicht in ihrer Gebärmutter einnisten und zu dem erwünschten Kind heranwachsen wird.
Durch ein Türchen wird die Pipette aus dem Labor gereicht und dann wiederholt sich der Prozess, denn es haben sich ganz eindeutig nur zwei der befruchteten Eizellen so weit geteilt, dass sie in die Gebärmutter eingesetzt werden können. Dadurch müssen die beiden keine weiteren Embryonen verwerfen oder sich zwischen mehreren entscheiden.
Nach dem Einsetzen fahren sie nach Hause, zum ersten Mal mit dem feierlichen Gefühl, dass nun ein Kind in Conni entstehen könnte, vielleicht sogar Zwillinge. Sie erleben, wie lang zwei Wochen sich anfühlen können und werden schon vor dem Bluttest in der Klinik damit konfrontiert, dass Connis Periode einsetzt. Die Hoffnung auf eine Schwangerschaft schrumpft auf einen winzigen letzten Rest zusammen. Ihnen wurde gesagt, dass eine Blutung nicht unbedingt bedeuten muss, dass keine Schwangerschaft vorliegt. Doch der Bluttest nimmt schließlich den letzten Funken Hoffnung.
Besonders schwer ist in diesen Tagen für die beiden zu verarbeiten, dass die Frau von Daniels Bruder genau zu diesem Zeitpunkt verkündet, dass sie schwanger sei. Vorher war es für das Paar, trotz des eigenen unerfüllten Kinderwunsches, immer einfach, sich mit befreundeten Paaren und Verwandten über deren Schwangerschaften zu freuen, doch diesmal haben sie daran zu knabbern.
Ein weiterer Versuch, der schon zwei Monate später stattfindet, wird vorzeitig abgebrochen, da nicht ausreichend Eizellen herangereift sind.
Ein dritter Versuch im November, der jedoch erst der zweite kassenfinanzierte ist, verläuft ähnlich wie der erste, nur dass Conni sich durch eine abgewandelte Behandlungsform mit wesentlich längerem Vorlauf sehr in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt.
Kurz nach dieser weiteren Enttäuschung beginnt sie einen neuen Job in der Arbeit mit Geflüchteten und möchte sich in der Probezeit erst einmal darauf konzentrieren. Da für beide noch immer feststeht, dass der folgende Versuch ihr letzter sein wird, entscheiden sie, sich für diesen besonders viel Zeit zu lassen. Außerdem hört Conni schließlich auf ihr Gefühl, und die beiden wechseln in die mittlerweile neu aufgebaute Klinik ihrer ersten Ärztin, bei der sie sich prompt wieder sehr wohlfühlen.
Elternschaft auf eine andere Weise leben?
2015 ist das Jahr, in dem die Flüchtlingsströme nach Deutschland kommen. Einige Geflüchtete docken in dem Gemeinschaftsprojekt von Conni und Daniel an, das dadurch ganz neu belebt wird. Das Paar nimmt in gewisser Weise eine Elternrolle für viele von ihnen ein und fragt sich, ob ihnen vielleicht eigene Kinder verwehrt bleiben, damit sie auf diese Weise Elternschaft leben können.
Читать дальше