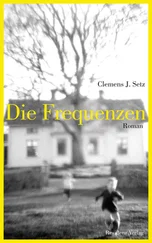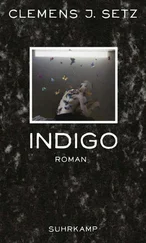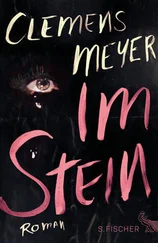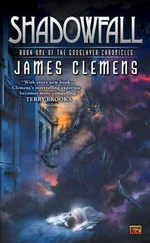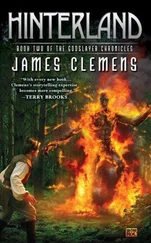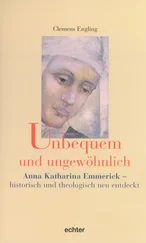Eines Tages bot mir meine damalige Schwimmtrainerin an, ein zweites wöchentliches Training zu belegen, sie meinte, ich hätte Talent und würde gut in die nächsthöhere Trainingsgruppe passen. Das zweite Training fand jedoch am selben Nachmittag wie mein Turntraining statt, also musste ich mich entscheiden. Das Lob der Schwimmtrainerin und die Aussicht, mehr Zeit mit Herwig zu verbringen, erleichterten mir die Entscheidung. Aus anfänglich zweimal Schwimmen pro Woche wurde rasch eine tägliche Selbstverpflichtung. Nun war jeder Nachmittag ab 16 Uhr fürs Schwimmen reserviert. Um das Training regelmäßig absolvieren zu können, zwang ich mich, die Schule zur Zufriedenheit meiner Eltern zu erledigen; ich besuchte das Akademische Gymnasium am Rainberg. Meine Klassenkollegen nahmen mich kaum wahr, oft stand ich außerhalb der Klassengemeinschaft, gegenüber den Lehrern verhielt ich mich zurückhaltend. Ich war für sie nur anwesend, mehr nicht – das reichte, um Durchschnitt zu sein. Im Sportunterricht genoss ich Ansehen, mein vielseitiges Können, meine spürbare Leidenschaft für das Spiel und den Wettkampf sorgten für den nötigen Respekt meiner Altersgenossen.
Schon nach kurzer Zeit wollte ich noch mehr Sport machen, ein tägliches Training schien mir mit 15 Jahren zu wenig. Der Wechsel vom Akademischen Gymnasium in das Schulsportmodell Salzburg, das den Schülern ab der neunten Schulstufe zusätzlich Trainingseinheiten an zwei Vormittagen erlaubte, war mein Wunsch. Meine Eltern waren jedoch dagegen. Auch Herwig wechselte nicht in das Sportmodell, er besuchte ein normales Gymnasium, und irgendwann erlaubte der Schulalltag ihm kein tägliches Training mehr. Er beendete seine aktive Schwimmkarriere noch während seiner Schulzeit. Wir sahen uns nun unter der Woche kaum mehr, auf einmal fehlte mir ein Stück meiner Leidenschaft. Irgendetwas an der Leichtigkeit war verloren gegangen, das Training wurde mehr und mehr zu einer Aufgabe, die es bestmöglich zu erledigen galt. Ich konzentrierte mich auf die punktgenaue Umsetzung meines Trainingsplans, auf das Ergebnis meiner Trainingsaufgaben, versteifte mich auf geschwommene Zeiten, ich wollte schneller werden. Das unbeschwerte Spiel, das Herwig und ich in jeder Lebenssituation intuitiv gemeinsam zelebriert hatten, wich mehr und mehr aus meinem Alltag.
Nun konnte ich nicht mehr tanzen, ich begann zu leisten .
Ich verlor Herwig Schritt für Schritt aus meinem Alltag, dennoch trafen wir uns immer noch an den Wochenenden. Unsere Freundschaft blieb besonders für mich bestehen, auch abseits des Sports. Herwig stand immer an meiner Seite, ein gutes Gefühl.
Ein gleichaltriger Schwimmerkollege wechselte hingegen in die Schule mit dem Sportschwerpunkt und erkämpfte sich dadurch einen Trainingsvorsprung. Fehlende Trainingshäufigkeit versuchte ich nun durch verbesserte Qualität wettzumachen. Ich wollte immer das Maximum aus jedem einzelnen Training herausholen. Ich konnte regional den Anschluss halten, die Ergebnisse spiegelten mein Talent und meinen Einsatz wider, die geschwommenen Zeiten ebenso. Unabhängig von der sportlichen Weiterentwicklung fühlte ich mich in meinem Sport geborgen, er schenkte mir Selbstvertrauen, gab mir Halt und eröffnete mir die Möglichkeit, Erfolg und Anerkennung zu erlangen. In mir entwickelte sich der Gedanke, dass Sport auch meine Profession werden sollte, ich fühlte mich magisch angezogen von der Faszination des Wettkampfes, der Bühne, die der Sport den Sportlern schenkte, und der Geborgenheit, die mir mein Trainingsumfeld gab.
Ich hatte meinen Platz gefunden .
Nach der Matura – ich war zwar ein begabter, aber noch wenig erfolgreicher Schwimmer – setzte ich alles daran, nun endlich meine Grenzen auszuloten. Erst danach, so dachte ich, könnte ich wissen, ob ich genügend Kraft, Willen und vor allem Belastbarkeit hätte, um ein Spitzenschwimmer zu werden. Ich war gewillt, ein ganzes Jahr lang alles andere dem Leistungsschwimmen unterzuordnen. Aus diesem Grund zog ich nach Wien und begann umgehend, mein Trainingspensum zu verdoppeln.
Alles oder nichts .
Jetzt wollte ich es wissen .
It’s a town full of losers and I’m pulling out of here to win .
Bruce Springsteen, Thunder Road
Nur über meine Leiche. Mit mir hast du dir den falschen Gegner ausgesucht. Ich werde sicher nicht nachgeben. Ich bin nicht wie jeder. Ich bin Clemens. Was andere darüber denken, interessiert mich nicht. Was für andere gilt, muss noch lange nicht für mich gelten. Geht nicht, gibt es nicht. Wenn ich einmal scheitere, probiere ich es noch einmal. Und scheitere besser! Noch bin ich jung, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin der Baumeister meines eigenen Glücks. Meiner Zukunft. Sei einfach geduldig, deine Chance wird kommen. Pause brauche ich keine. Ich bin da. Und bleibe da.
Nur über meine Leiche!
Dass ich so weit gehen würde können, dachte ich damals noch nicht.
Mit 18 Jahren fokussierte ich nichts anderes als das nächste Training. Zehn Trainingseinheiten in der Woche waren die Regel, in intensiven Vorbereitungszeiten oftmals mehr, selten – zwecks Erholung – auch weniger. Das erste Training früh am Morgen, ich kroch um 5 Uhr aus dem Bett, um 6 Uhr sprang ich ins einsame Wasser des Wiener Stadthallenbades. Meist zwei Stunden lang. Das frühe Aufstehen kostete mich mehr Überwindung, als mir lieb war. Dennoch ließ ich niemals ein Training aus. Um 8 Uhr stieg ich wieder aus dem Wasser und freute mich auf ein ausgiebiges Frühstück. Am späten Nachmittag schuftete ich eine Stunde in der Kraftkammer und wiederum zwei Stunden im Wasser, um ausgelaugt, erschöpft, aber zufrieden um 20.30 Uhr wieder in meinem kleinen Zimmer im 15. Wiener Gemeindebezirk zur Ruhe zu kommen. Mein Zimmer lag in einem katholischen Wohnheim, das von Schulbrüdern geleitet wurde und mir von Anfang an gespenstisch vorkam. Allein in meinem Zimmer sitzend, schaufelte ich mir abends so viele Kalorien, wie ich nur aufnehmen konnte, hinein. An den Abenden lag ich erledigt vor dem Fernseher in einem dauerhaft menschenleeren Gemeinschaftsraum und ließ mich von dem immer gleichen Fernsehangebot berieseln. Außer den etwas eigenartigen Gestalten der Schulbrüder begegnete ich niemandem in diesem seelenleeren Haus in der Nähe des Westbahnhofs. Es roch nach Einsamkeit. Ich sprach kein Wort an diesen Abenden. Vordergründig kümmerte es mich nicht weiter. Ich war mit meinem Sport beschäftigt, das allein füllte meinen Alltag aus.
Ich kochte selbst, aß allein, hatte einen eintönigen Tagesrhythmus, ging früh schlafen, um in den Morgenstunden halb verschlafen wieder zum Training zu gehen – über den Westbahnhof in die Stadthalle. Das Trainingsbecken befand sich im Keller. Es war dunkel, die Atmosphäre feuchtschwül und anonym. Ich empfand meine Trainingsstätte als bedrückend.
Alleingelassen mit meinen Träumen in einer fremden Stadt .
Um 6 Uhr morgens sprechen Menschen nicht – sie wachen auf. Sie ordnen ihre Gedanken und stellen sich auf den anstehenden Tag ein. Ich sprang ins Wasser. Man sah seine Trainingskollegen, grüßte sich, sprach aber nicht miteinander. Nach dem Training hetzten alle Sportler davon. Das Frühstück, die Arbeit, das Studium, der Beruf warteten. Zeit für Kommunikation blieb keine. Ich stand als Einziger in der Dusche, genoss die Wärme des Wassers auf meinen müden Schultern und blieb oft so lange, bis die Haut runzelig und aufgeweicht war. Ich liebte es. Das Duschen jedoch spülte die Einsamkeit auch nicht weg. Nach dem Frühstück fuhr ich zur Universität, war aber zu müde, um den Professoren zuzuhören. Die Vorlesungen in Politik und Geschichte waren anonym, sie konnten die Trägheit meines Geistes nicht vertreiben. Nach einigen Wochen scheiterte mein Versuch, sowohl den Körper als auch meinen Geist gleichermaßen zu fordern. Der Schlaf mit vollem Magen nach einem ausgiebigen Frühstück war weitaus verlockender als das Studium. Ich fuhr fortan nur mehr zum Mittagessen zur Universität, besuchte die Mensa, mied jedoch alle Hörsäle. Die Zeit bis zum Training am frühen Abend vertrieb ich mir mit Musikhören und dem Lesen von Fachbüchern und Journalen über Schwimmsport. Ich wollte meine sportliche Leistung verbessern. Das war der Grund für meinen Aufenthalt in Wien. Der Johnny Walker, den mir Herwig eines Morgens nach einer feuchtfröhlichen gemeinsamen Feier geschenkt hatte, stand unberührt, einsam und staubig auf meinem Fensterbrett. Der Whisky blickte traurig aus dem Fenster. Er hatte nichts zu tun.
Читать дальше