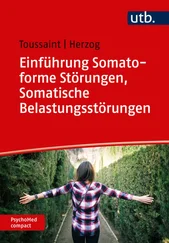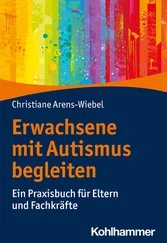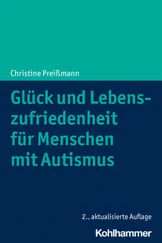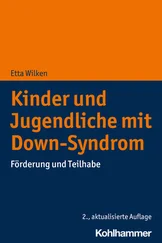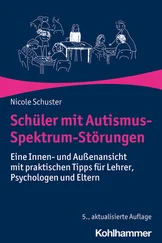Sobald die besonderen Interessengebiete der Menschen mit Asperger-Syndrom in das Gespräch einfließen, werden ihr großes Wissen und ihre diesbezügliche Konzentrationsfähigkeit deutlich. Dieses Wissen ist eher lexikalischer, sachlicher und oft technischer Natur und ignoriert manchmal die Einbindung in größere Zusammenhänge. Die Betroffenen zeigen eine hohe Motivation, sich damit auch auf Kosten von sozialen Aktivitäten zu beschäftigen. Schon in jungen Jahren kann ein hinsichtlich der kognitiven als auch sozialen Komponenten auffälliges Spielverhalten beobachtet werden (z. B. kein Imitations-, Rollen-, Phantasie- oder Gruppenspiel).
Menschen mit Asperger-Syndrom wirken oft bis in das Erwachsenenalter motorisch ungeschickt und gestalten motorische Tätigkeiten unökonomisch. Sie haben Mühe, sich auf Neues, Unerwartetes einzulassen und reagieren entsprechend unflexibel bei Veränderungen von Abläufen oder geplanten Aktivitäten, bei spontanen Ideen, wie auch auf jahreszeitlich bedingte Veränderungen (z. B. Kleiderwechsel). Manche zeigen sensorische Überempfindlichkeiten vor allem gegenüber Geräuschen, aber auch Gerüchen und Geschmacksempfindungen, Helligkeit oder bestimmten Berührungen zum Beispiel durch Kleider. Jugendliche schenken einer angemessenen Körperpflege häufig wenig Beachtung.
Menschen mit Asperger-Syndrom sind schneller als andere und leicht zu irritieren und verfügen manchmal über eine ungenügende Emotionsregulation, sodass für Außenstehende ganz unerwartet heftige emotionale Ausbrüche zu beobachten sind. Bereits im Kindesalter erleben Menschen mit Asperger-Syndrom ihre Andersartigkeit. Aufgrund ihrer reduzierten Fähigkeit zum Perspektivenwechsel attribuieren sie die Ursache jedoch lange dem Gegenüber und nicht dem eigenen Verhalten (»Die anderen sind ganz anders.«). Bis hinein in das Jugendalter haben sie oft nur ein begrenztes Verständnis für den eigenen Anteil an den sozialen Schwierigkeiten, da auch die Introspektionsfähigkeit aufgrund der mangelnden Theory of Mind (  Kap. 1.5.1) weniger gut entwickelt ist. Zudem wollen viele gerade in der Pubertät nur ja nicht auffallen und sich nicht von den anderen Jugendlichen unterscheiden. Dadurch ist die Veränderungsmotivation oft stark eingeschränkt und wird erst gegen Ende des Jugendalters oder im jungen Erwachsenenalter größer, was auch Auswirkungen auf die Therapieplanung hat.
Kap. 1.5.1) weniger gut entwickelt ist. Zudem wollen viele gerade in der Pubertät nur ja nicht auffallen und sich nicht von den anderen Jugendlichen unterscheiden. Dadurch ist die Veränderungsmotivation oft stark eingeschränkt und wird erst gegen Ende des Jugendalters oder im jungen Erwachsenenalter größer, was auch Auswirkungen auf die Therapieplanung hat.
Das klinische Erscheinungsbild der Mädchen mit Asperger-Syndrom unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von demjenigen der Jungen, was die Diagnose oft erschwert. Mädchen gehen mit ihren Schwierigkeiten und ihrem erlebten Anderssein anders um. Sie ahmen andere nach oder kopieren sie sogar bis in die Körpersprache hinein, passen sich so stark an, dass sie kaum mehr eine eigene Meinung zu haben scheinen, und fügen sich fast bis zur Unsichtbarkeit in eine Gruppe ein. Oft suchen sie sich eine gute Freundin, welche sie durch ihr Vorbild und ihre Solidarität an sozialen Stolpersteinen vorbeiführt. Somit fallen sie in sozialen Situationen weniger auf und werden seltener als störende Problemkinder wahrgenommen. Mädchen mit Autismus zeigen mehr So-tun-als-ob- und Phantasiespiel als Jungen und unterscheiden sich darin kaum von nicht betroffenen Mädchen (Knickmeyer et al. 2008). Ihre Spezialinteressen sind oft sozialerer und weniger technischer Art: In Phantasiespielen mit Tieren und Puppen spielen sie (erlebte) soziale Situationen exzessiv nach, um sie zu verstehen und einzuüben. Anhand von Geschichten und Vorabend-Fernsehserien versuchen sie intuitiv, ihr soziales Verständnis zu trainieren.
Menschen mit Asperger-Syndrom weisen viele Stärken auf, welche sich aber oft nicht in denselben Situationen wie ihre Schwächen zeigen. »Menschen mit Asperger-Syndrom sind, aufgrund der beschriebenen Entwicklung, aber auch sehr loyal anderen gegenüber, sie lügen oder täuschen andere Menschen nicht. Sie sind zuverlässig und halten sich auch verlässlich an einmal akzeptierte Regeln. Sie sind unvoreingenommen anderen Menschen gegenüber und betrachten andere Menschen ohne Vorurteile. Sie machen sich nicht abhängig von Moden oder Meinungen anderer und sagen offen und ohne Scheu, was sie denken. Dabei sprechen sie in einer eindeutigen, unzweideutigen Sprache und verfügen in vielen Bereichen über einen großen Wortschatz. Sie haben Spaß an ungewöhnlichen Wortbildungen und Wortspielen. In speziellen Wissensbereichen verfügen sie über ein bewundernswertes Wissen, dass sie gerne und ausführlich preisgeben« (Remschmidt et al. 2006, S. 76). Oft sind es dieselben Verhaltensmerkmale, welche je nach Betrachtungsweise und Situation wie die Kehrseite einer Münze mal eine Stärke und mal eine Schwäche darstellen. So kann der sorgfältige Blick für Details zum Verlust des Gesamtüberblicks führen, aber auch zum Erkennen von wesentlichen Unterschieden, oder die sachliche Kommunikation verhindert zwar das Heraushören kommunikativer Zwischentöne, führt aber zu einem transparenten Austausch, bei dem alle Beteiligten wissen, woran sie sind.
Eine Übersicht zu den gängigen diagnostischen Instrumenten, eingeteilt nach kategorialen Skalen (Screening-Fragebogen, Beobachtungsskalen, Interviews), dimensionalen Fragebogen, Selbstbeurteilungsbogen sowie Skalen zur Verlaufs- und Förderdiagnostik, aber auch spezifischen Skalen zum Asperger-Syndrom, findet sich in Bölte (2010).
In der Metaanalyse von Fombonne (2005) weisen 70% aller Kinder im gesamten autistischen Spektrum eine mäßige oder schwere Intelligenzminderung auf. Chakrabarti und Fombonne (2001) finden in ihrer Einzelstudie für das gesamte Spektrum eine deutlich niedrigere Komorbidität von 25% mit einer Intelligenzminderung. Definitionsgemäß kommt es beim Asperger-Syndrom zu keiner Beeinträchtigung der Intelligenz. 20% der Kinder mit Frühkindlichem Autismus haben eine schwere, 50% eine leichte geistige Behinderung, während 30% keine intellektuelle Beeinträchtigung zeigen (Fombonne 2005). Baird et al. (2006) fanden ähnliche Zahlen. Diese letzte Gruppe von normal intelligenten Kindern mit Frühkindlichem Autismus wäre dann dem High-Functioning-Autismus zuzuordnen.
Menschen mit Autismus weisen manchmal auch andere psychische Störungen auf. Heutzutage wird deshalb diskutiert, ob zusätzliche Symptome bei Autismus eine Zweit- oder Drittdiagnose rechtfertigen (Poustka et al. 2008). Die Übersichten von Tsai (1996) und Skuse (2010) verweisen auf ein erhöhtes Risiko für Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität, Tic-Störungen, affektive Störungen (Angststörungen, Phobien, depressive Störungen), Zwangsstörungen und Autoaggression, wobei die Prozentzahlen je nach Studie schwanken. Remschmidt et al. (2006) erwähnen zudem Essstörungen, Mutismus, Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen. Rund zwei Drittel (65%) aller Menschen mit Asperger-Syndrom weisen mindestens eine psychische Komorbidität auf (Ghaziuddin et al. 1998, zit. nach Remschmidt et al. 2006), wobei im Kindesalter vor allem Aufmerksamkeitsprobleme und Hyperaktivität (Goldstein und Schwebach 2004). und im Jugendalter eher depressive Symptome auftreten.
Bei rund 10% der Kinder (Chakrabarti und Fombonne 2001) finden sich auch verschiedene organische Syndrome wie zum Beispiel Epilepsie, das Fragile X-Syndrom, das Prader-Willi-Syndrom oder die tuberöse Sklerose, welche mit Verhaltensweisen auftreten, die phänomenologisch denjenigen der autistischen Störungen ähnlich sind (Poustka et al. 2008). Etwa 30% der Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Tsai 1996) entwickeln unabhängig von ihrer Intelligenz im Verlauf ihres Lebens eine Epilepsie, deutlich häufiger tritt diese bei Kindern mit Frühkindlichem Autismus und einer schweren intellektuellen Retardierung auf (Fombonne 2005).
Читать дальше
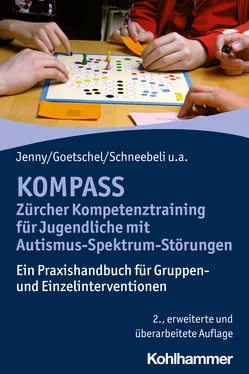
 Kap. 1.5.1) weniger gut entwickelt ist. Zudem wollen viele gerade in der Pubertät nur ja nicht auffallen und sich nicht von den anderen Jugendlichen unterscheiden. Dadurch ist die Veränderungsmotivation oft stark eingeschränkt und wird erst gegen Ende des Jugendalters oder im jungen Erwachsenenalter größer, was auch Auswirkungen auf die Therapieplanung hat.
Kap. 1.5.1) weniger gut entwickelt ist. Zudem wollen viele gerade in der Pubertät nur ja nicht auffallen und sich nicht von den anderen Jugendlichen unterscheiden. Dadurch ist die Veränderungsmotivation oft stark eingeschränkt und wird erst gegen Ende des Jugendalters oder im jungen Erwachsenenalter größer, was auch Auswirkungen auf die Therapieplanung hat.