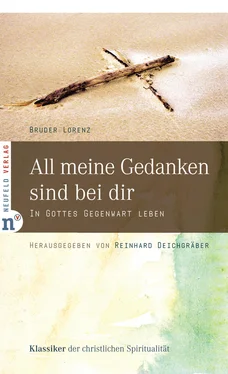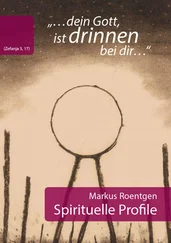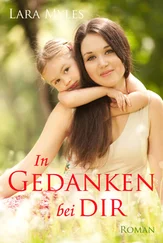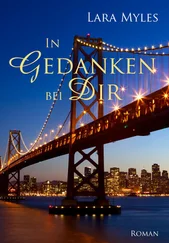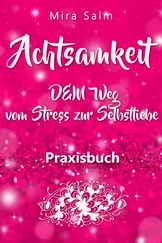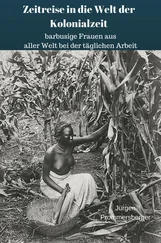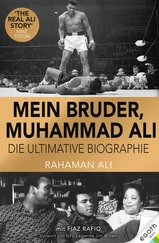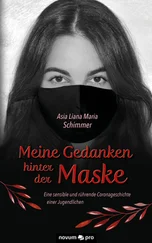Ich weiß nicht mehr genau, wann und wie es geschah, aber irgendwann wurde mir diese Erfahrung plötzlich zum Gleichnis: Das Himmelreich, die Sache mit Gott, ist gleich einem Verliebten, der seiner Geliebten ein kostbares Geschenk machen wollte. Mit ganzer Aufmerksamkeit arbeitete er an der Gabe, und gleichzeitig spürte er in seinem Herzen mit ungeteilter Aufmerksamkeit das Glück der liebevollen Nähe des geliebten Menschen.
Später fiel mir noch mehr ein. Ich dachte daran, dass Martin Luther gelegentlich davon gesprochen hat, wie gut wir Deutschen es haben, weil in unserer Muttersprache die Worte »Gott« und »gut« aus einem Wortstamm kommen und entsprechend gut zusammenklingen und zusammenstimmen. Gott und Güte, Gott und Qualität, das kann und darf man nicht mehr auseinanderreißen, seit der Schöpfer selbst sein »Und siehe, es war alles sehr gut« (1. Mose 1,31) über sein Werk gesprochen hat. Darum ist die Liebe zu meinem Gott und mein Verlangen nach Qualität, nach der Güte meines Tuns, nicht zweierlei, sondern eins.
Es ist gut, wenn wir hier für einen Augenblick innehalten. Was ist Qualität? Wir führen das Wort so selbstverständlich ein, wir gebrauchen es dauernd in der Wirtschafts- und Warenwelt und sollten doch auch einmal fragen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir Qualität einfordern. Das scheinbar so klare Wort ist nämlich eigentlich eher ein schwieriger Begriff. Sobald wir ernstlich versuchen, »Qualität« zu definieren, stoßen wir auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Das Wort »gut« entzieht sich jedem Versuch einer Begriffsbestimmung, es entwindet sich uns, je mehr wir uns bemühen, einen klaren, praktikablen Begriff von Qualität zu gewinnen. Es scheint so, als handele es sich um ein Wort, das allem Definieren zugrunde liegt, selbst aber keiner Definition unterworfen ist. Von dem, was in Wahrheit gut ist, haben wir immer nur eine Ahnung, jedoch kein eindeutiges, sicheres und gesichertes Wissen. Ich habe Bilder von dem, was gut genannt zu werden verdient, aber diese Bilder haben keine allgemein verbindlichen Konturen, sie liefern keine präzisen Kriterien. Und doch können wir Wort und Sache nicht entbehren. Die Sehnsucht nach Qualität, nach Güte, lebt in jedem Menschen. Sie macht nirgends Halt, sondern betrifft alles, was wir tun und was uns widerfährt.
Doch noch einmal: Was meinen wir, wenn wir Qualität verlangen? Uns verlangt danach, dass das Produkt, das wir kaufen oder das wir selber fertigen, guttut. Es soll vertrauenswürdig und verlässlich sein, es soll gefallen, es soll froh machen und zufrieden. Es soll seinen Zweck erfüllen, soll lange halten und nicht so schnell kaputt gehen. Damit es dieser Ursehnsucht gerecht wird, müsste es ein Mittleres sein zwischen Pfusch auf der einen und perfektionistischem Vollkommenheitswahn auf der anderen Seite.
Zurück zum Bruder Lorenz: Ich denke, so müssen wir uns seine Küchenarbeit vorstellen. So müsste auch unsere eigene Arbeit aussehen: tätig werden wie ein Verliebter, der dem geliebten Menschen Freude bereiten will. Und dabei wird die Arbeit gut und sie wird Freude bereiten, und zwar beiden, dem, der sie tut, und dem, der das fertige Produkt genießt.
Nach diesen allgemeinen Erklärungen ist es höchste Zeit, dass wir zur Praxis kommen. Dazu einige kleine Hinweise. Es wird hilfreich sein, wenn ich mit einer bestimmten Tätigkeit beginne. Ich kann nicht gut an mehreren Stellen gleichzeitig üben. Wenn jemand keine eigene spontane Idee hat, wo er oder sie beginnen kann, mag die folgende Anregung willkommen sein: Ich beginne mit dem Tischdecken, Tischdecken für das Frühstück am Morgen, für das Mittagessen, für den Nachmittagskaffee und für das Abendessen. Tischdecken für die alltäglichen Mahlzeiten oder auch einmal für ein besonderes Festmahl mit Gästen. Am Anfang sammele ich mich für einen Augenblick auf mein Tun. Ich vergegenwärtige mir kurz, dass Gott da ist. Und ich frage mich, ob ich da bin. Letzteres scheint eine pure Selbstverständlichkeit zu sein, ist es aber keineswegs. Wie oft erlebe ich mich als nicht richtig präsent!
Und wie bin ich da? Für einen Augenblick spüre ich meine jetzige Verfassung: tatendurstig oder angespannt oder müde oder gestresst oder in Eile oder von irgendeiner Sorge angefressen. Ich begnüge mich mit der einfachen Feststellung des Ist-Zustandes. Ich werte also nicht; ich will nichts verändern und widerstehe der Versuchung, das, was jetzt ist, zu überspielen, »so zu tun, als ob«. Nur eines möchte ich sein: wach, aufmerksam, achtsam, lebendig-präsent im Hier und Jetzt. Wenn ich meine Arbeit, das Tischdecken, gut mache, wird es mir gut tun, und ich werde denen, für die ich den Tisch decke, Freude bereiten. So gehe ich ans Werk, lasse mir Zeit, gebe dem Wunsch, dass der Tisch einladend aussehen möchte, Raum. Ich tue die einzelnen Handgriffe fühlsam. Mit dem Geschirr und dem Besteck gehe ich achtsam und liebevoll um; ich freue mich an seiner schönen Gestalt, an seinen Formen, und ich spüre, wie schön es ist, wenn ich denen, die sich hier nachher zum Essen niederlassen werden, Freude mache.
Und wenn ich alleinstehend bin, so dass ich den Tisch in der Regel nur für mich selbst herrichte? Vielleicht ist das Tischdecken ja gerade dann eine heilsame, segensreiche Übung! Wieviele Singles nehmen ihre Mahlzeiten hastig ein, vielleicht so, dass sie sich nicht einmal in Ruhe setzen! Und wie groß ist die Versuchung, sich selbst zu vernachlässigen, wenn man nur für sich selbst kocht! Aber gerade dann ist es wichtig, dass ich die Botschaft höre: Du bist es wert, dass dir der Tisch liebevoll und einladend gedeckt wird! Du bist es wert, dass du dir deine Mahlzeit liebevoll zubereitest! Und – man verzeihe mir die scheinbare Naivität – wenn ich nach altem Brauch mit einem Tischgebet den Herrn Jesus selbst zu Gast an meinen Tisch bitte, damit er mir die Gaben segnet, sollte dann nicht für diesen Gast das Schönste und Beste gerade gut genug sein? Liebe sagt immer wieder: »Du sollst es gut bei mir haben!«, das ist nun einmal der Liebe Art.
Anfangs wird mir das so feierlich zelebrierte Tischdecken vielleicht unnötig umständlich vorkommen. Aber lassen wir uns Zeit; nach einiger Übung werden wir die Erfahrung machen, dass liebevoll arbeiten und flink zu Werke gehen sich keineswegs ausschließen. Irgendwann können wir unser Übungsfeld ausweiten, vielleicht auf das Blumengießen oder auf das Leerräumen der Geschirrspülmaschine oder auf eine einfache Büroarbeit oder das Kehren der Treppe oder die Reinigung der Windschutzscheibe meines Autos.
Und wenn mir trotz aller Bemühung um Konzentration bei der Arbeit die Gedanken immer wieder davonlaufen? Bruder Lorenz spricht davon, dass »unnütze Gedanken« alles verderben können, und rät, sie zu »verwerfen« (vgl. Seite 47). An dieser Stelle möchte ich dem verehrten Bruder allerdings ins Wort fallen und sagen: Lieber Bruder, ich glaube dir gerne, dass du auf diese Weise auf deinem spirituellen Weg gut vorangekommen bist. Ich stimme dir auch darin zu, dass es jammerschade ist, wenn meine Gedanken sich dauernd selbständig machen und sich beispielsweise mit der nachher zu erledigenden Steuererklärung beschäftigen, anstatt dass ich mich im gegenwärtigen Augenblick der Gegenwart meines Gottes erfreue und die Liebe, die mich mit ihm verbindet, fröhlich genieße. Aber ich fürchte, dass das Verwerfen solcher und anderer Gedanken für viele Menschen sehr leicht kontraproduktiv werden kann. Verwechselst du, lieber Bruder, nicht das so erwünschte Los lassen der zerstreuenden Gedanken mit einem willentlichen Wegwerfen? Die meisten Gedanken, die ich gewaltsam weggeworfen habe, weil sie mich in meinem Gebet oder in meiner Andacht störten, haben sich als Bumerang erwiesen: sie kamen irgendwann zurück! Und was wir vergessen wollen, setzt sich meistens besonders hartnäckig in unserem Gedächtnis fest.
Читать дальше