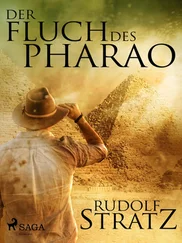Nur helfen — helfen — helfen — diese menschliche Gewissensnot des Verteidigers im Kampf um Sein und Nichtsein — das — bei Gott im Himmel — das allein fieberte in mir! Mein ganzes Ich war mit einer verzweifelten Leidenschaft geladen, dem Tod seine Beute zu entreissen. Ich sammelte alles Temperament, alle Beredsamkeit, die Gott mir gegeben. Ich sehe mich jetzt, durch die Entfernung der Jahre, in jener längst verflossenen Stunde wie einen fremden Menschen. Dieser Mensch hatte seine Fehler und Gebrechen. Ich weiss es und gestehe es: Ich wurde damals von einem blinden Ehrgeiz durchs Leben gepeitscht. Meine forensischen Erfolge in jungen Jahren waren mir zu Kopf gestiegen und hatten mich dünkelhaft gemacht. Jähzornig war ich bis zur Selbstvergessenheit. Selbstsüchtig. Ich dachte nur an meine Karriere. Ein Blender vor den Menschen. Meine berühmten Verteidiger-Reden — ach — die waren oft genug nur noch vielerprobtes Feuerwerk. Ich fühlte in meinem Innern nichts dabei.
Aber all dies Menschliche, Allzumenschliche fiel in dieser Stunde von mir ab. In mir war nur noch reines Wollen, einem von einem fürchterlichen Schicksal bedrohten Menschen zu helfen um jeden Preis! Alles in mir schrie: Paul Morell — rufe alle guten Geister! Reisse um Gottes willen diese verblendete Frau vor dem Grab zurück, das sie sich selbst stumm und mit eigenen Händen gräbt!
Ich war aufgesprungen. Ich stand vor dem Staatspräsidenten, der klein und gebückt in seinem mächtigen Sessel sass und von unten forschend aus seinen seltsamen, bedeutsamen alten Augen zu mir aufsah. Ich nahm alle meine Kraft zusammen.
„Herr Präsident!“ begann ich atemlos. „Nie war ein Verteidiger in einer so schweren Lage wie ich! Meine Klientin hat seinerzeit zu meinem Schrecken, ohne mir vorher eine Silbe zu sagen, ihre Schuld gleich zu Beginn der Gerichtsverhandlung eingestanden und seitdem kein Wort mehr darüber gesprochen! Herr Präsident — bei Gott dem Allmächtigen — ich glaube nicht an dieses Eingeständnis! Ich glaube nicht an diese Schuld!“
„. . . für die ausserdem noch völlig unwiderlegliche und einfach erdrückende Beweise vorliegen!“ schaltete der Staatsanwalt Sigrist mit Seiner leidenschaftslosen Stimme ein. Ich drehte mich stürmisch zu ihm um. Er war keiner von den Blutdürstigen seiner Gilde. Er hatte immer etwas menschlich Gerechtes. Aber er war eben der starre Hüter des Gesetzes — peinlich penibel in allem, von dem Scheitel, genau in der Mitte des rotblonden Haars, bis zur Stiefelspitze. Er stand mit seinen breiten Schultern wie ein Turm zwischen mir und drüben dem Retter in der Not, sein bartloses Gesicht mit den scharfen Augen hinter dem Zwicker war unbewegt.
„Was soll ich mit Ihnen reden, Herr Sigrist!“ sagte ich. „Wir sprechen zwei verschiedene Sprachen! Für Sie ist zweimal zwei nur einmal vier!“ Ich wandte mich wieder hastig dem Staatspräsidenten zu: „Nein! Nein! Nein! Zweimal zwei ist auch manchmal fünf! Ich möchte durch die Gassen laufen und schreien: Zweimal zwei ist fünf! Margot Sandner ist unschuldig! Sie bezichtigt sich einer Tat, die sie gar nicht begangen hat — die sie in ihrem ganzen Leben, nach ihrem ganzen Wesen niemals hätte begehen können!“
„Und aus welchen Gründen beschuldigt sie sich?“ kam es drüben in kaltem Ton aus dem Mund des Dr. Sigrist.
„Das weiss nur Margot Sandner selbst!“ rief ich ihm über die Schulter zu und fuhr fort: „Herr Präsident: Margot Sandner weiss etwas, was wir anderen alle nicht wissen! Sie nimmt dies Geheimnis in wenigen Stunden mit in die Ewigkeit, wenn wir ihr den Mund für immer versiegeln und uns so jeder Möglichkeit, es einmal zu lösen, berauben. Und doch kann dies Geheimnis eines Tages irgendwie durch die Allmacht des Schicksals herauskommen und ein Schrei des Entsetzens durch die Welt gehen: Margot Sandner war unschuldig! Man hat einer unseligen, von irgendwelchen dunklen, seelischen Mächten getriebenen Frau zu einer Art Selbstmord verholfen, und alle Reue, alle Verzweiflung machen sie nicht wieder lebendig!“
Es war eine Weile still. Dann räusperte sich der alte Herr und sagte leise, tonlos, in seiner bedächtigen Art:
„Aber sie muss es doch gewesen sein . . . Es ist gar nicht anders möglich!“
„. . . . und wenn sie es war, Herr Präsident, muss sie durchaus mit Vorsatz gehandelt haben? — wie sie das vorgibt, um dem Mann, den sie im Leben so sehr geliebt hat, in den Tod zu folgen? Kann eine Schusswaffe nicht unversehens losgehen? Ist nicht, gerade bei einer so phantastischen Frau, eine plötzliche Aufwallung wahrscheinlich, die sie der Überlegung beraubte?“
„Sie wiederholen Ihr Plaidoyer von damals!“ schrie Dr. Sigrist.
„Ist nicht sogar, um jede, auch die entfernteste Möglichkeit zu erschöpfen, eine Tötung auf Verlangen denkbar, so dass Sandner aus freiem Willen durch ihre Hand starb?“
„Lächerlich!“ Mein Widersacher drüben zuckte die Achseln. Ich beachtete ihn nicht. Ich sprach auch nicht mehr. Ich stand und schaute dem kleinen alten Herrn im Sessel unverwandt ins Gesicht, so, als forderte ich von ihm die ewigen Menschenrechte, die der tote Buchstabe des Gesetzes meiner Klientin vorenthielt.
Auch der Staatspräsident blieb stumm. Er erhob sich, mit einer Handbewegung, die den Schluss der Debatte anzeigte. Dann kreuzte er die Hände auf dem Kücken und trat in tiefem Nachdenken an das Fenster.
Aus dem Tagebuch des Staatspräsidenten Dr. Philipp Nöldechen
Ich habe diese hier folgenden kurzen Sätze unmittelbar, nachdem ich meinen Entschluss in Sachen Sandner gefasst hatte, in mein Tagebuch aufgezeichnet, um meine Stimmung und meine Beweggründe, die mich zu diesem Entschluss trieben, Schwarz auf weiss zur späteren Beruhigung meines Gewissens festzuhalten. Ich stelle hiermit eine Abschrift Herrn Dr. Sigrist zur Verfügung.
Ich stand am Fenster und machte es auf, um die frische Nachtluft zu geniessen, und sah nun erst das grosse, zahme Ungeheuer Volk, das da unten Schwarz und hunderköpfig den Platz füllte. Bei meinem Anblick — dem des Wärters des gewaltigen Chamäleons — brach es in unbestimmte Urwaldtöne aus. In ein Brausen. Viele weisse Flecke stiegen aus dem Gewoge. Das waren die gehobenen Hände der Masse Mensch. Viele Rufe durcheinander. Man konnte sie schwer unterscheiden: das „Herr — erbarme dich!“ und das „Kreuzige sie!“ — die Mörderin.
Über den aufgeregten Menschen standen hoch am Nachthimmel unwahrscheinlich hell und nahe und ganz still unzählige Sterne. Und das schien mir greisem Christen in dieser Nacht der Unruhe ein Gleichnis unserer Wanderschaft von dieser in jene Welt.
Ich dachte mir: ,Bald bist du alter Mann dort drüben!‘ Ich fragte mich: ,Darfst du diese junge Frau vorausschicken?‘
Du hältst in deiner Hand das Ding, das die Menschen Staat nennen. Sie haben es geschaffen als ein Bündnis der Starken, Gesunden und Rechtlichen, um die Schwachen und Kranken zu schützen und sich gegen die Ungerechten zu wehren. Das hatte man in den letzten Jahren zu sehr vergessen. Der Staat hiess nicht mehr Stärke, sondern Mitleid und Schwäche. Aber ist Milde des Staates gegen seine Feinde nicht Grausamkeit gegen seine Bürger? Gnade eine Ungerechtigkeit gegen die Gerechten? Weht nicht jetzt mit Recht ein schärferer Wind?
Lasse also der Gerechtigkeit ihren Lauf.
Aber gibt es nicht etwas über dem Staat? Der Staat ist ein Gebilde von Menschenhand. Der mensch ist ewig. Ewig seine Schwäche. Wir sind menschlichem Irrtum unterworfen in einem Fall, der so dunkel ist wie die Nacht da draussen. Ewig seine Schuld. Wir sind allzumal Sünder.
Da klang in meinem Ohr befreiend, die Zweifel lösend, das Wort des Heilands zur Sünderin: „Gehe hin, Weib, und sündige hinfort nicht mehr!“
Ich trat in die Mitte des Raumes zurück und sagte zu dem Verteidiger Dr. Morell:
Читать дальше