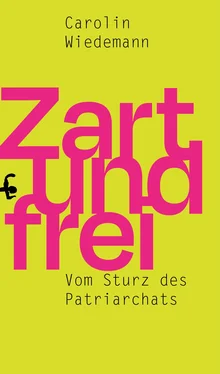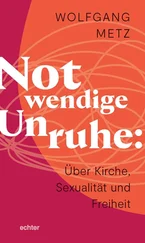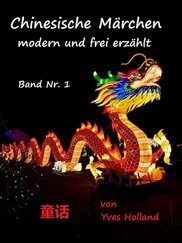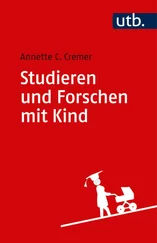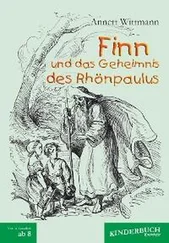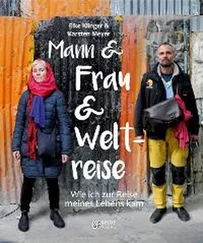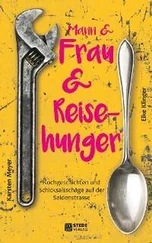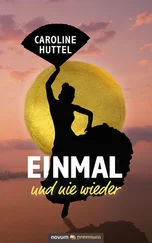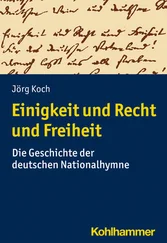Mary Wollstonecraft war die erste Autorin, die diese Zustände skandalisierte. Sie beschrieb eine »Tyrannei der Männer« (1792), allerdings noch ohne dafür das Wort »Patriarchat« zu verwenden. Dieser Begriff tauchte zur Bezeichnung von Geschlechterverhältnissen erstmals sechzig Jahre später beim Schweizer Rechtswissenschaftler und Altphilologen Johann Jakob Bachofen auf, der Mitte des 19. Jahrhunderts die entwicklungsgeschichtliche Abhandlung Das Mutterrecht veröffentlichte. Wie keine Schrift zuvor thematisiert dieses Buch eine Herrschaft der Männer und verweist dabei auch ausführlich auf ein »Vorher«, auf eine sehr lange zurückliegende Zeit, in der die Abstammung der Menschen über die Mutter ermittelt worden sei, in der Frauen geherrscht haben sollen, bis Männer sie schließlich unterworfen hätten. Auf die Frage nach dem Beginn des Patriarchats gehe ich im Kapitel zum Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat noch einmal ein, auch in Bezug auf die Analysen von Friedrich Engels, der sich in seinem berühmten Werk Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates 1884 ausführlich damit befasste. Für die Geschichte der feministischen Kritik ist Engels’ zentrales Werk gerade deshalb wichtig, weil es Bachofens Begriff des Patriarchats und die Kritik an patriarchalen Zuständen unter linken, kapitalismuskritischen Intellektuellen verbreitete.
Noch vor dem Erscheinen von Engels’ Buch hatte die erste »Frauenkonferenz« stattgefunden, die als »Leipziger Frauenschlacht« 1865 in den Zeitungen des Landes verunglimpft wurde, aber enorm erfolgreich war. Dort wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF) ins Leben gerufen, der wiederum die Gründung verschiedener Frauenverbände in ganz Deutschland nach sich zog – was als Beginn der hiesigen organisierten Frauenbewegung gilt.
In dieser Zeit schrieb auch die britische Literatin Virginia Woolf vom Patriarchat. Als erste Autorin bezog sie das Konzept der Männerherrschaft auf ihre eigenen Erfahrungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auf ihre Sozialisation innerhalb der Familie, einer bürgerlichen Familie: Dort verfügte der Vater über die Autorität und die ökonomische Macht, die Jungen wurden auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorbereitet, den Mädchen dagegen blieb eine ernstzunehmende Ausbildung verschlossen und damit auch die Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Sie waren in die Sphäre des Privaten, in die Abhängigkeit vom Vater und dann vom Ehemann verbannt.
Woolf und ihre Mitstreiter*innen aus der ersten Frauenbewegung kämpften schließlich enorm erfolgreich für mehr Rechte, für das Recht auf Bildung, das Recht zu wählen und arbeiten zu gehen. Doch damit war ihre Unterdrückung noch längst nicht beendet. Im Bereich der Wissenschaft etwa, selbst in jener Forschung, die sich mit Machttheorien befasste, tauchte der Begriff des Patriarchats noch nicht einmal auf: Die Soziologie etwa interessierte sich noch nicht für die Herrschaft des Mannes, und sie selbst wurde hauptsächlich von Männern betrieben.
Der grundsätzliche soziale Charakter der Geschlechterungleichheit wurde dann zum zentralen Kritikpunkt der Feminist*innen der Siebzigerjahre, der zweiten Welle also, womit der Patriarchatsbegriff gleichzeitig eine Ausweitung erfuhr. Kate Millett etwa schrieb 1970 mit Sexualität und Herrschaft laut der New York Times »die Bibel des Feminismus«, die das Patriarchat als das »grundlegendste Machtkonzept« der Gesellschaft identifizierte und dabei alle Normen des Zusammenlebens auf ihre patriarchalischen Züge hin abklopfte: die romantische Liebe, die bürgerliche Familie. Frauen würden so erzogen, dass sie Männern gefallen, ihnen schmeicheln und sie zufriedenstellen wollen. Millett sprach von »einer raffinierten Form ›innerer Kolonisierung‹«, die »robuster« sei »als jede Form der Segregation und rigider als die soziale Schichtung, gleichförmiger und mit Sicherheit von größerer Dauer«.
In dieser Zeit gründeten sich auch in Deutschland im Zuge der und im Anschluss an die Student*innenbewegung verschiedene autonome Frauengruppen und Netzwerke, die eine ähnlich radikale Kritik äußerten wie Millet. Und auch die weniger radikalen unter ihnen forderten das Recht auf Selbstbestimmung: aktives Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkten Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten und die Abschaffung des Paragrafen 218, der den Schwangerschaftsabbruch verbot. Parallel dazu entstanden die ersten Frauenzentren, Lesbengruppen, Frauencafés, Frauenkneipen und autonome Frauenprojekte wie Frauenhäuser – Zufluchtsorte für Opfer häuslicher Gewalt. Feminist*innen dieser zweiten Welle schafften es schließlich, ihre Kritik, die Patriarchatskritik, durch Frauenbeauftragte und -büros in Verwaltungen und im Rahmen von Women Studies an Universitäten zu etablieren und so weiter Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu nehmen.
Doch mit einem Konzept des Patriarchats, das monolithisch angelegt war und andere Machtverhältnisse außen vor ließ, ignorierten sie, wie verschieden die Erfahrungen von Herrschaft und Unterwerfung doch auch innerhalb der Gruppe derer waren, die zu Frauen gemacht wurden. Sie waren selbst zu weiß , um ihre eigene Privilegiertheit zu berücksichtigen, worauf besonders prominent die antirassistische feministische Autorin bell hooks hinwies. Die »white supremacy«, die Vorherrschaft der Weißen strukturiert(e) die Welt, jene Welt, in der Kate Millett gelesen wurde, eine Welt, in der manche Männer stärker unterdrückt und ausgebeutet wurden und werden als manche Frauen und starke Unterschiede zwischen Frauen verschiedener Klasse herrsch(t)en, erst recht, wenn sie noch mit verschiedenen ethnisierenden Zuschreibungen versehen werden.
Und dass auch lesbische Frauen und vor allem Menschen, welche die binäre Matrix in Gänze herausfordern, weniger Handlungsspielraum als heterosexuelle cis Frauen haben, war in der Patriarchatskritik der zweiten Welle der Feminist*innen ebenfalls noch kaum ein Thema. Darauf verwies vor allem Judith Butler Anfang der Neunzigerjahre. In ihren Augen übersah die Annahme eines universell geltenden Patriarchats nicht nur andere Formen subtiler und mehrschichtiger Unterdrückung. Butler wies vor allem darauf hin, dass das Konzept des Patriarchats, wie es bis dahin Anwendung gefunden hatte, die »Natürlichkeit« von Geschlechtern, von »Männern« auf der einen und »Frauen« auf der anderen Seite, implizierte und damit selbst sexistische Züge aufwies, weil es missachtete, dass auch die vermeintlich biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern immer schon Zuschreibungen enthalten, dass diese vermeintlich biologischen Unterschiede also immer schon sozial vermittelt waren und sind und dass die Zuschreibungen nie als neutral aufgefasst werden können, sondern immer bestimmten Bedeutungszusammenhängen dienen.
In jener Phase, in der Butler schrieb und damit die Gender Studies an den Universitäten mit etablierte, war es ruhiger um die feministische Bewegung geworden. Die sogenannte zweite Welle des Feminismus war abgeebbt. Sie hatte ja auch viel erreicht, zu viel, wie viele fanden.
Die Ära des Postfeminismus begann – »Postsexismus ist das leider nicht«, schrieb die feministische Autorin Katharina Voß sehr treffend dazu. Im Gegenteil: Im Zusammenhang mit der Verbreitung neoliberaler Logiken konnte sich eine neue, subtilere Form des Sexismus etablieren, die auch für unsere Zeit bestimmend ist.
1.2Postfeminismus, Neopatriarchat und die Rückkehr der Kritik
Um 2010 prägte die Gender-Forscherin Stevie Schmiedel den Begriff »Pinkifizierung«, und er schien perfekt zu beschreiben, was sich damals zeigte: die Rückkehr des Sexismus und seine Verbreitung bis ins Kinderzimmer. Plötzlich waren alle Spielzeugartikel nach Geschlechtern getrennt, sogar Überraschungseier gab es extra für Mädchen – in rosa. Welch Rückschritt, dachten wohl alle, die in den Jahrzehnten zuvor aufgewachsen waren. In den Achtzigern hatte ich als Kind selbstverständlich blaue T-Shirts und kurze Haare tragen können und war im Freibad nur mit einer Badehose bekleidet ins Becken gesprungen. In den Nullerjahren aber zog man plötzlich schon Babys Bikini oder Badeanzug an – den Mädchen , auch wenn sie erst ein paar Monate alt waren. Und als ich in einer Kinderboutique für den Säugling meiner Freundin die graue statt die rosa Spieluhr wählte, rief die Verkäuferin empört: »Aber es ist doch ein Mädchen !« und wickelte den Plüschstern gleich zweimal in fliederfarbenes Geschenkpapier. Der Zwang zur Binarität war zurück, analysierten feministische Autor*innen. Kleine Kinder sollten wieder zu einem alten Stereotyp hin erzogen werden. Das Mädchenaccessoire der 2000er schlechthin, Prinzessin Lillifee, war dessen Repräsentantin: niedlich, roter Kussmund, Wespentaille, pudert sich gern die Nase und backt Kuchen.
Читать дальше