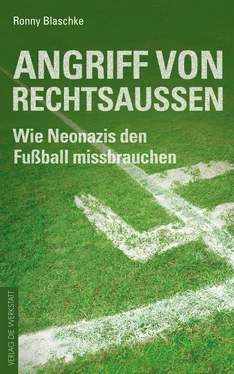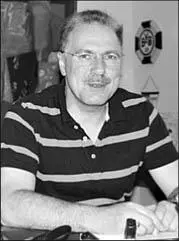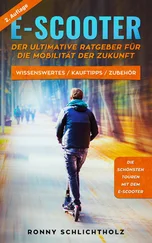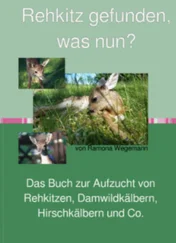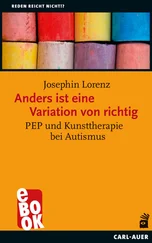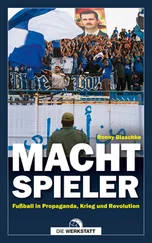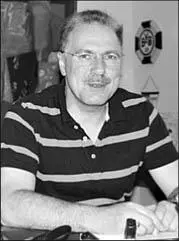
Bürgermeister Dieter Dzewas
Folgt man der Argumentation von Stephan Haase, so hat er zwei Identitäten, die er wie ein Kostüm beliebig über- und abstreifen kann. Dass er durch seine Aussagen, seine Vergangenheit, sein Umfeld Einfluss auf das Demokratie- und Toleranzverständnis des Sports nimmt, ob er auf dem Rasen steht oder nicht, will er nicht zugeben. Er sagt, dass er sich von der Nationalmannschaft, deren Spieler verschiedene Wurzeln haben, nicht repräsentiert fühle. Er kritisiert jene Kicker, die das Singen der Nationalhymne verweigern. Allerdings pfeift er in der Kreisliga C Woche für Woche Miniaturformationen dieses Multikulturalismus. Er sagt: „Im Sport vertreten wir Nationaldemokraten in der Gegenwart, genau wie die Nationalsozialisten früher, die Meinung, dass der Beste gewinnen soll. Wir Deutschen waren immer faire und freundliche Gastgeber, ob 1936, 1972, 1974 oder 2006.“ Er bringt Olympia im Dritten Reich mit den Spielen in München oder der Fußball-WM auf eine Ebene – auch auf Nachfrage will er keine Trennlinie zu Hitlers Propagandashow ziehen. Wie würde er mit Migrantenvereinen umgehen, wenn die NPD an der Macht wäre? „Da wir den Ausländeranteil herunterfahren würden, würde sich diese Frage schnell erledigt haben.“

Friedensaktivist Bernd Benscheid.
Das Interview, das Stephan Haase für dieses Buch gibt, sei sein zweites überhaupt zum Thema Fußball. Die Lokalreporter schreiben über ihn, aber reden nicht mit ihm, dabei sei er für jeden zugänglich. Juristisch sei ihm nichts vorzuwerfen, verkünden Funktionäre der Fußballverbände, nur durch Proteste könne er zum Rücktritt bewegt werden. Eine Protestbewegung der Zivilgesellschaft könnte sich an den demokratiefeindlichen Aussagen Haases entzünden. Oder an seinen Nebentätigkeiten als Schiedsrichter: Am 14. Juli 2010 berichtet der Rechtsextreme René Laube auf der Internetseite der NPD in Düren: „Dank gebührt auch dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD-NRW, Stephan Haase, der den ganzen Tag über als Schiedsrichter auf dem Platz stand.“
Vier Tage zuvor: Der Kreisverband Düren veranstaltet ein Turnier für „nationale Aktivisten“. Die Teams heißen Sturm 8, Freie Nationalisten Siegen, Freie Kräfte Köln, NS Wuppertal, NS Essen, Nationaler Widerstand Leverkusen, Skinhead Front Dorstfeld, SC Schafspelz oder Asoziale Randgruppe Istanbul. Ein Video im Internetportal YouTube, unterlegt mit dramatischer Musik, zeigt Kicker auf einen staubigen Bolzplatz. Claus Cremer, Chef der NPD in Nordrhein-Westfalen, sagt: „Solche Veranstaltungen dienen der Kameradschaftspflege und sind wunderbar geeignet, den Zusammenhalt untereinander zu fördern.“ Teilnehmer sprechen von „gelebter Volksgemeinschaft“ oder dem „Kennenlernen von Kameraden für den Kampf gegen das System“. Ein Spieler bezeichnet sich als „nationalen politischen Soldaten“, Stephan Haase ist in dem Film nicht zu erkennen. Dass er möglicherweise mit Mitgliedern von verbotenen Kameradschaften Sport getrieben hat? Wäre ihm egal: „Die Verbotspraxis des Staates ist ein Witz. Wo Gruppen verboten werden, gibt es keine Demokratie.“
Darf jemand an einem Tag Begegnungen zwischen Spielern leiten, die den Staat ablehnen, und am nächsten Tag die Bühne des Breitensports betreten, die der Staat mit Millionen fördert? Natürlich dürfe er das, sagt Stephan Haase, und verweist auf Kollegen der NPD, die Probleme im Sport bekommen haben sollen. Zum Beispiel der Landeschef: Claus Cremer hatte in Bochum eine Jugendmannschaft betreut. Die DJK Wattenscheid entband ihn im September 2010 von seinen Pflichten. Haase zählt andere Namen auf, geriert sich als politisch Verfolgter. Er sitzt nun im schummrigen Vereinsheim des TSV Rönsahl und tippt den Spielbericht in einen alten Computer, an den Wänden hängen vergilbte Fotos und Wimpel. Hinter ihm stehen Vertreter beider Mannschaften und sprechen über das letzte Heimspiel von Borussia Dortmund. Was wohl sonst diskutiert wird, wenn kein Journalist anwesend ist? Sollte Rot-Weiß Lüdenscheid Stephan Haase irgendwann ausschließen, sagt er, habe er zwei Angebote von anderen Vereinen: „Ich brauche mir also keine Sorgen machen.“
Braunes Intermezzo
In Lübeck gründet die NPD 2006 einen Fanklub – die Fans des VfB beenden das Kapitel, bevor es richtig beginnen kann.
Jörn Lemke teilt eine Eigenschaft mit vielen Rechtsextremen, er sieht sich in der Rolle eines Verfolgten: „Nationale Fußballfans wurden vom Verein immer mehr ausgegrenzt, daher war es der Wunsch vieler fußballbegeisterter Nationalisten, einen eigenen Fanklub ins Leben zu rufen.“ Lemke ist Vorsitzender des NPD-Kreisverbandes Lübeck/Ostholstein und Pressesprecher der Partei in Schleswig-Holstein. Er war bereit, schriftlich auf Fragen für dieses Buch zu antworten: „Zahlreiche Mitglieder der NPD kamen aus der Fußballszene“, lässt er mitteilen. „Auch ich habe den Weg zur nationalen Politik im Stadion gefunden.“
Lemke, geboren 1974, gelernter Industriekaufmann, Vater von drei Kindern, hat auf vielen Wegen versucht, Fans in Schleswig-Holstein an die Politik heranzuführen, vor allem in Lübeck. Nach eigenen Angaben sei er länger als zehn Jahre in der Fanszene des VfB Lübeck aktiv gewesen, der Zuspruch sei positiv gewesen: „Regelmäßig konnten Aufkleber an die Fans verteilt werden, und wenn es darum ging, Unterschriften für eine Wahlteilnahme zu sammeln, kamen am Stadion immer sehr viele Unterschriften zusammen. Nicht ohne Grund haben wir damals ein Transparent hergestellt mit der Aufschrift: ‚VfB-Fans wählen NPD‘.“
Kurz vor der WM 2006 in Deutschland will Lemke sich die Fußballstimmung zunutze machen, er gründet den Fanklub „Lübsche Jugend“, eine Art sportliche Dependance der örtlichen NPD. Lemke schreibt: „Fans identifizieren sich mit ihrem Verein und leben dabei eine gewisse Form des Lokalpatriotismus. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um Beweggründe nationaler Politik nachvollziehen zu können.“ Für den 31. März 2006 wird das Gründungstreffen des Fanklubs angekündigt. Das kritische Internetportal „NPD-Blog“ veröffentlicht zwei Tage zuvor über die „Lübsche Jugend“: „Auf der Homepage des Clubs wird kein Hehl aus der rechtsextremen Gesinnung gemacht, Fotos zeigen Nazi-Glatzen beim Pflanzen von Blumen für die ‚Opfer des alliierten Bombenterrors ‘. Weiterhin wird massiv gegen die Anhänger des FC St. Pauli gehetzt, unter anderem heißt es ‚Verrecke Pauli-Zecken! Hier ist VfB‘.“ Zudem fordere die Gruppe nach dem Weggang des amerikanischen Spielers Jacob Thomas mehr Präsenz für den „einheimischen Nachwuchs“.
Der Verfassungsschutz verortet in Lübeck einen Schwerpunkt des Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein. Gründer Jörn Lemke, der am Aufbau eines Netzwerks zu Freien Kameradschaften beteiligt war, möchte sich auf Anfrage nicht zu Struktur, Teilnehmern und Motivation des Fanklubs äußern. Manuel Kwiatkowski, seit 2008 Leiter des Lübecker Fanprojekts, erklärt sich das so: „Die ‚Lübsche Jugend‘ war ein kurzes Intermezzo, ihre Unterwanderungsversuche sind gescheitert. Der Verein und die überwältigende Mehrheit der Fans haben sich von Rechtsextremisten distanziert.“ Kwiatkowski geht seit über 50 Jahren ins Stadion an der Lohmühle. Er sagt, dass es immer wieder Vereinnahmungsversuche durch Neonazis gegeben habe, vor allem in den achtziger Jahren, allerdings nicht mit durchschlagendem Erfolg. 2006 verteilen Anhänger vor dem Stadion Flyer mit der Aufschrift „VfB Fans gegen rechts“. Ultras wehren sich in Internetforen und drängen die Rechtsextremen durch Protestaktionen aus dem Stadion.
Читать дальше