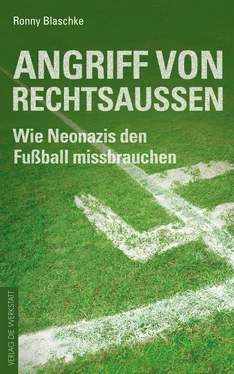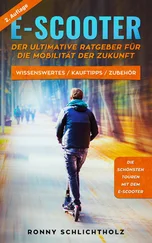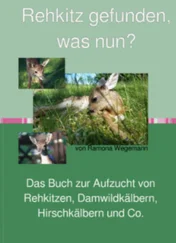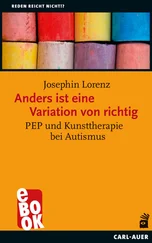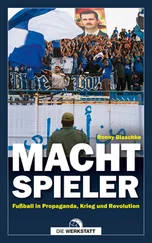Protest gegen die Protestierenden
Eine Etatdebatte im Stadtrat beginnt Haase im November 2010 mit den Worten: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Volksgenossinnen und Volksgenossen“. Daraufhin stellt der Sozialdemokrat Dieter Dzewas, seit 2004 Bürgermeister Lüdenscheids, Strafanzeige gegen Haase, da er den Begriff des Volksgenossen im historischen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus verortet, im Januar 2011 wird das Verfahren eingestellt. Dieter Dzewas sagt, er habe eine Einstellung nicht ausgeschlossen, doch er wollte ein Zeichen setzen, öffentlich: „Wir dürfen nicht denken, dass sich das Problem von selbst erledigt. Herr Haase und seine 250 Wähler repräsentieren keine Mehrheit, aber seine Stimmen stehen auch für Stimmungen. Er versucht Bedrohungsängste, Vorurteile und Wagenburgmentalitäten für sich zu nutzen. Damit müssen wir uns offensiv auseinandersetzen.“
Dieter Dzewas, 1955 in Lüdenscheid geboren, nimmt sich an einem Sonntag ausführlich Zeit für ein Interview. Links neben seinem Schreibtisch hängt ein Porträt seines politischen Vorbilds: Erwin Welke. Der Sozialdemokrat hatte sich mehrfach gegen die Nationalsozialisten erhoben, wurde dafür immer wieder verhaftet. Dzewas erinnert an die sechziger Jahre, als drei NPD-Mitglieder im Stadtrat Lüdenscheids saßen. Er verweist auf Mitglieder des rechtsextremen Dortmunder Fanklubs Borussenfront, die in Lüdenscheid für Aufregung gesorgt haben. Er erwähnt die Republikaner, die in den neunziger Jahren in einigen Stadtteilen zweistellige Wahlergebnisse erzielten. Dzewas berichtet von einer Schülerdemonstration gegen Haase, schildert Ausstellungen des ansässigen Museums über den Nationalsozialismus. „Für Jugendliche brauchen wir zeitgemäße Formen der politischen Auseinandersetzung. Und wir müssen auch unsere eigene Haltung in den demokratischen Parteien immer wieder kritisch reflektieren.“
Auf dem Kunstrasen in Rönsahl, gleich hinter Kierspe, beschäftigt sich niemand genauer mit Stephan Haase. Bis zur 20. Spielminute, bis der Unparteiische aus der Partei einen Elfmeter für den Gastgeber pfeift. Von allen Seiten stürmen Spieler aus Halver auf ihn zu, schimpfen, rudern mit den Armen. „Schau mal genau hin, Schiri!“ „Bist du noch nicht wach?“ „Du solltest in der C-Jugend pfeifen.“ Haase lässt sich nicht ablenken, mit fester Stimme sagt er: „Bitte treten Sie zurück.“ Auf seiner Notizkarte vermerkt er Rückennummern, keine Namen, er kennt niemanden persönlich. Umgekehrt ist das genauso. Alle wollen nur spielen. Sich körperlich betätigen. Spaß haben.
Im Sommer 2009 wird die Schiedsrichtertätigkeit von Stephan Haase öffentlich. Das Internetportal Indymedia berichtet von der Bürgermeisterwahl in Lüdenscheid, zudem beantwortet Kandidat Haase einen Fragebogen der Lokalpresse. Die „Westfälische Rundschau“ zitiert am 17. Oktober 2009 den Rechtsanwalt Heiko Kölz, den Vorsitzenden der Kreisspruchkammer im Fußballkreis: „Solange eine Partei nicht verboten ist, wird der DFB kaum ein Ausschlussverfahren durchsetzen können.“ Die Zeitung „Revierkick“ lässt in ihrer Ausgabe 44 Georg Heimes zu Wort kommen, den Schiedsrichter-Obmann des Kreises: „Ich denke nicht, dass die Situation kritisch ist. Wenn er ordentlich pfeift und seine Leistung bringt, gibt es keinen Grund zu handeln. Es hat sich bei uns kein einziger Verein gemeldet und gesagt, dass sie ihn nicht als Schiedsrichter haben möchten. Warum sollen wir jetzt das Feuer legen?“

Großes Echo: Schlagzeilen der örtlichen Zeitungen zum „Fall Haaase“.
Anderthalb Jahre später hat Bernd Benscheidt die Artikel der Lokalpresse auf seinem Esstisch ausgebreitet, er schüttelt den Kopf. „Natürlich kann Herr Haase Politik und Fußball nicht trennen. Unmöglich!“ Die Antwort kommt ohne Zögern. „Unbewusst nimmt er seine Gesinnung mit auf den Platz.“ Bernd Benscheidt ist Sprecher der Friedensgruppe Lüdenscheid, seit 1999 setzt sie sich ehrenamtlich gegen Diskriminierung und für Toleranz ein. Er skizziert eine Chronik der Verharmlosung und Verdrängung. Denn die Debatte verstummt, ehe sie richtig beginnt.
Bernd Benscheidt wendet sich Ende 2009 mit seiner Friedensgruppe an den DFB und den Zentralrat der Juden. Daraufhin findet im März 2010 ein zweistündiges Gespräch im Sportzentrum Kamen-Kaiserau statt. Vertreter des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen und des Fußballkreises Lüdenscheid kommen unter der Moderation des DFB-Vize und Landesverbandschefs Hermann Korfmacher zu dem Schluss, dass Stephan Haase juristisch nicht auszuschließen sei. „Haase darf weiter pfeifen“, titeln die „Lüdenscheider Nachrichten“ am 20. März 2010. Bernd Benscheidt: „Wir hatten einen langen Schriftwechsel und ein vertrauensvolles Gespräch. Viele schöne Worte, aber am Ende kam nichts dabei heraus. Der DFB gibt viel Geld für Kampagnen gegen Rassismus aus. Aber wenn es darauf ankommt, stehen wir allein da. Da fühlt man sich hilflos.“
Benscheidt geht es nicht nur um den Namen Haase, es geht ihm um die Ideologie, die Haase mit seiner Anwesenheit mit Bedeutung auflade. „Wir gehen nicht davon aus, dass er sein Schiedsrichteramt für Diskriminierungen missbraucht. Aber er kommt im Fußball immer wieder mit jungen Leuten ins Gespräch. Bewusst oder unbewusst spielt Politik da eine Rolle.“ Benscheidt wünscht sich einen Rauswurf Haases aus dem Fußballverband, auch wenn dieser danach mit einem Einspruch erfolgreich sein könnte. „Zumindest hätten wir eindeutig Flagge gezeigt“, glaubt Benscheidt. „Wir haben viele Vereine angeschrieben, aber niemand wollte sich äußern. Wir fühlen uns im Stich gelassen. Die Diskussion ist eingeschlafen. Herr Haase darf weitermachen – als wäre das ganz normal.“
Der NPD-Kreisvorsitzende Timo Pradel überschreibt den Protest gegen Haase 2009 auf der Internetseite seiner Partei für Lüdenscheid mit den Worten: „Totalitäre Machenschaften: Linksextreme Hatz auf NPD-Ratsherrn“. Weiter schreibt er: „Die selbsternannten Gesinnungswächter haben bereits ohne Erfolg im Vorfeld der Kommunalwahl versucht, mit Hilfe der politisch gleichgeschalteten Lokalpresse Druck auf die heimischen Fußballvereine und den Deutschen Fußballbund auszuüben. In einem Anflug geistiger Umnachtung wandten sich die Pseudodemokraten sogar an den ‚Zentralrat der Juden‘. Man darf schon jetzt gespannt sein, ob der DFB Stephan Haase, der sich als Schiedsrichter übrigens noch nie etwas zuschulden kommen lassen hat, den Rücken stärkt, oder ob er vor den totalitären Machenschaften einiger durchgeknallter Gesinnungswächter einknickt.“
Stephan Haase wählt für die gleichen Gedanken harmlosere Worte: „Meine Gegner werfen mir vor, ich sei gegen die Demokratie. Aber sie selbst wollen mich aus dem Sport ausschließen – das ist keine Demokratie.“ Haase richtet den Protest gegen die Protestierenden. „Ich kann die Heuchelei des politischen Gegners wunderbar in Unterhaltungen einfließen lassen, dadurch wird meine Position gestärkt, das honoriert auch die NPD.“ Spätestens im nächsten Wahlkampf kann Haase mit seinem Ehrenamt wuchern – und mit seiner vermeintlichen Standfestigkeit.
„Freundliche Gastgeber, ob 1936 oder 2006“
Manchmal erweckt Stephan Haase den Eindruck, als sei er enttäuscht, dass seine Schiedsrichtertätigkeit nicht zu einem größeren, bundesweit diskutierten Politikum geworden ist. Er sagt, er habe im Januar 2007 eine Anzeige in der Lokalzeitung gelesen und sich spontan für den Schiedsrichter-Lehrgang angemeldet. „Ich habe dort nicht über meine NPD-Tätigkeit gesprochen, das mache ich an der Supermarktkasse oder vor dem Busfahrer auch nicht. Ich habe damit gerechnet, dass mich jemand erkennt und ich meinen Schein vielleicht nicht erhalten würde.“ Von Beginn an bittet Haase um Einsätze in der Kreisliga C, deren Spiele am Sonntag stattfinden, er braucht für seine Partei an einem Tag des Wochenendes Planungssicherheit. Welche Spiele er leitet, bestimmt ein Computerprogramm. Haase ist Mitglied von Rot-Weiß Lüdenscheid, auch dort hat man nichts gegen ihn. „Vor dem Spiel kontrolliere ich die Tore und Spielfeldlinien, während des Spiels pfeife ich, danach schreibe ich einen Bericht und fahre nach Hause.“ Was passiert in der Kabine, auf dem Parkplatz, im Klubheim? „Theoretisch besteht die Möglichkeit, aber das mache ich nicht.“
Читать дальше