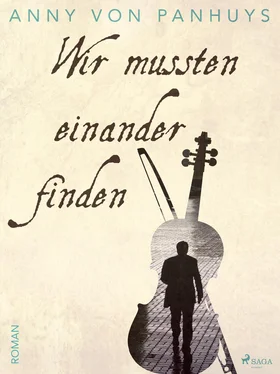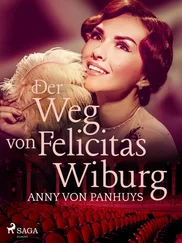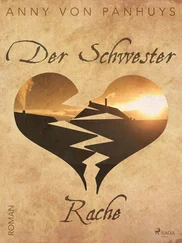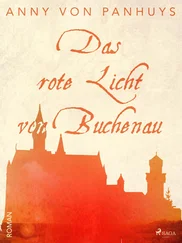Willem van Xanten reichte ihm die Hand.
„Herzlichsten Dank, verehrter Mynheer Vos, und bitte, lassen Sie sich nicht länger aufhalten.“
Vos machte den anderen eine kleine Verbeugung und ging. Gleich darauf hörte man draußen die Korridortür einschnappen.
Georgette de Martin sagte leise mahnend: „Mußt du nicht in die Klinik zur Bestrahlung, lieber Freund?“
Mynheer Boomhuys bestätigte es.
„Allerdings, Georgette, aber auf eine kleine Verspätung kommt es wirklich nicht an.“
Willem van Xanten griff nach seiner Brieftasche. „Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich die Geige gleich mitnehmen, selbstverständlich, nachdem ich gezahlt habe.“
Boomhuys nickte. „Ich bin sehr froh, daß meine geliebte Geige in gute Hände kommt. Der Abschied wird mir schwer, und deshalb, verzeihen Sie, Mynheer van Xanten, machen Sie ihn kurz.“
Verständnisvoll sah ihn der Handelsherr an. Er begriff vollkommen, wie schwer dem anderen der Abschied von dieser Geige werden mußte. Er zählte ohne Umschweife das Geld auf, fragte Georgette de Martin: „Kommen Sie gleich mit, meine Gnädigste?“
Sie lächelte. „Natürlich“, und ein paar Minuten später befanden sie sich auf der Straße. Georgette de Martin blieb stehen.
„Kümmern Sie sich nicht weiter um mich, Mynheer van Xanten, ich habe noch allerlei Besorgungen. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich für meinen armen Freund Boomhuys freue, daß die wertvolle Geige in die richtigen Hände gekommen ist. Jetzt darf ich aber wohl um —“
Er fiel ihr ins Wort: „Verzeihung, fast hätte ich es vergessen.“ Er schob ihr ein Päckchen Scheine zu, die er extra in einen Umschlag gesteckt.
Sie winkte eine Taxe heran.
„Vielen Dank, Mynheer van Xanten, ich werde immer gern an Sie denken.“
Schon stieg sie ein, nannte eine Adresse. Als das Auto sich in Bewegung setzte, winkte sie ihm noch durch das offene Fenster zu, und dann war es ihm, als höre er ein leises Lachen, ganz leise, wie aus weiter Ferne, wie vorgestern am Telefon, als er mit Georgette de Martin zum erstenmal gesprochen.
Verdreht! dachte er ein wenig ärgerlich. Was sollte das Lachen bedeuten, es störte ihn. Hübsch war Georgette de Martin, und vielleicht war er töricht gewesen, sie so einfach wegfahren zu lassen. Es klang doch eigentlich ziemlich ermutigend: Ich werde immer gern an Sie denken! Vielleicht wäre die schöne Freundin des armen Kranken einem kleinen Abenteuer nicht abgeneigt gewesen.
Er drehte sich ärgerlich um und ging die stille Straße hinunter. Man hätte ein Stück zusammen fahren können, dachte er, denn weit und breit war keine Taxe zu sehen. Er ging langsam seines Weges, aber dann fiel ihm die Geige ein, die er trug, und er vergaß darüber alles andere.
Der heutige Tag hatte ihm eine schöne Erfüllung gebracht.
Und nun tauchte auch eine leere Taxe auf. Er ließ halten und fuhr heim.
Willem van Xanten kam noch zu Tisch zurecht. Kurz vor ihm hatte sein Sohn das Speisezimmer betreten, und die Herren begrüßten sich mit kräftigem Händedruck. Jan van Xanten war ebenso groß wie sein Vater, aber seine Figur war schlank, und der Ausdruck seines Gesichts hatte, trotz aller Herbheit, etwas Angenehmes. Seine hellbraunen Augen blickten so kühl wie die seines Vaters, aber sie konnten auch lächeln und verrieten, daß Jan van Xanten warmherzig war, so kaufmännisch kalt er auch schien.
Die Herren nahmen Platz, und der ältere erzählte: „Ich hatte Gelegenheit, eine Frohnstainer Geige zu kaufen, Jan, denke nur. Du weißt doch, so ein Exemplar zu besitzen, ist schon lange mein Wunsch gewesen.“
Der Sohn lächelte. „Da gratuliere ich vielmals, Vater. Also hat die Geigerin, wie heißt sie doch gleich — na, ist ja egal —, dir die begehrte Geige doch verkauft?“
Willem van Xanten schüttelte den Kopf.
„Nein, sie war nicht herumzukriegen, sie hat damit gar nichts zu tun. Dieser Kauf war aber eine ganz ungewöhnliche Angelegenheit, ein wunderbarer und seltener Zufall.“
Jan van Xanten nickte. Mehr über den Zufall zu erfahren, zeigte er kein Interesse, meinte nur: „Um so besser“, und wechselte das Thema. „Höre mal, Vater, wie ist das eigentlich mit der Reederei Steen? Wir müssen uns einigen, die Leute drängen auf Schadenersatz, denn unser Dampfer ‚Klaas II‘ ist ihrem kleinen ‚Delfin‘ böse in die Flanke hineingerannt. Wir müssen schließlich doch zahlen. Wozu sollen wir es also erst auf eine gerichtliche Entscheidung ankommen lassen.“
Damit war das Gespräch von der Geige abgelenkt, und nun war Willem van Xanten ganz Geschäftsmann, die Geige, der endlich erfüllte Wunsch, trat völlig in den Hintergrund.
Ulli Gregorius und ihre Mutter waren Tag und Nacht durchgefahren, hatten unterwegs nirgends haltgemacht, nicht einmal in Berlin, von dem ihr Wohnort nur noch ein knappes Stündchen entfernt war. So kamen sie am nächsten Abend in der kleinen märkischen Stadt an. Am Bahnhof stand Werner Gregorius und winkte Frau und Tochter, die am Abteilfenster standen, froh entgegen. Es war ein wundervoller Frühlingsabend voll herber Frische. Noch lag über dem Himmel ein mattrosiges Leuchten, ein letzter Gruß der Sonne, die zur Ruhe gegangen, und harziger Tannenduft kam vom nahen Wäldchen. Ulli Gregorius sog den Duft tief ein, dachte glücklich: Kleine Heimat, wie froh bin ich, wieder ein Weilchen hier leben zu dürfen!
Der Zug hielt, und Ulli reichte dem Vater zuerst ihren Geigenkasten, den er mit derselben Sorgfalt entgegennahm, mit der sie ihn hinausreichte. Dann kam Handgepäck, und nun erst begrüßte man sich durch Händedruck und Kuß.
Werner Gregorius blickte die Tochter voll Stolz an.
„Mädelchen, die Kritiken, die du mir von unterwegs geschickt, haben mich ganz hochmütig gemacht. Alle, die dich kennen, sind stolz auf dich. Unsere Freunde wollten dich zusammen abholen, sogar mit Gesang solltest du empfangen werden, aber ich habe energisch protestiert und es dann auch fertig gebracht, daß man dich wenigstens zunächst in Ruhe läßt.“
Man ging langsam dem Ausgang zu, und ihren Geigenkasten trug Ulli wieder selbst. Viele Einheimische grüßten. Ulli war sehr beliebt im Städtchen, weil sie trotz des Ruhmes, den ihre jungen zwanzig Jahre schon erworben hatten, ein einfaches und liebes Menschenkind geblieben war. Draußen bestieg man ein Auto, und während der Heimfahrt hielt der Vater die Hände der ihm gegenübersitzenden Ulli fest in seinen Händen. Sie erzählte ihm von Willem van Xanten und seinem Angebot, lachte silberhell. „Denk nur, Vater, was für eine ungebildete Person dein Mädel ist. Schlägt nicht nur eine Viertelmillion holländische Gulden aus, sondern auch einen Mann, so schwerreich ist, daß wir soviel Reichtum gar nicht ganz begreifen.“
Werner Gregorius, ein schmaler, schon grauhaariger Mann mit klugen, freundlichen Zügen, stimmte in das Lachen ein.
„Gottlob, Mädel, daß dich der Mammon nicht zu reizen braucht. Verdienst ja schon selbst schrecklich viel Geld und hast es wirklich nicht nötig, deine geliebte Frohnstainer zu verschachern. Aber es imponiert mir doch, wie hoch dieser Holländer die Frohnstainer einschätzt.“
Das Auto fuhr langsamer eine etwas ansteigende Straße hinauf und hielt bald. Ganz nahe dem Walde lag das Häuschen, in dem man allein wohnte. Suse stand vor der Tür, die alte, weißhaarige Suse, die eigentlich zum Haus gehörte. Sie war schon bei den Eltern von Werner Gregorius unentbehrliches Faktotum gewesen. Ulli umarmte die Alte, die kürzlich siebzig geworden, und ging an ihrem Arm ins Haus.
Die Alte schüttelte den Kopf.
„Bist ja eine Weltreisende und so was wie ein Wundertier geworden, Ulli; ich weiß gar nicht recht, ob ich überhaupt noch du zu dir sagen darf. Eigentlich gehört es sich wohl nicht mehr?“
Читать дальше