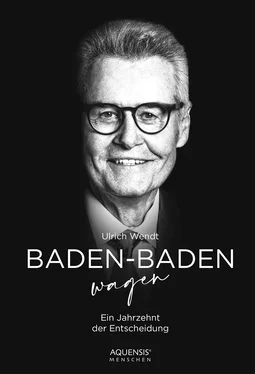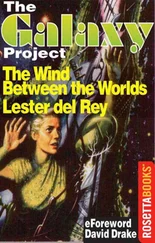3.
MYSTISCHE NATUR – EIN FLUG ÜBER ZEIT UND RAUM
Ich hatte es angedroht, dass wir zeitliche Sprünge, Szenenwechsel, Metaebenen rhythmisieren, „frei schöpferisch“ für einen neuen Blick. Bildlich könnten wir noch einmal die Trinkhalle durchschreiten, um uns von der romantisierenden Kraft der Wandgemälde inspirieren zu lassen. Engelskanzel – Teufelskanzel als Eingangstor über der Wolfsschlucht zum Beispiel passt trefflich. Das Oostal ist mystisch. Ein Blick vom Merkurturm ins Murgtal, Richtung Rastatt, weit über den Rhein hinaus ins Elsass und die Südpfalz hinüber ins Rebland und hinauf zu den Höhenlinien der beiden Tausender Hochkopf und Badener Höhe zeigen uns einen Garten Eden. Es scheint, als hätte hier der liebe Gott an einem auserwählten Tag der Schöpfung eigenhändig mit Gips gespielt und modelliert. Es ist ein Refugium, das schützt und wärmt. Im Herbst, bei Inversion und dauerhaftem Nebel im Rheintal, schenkt es viele zusätzliche Sonnentage. Auch der Wein fühlt sich wohl, zu Füßen des Neuen Schlosses reifen gar Feigen und Zitronen. Alles wurde über Zeit und Generationen hinweg behutsam und liebevoll zu einem einmaligen Großen und Ganzen geformt. Ein kompositorischer Dreiklang von Licht, Wasser und grün durchdringender Natur.
Wo gibt es schon echte Schlösser im Wald? Prächtige Wasserschlösser, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die Quellen mit klarem, weichem Wasser fassten und architektonisch mit in Rotsandstein gemeißeltem Stadtwappen am Merkur, dem Leisberg oder unweit der Batschari-Hütte im lichtenden Morgennebel einen beinahe wagnerianischen Zauber versprühen. Wo gibt es Märcheninseln wie das verwunschene Mariahalden, das der deutschstämmige südamerikanische Kaffee-Goldmark-Millionär Hermann Maria Sielcken im trauten Herchenbachtal mit Herrenhaus, Verwaltungsgebäuden, Badehaus, Gärtnerei, Karpfenteich sowie einer mehrere Kilometer langen von Rhododendron gesäumten massiven Schlossmauer samt schmiedeeisernen Ziergittern einem Schmuckstück gleich krönte? Kein geringerer als Max Grundig erweckte in den 80er-Jahren nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf das Juwel zu neuem Leben. Vom artenreichen Wald der Berge über ausgedehnte, mit Obstbäumen bestandene Wiesen, die als sanfte Hügelzonen zum Talgrund neigende, von Villen gesäumte Straßenzüge begleiten, bis zu den großzügigen privaten Garten- und öffentlichen Parkanlagen entlang der Lichtentaler Allee, zeigt sich ein Ganzes. Es mutet wie Zufall an, ist es aber nicht. Man kann vom Alten Schloss zum Neuen Schloss hinunter, hinüber zur Stourdza-Kapelle mit Villa Friesenberg, von dort zum Schloss Solms wieder hinüber zum Bergschloss und nach diversen weiteren Talsprüngen über die Oos letztlich über die Villa Stroh beim Schloss Seelach enden. Es bildet eine Kette von Harmonie und Ästhetik, einer dem Tal immanenten Choreografie, die diesem Zauber Spiel und Raum eröffnet.
Es sollen einer Überlieferung zufolge die Kelten gewesen sein, die der Oos den Namen „leuchtendes Wasser“ gaben. Die schäumenden Geroldsauer Wasserfälle, im Frühsommer überwölbt von riesigen, blühenden Rhododendren und Baumkronen, die vortreffliche Symbiose der Laeugerschen Garten- und Wohnanlage am Annaberg namens Paradies, die talwärts über ihre Kaskaden mit glucksend spritzendem Merkurwasser den Menschen im Hochsommer ein andalusisches Augenzwinkern spendet. Das alles entspringt der hier rund dreihundert Millionen Jahre jungen Geologie des Schwarzwalds. Und seit dieser Zeit durften die vier Thermalquellen unter dem Florentinerberg dampfend emporsprudeln, was die Kelten bestaunten, die Römer zu Aquae in komfortable Badelandschaften verwandelten. Worin im Mittelalter Schweine brühten, menschliche Laster wie Leiden in den Trögen der Badestuben nicht enttäuscht wurden und dem großen Paracelsus als heißeste und mineralreichste Thermalschüttungen weithin – „Die heißen Wasser von Badin aber sind vollkommener als alles andere“ – eine Messe wert waren. Er behandelte 1526 den kranken Markgraf Philipp I. und man kolportierte, dass er gerne geblieben wäre, wenn man nicht so knauserig gewesen wäre. Ein herber Verlust, als Werbeikone hätte der ebenso namhafte wie umstrittene Medicus bestens zu Baden-Baden gepasst.
DONNERSTAG, 26. MÄRZ 2020
ES IST HEUTE DER VIERTE TAG NACH DEM VORLETZTEN MÄRZSONNTAG – DEM START. DIE SONNE STRAHLT IMMER NOCH. AUCH BEI KÜHLEN TEMPERATUREN BRICHT SICH DER FRÜHLING BAHN. DIE CORONA-ZAHLEN LIEGEN JETZT BEI BALD 40.000 INFIZIERTEN MENSCHEN IN DEUTSCHLAND UND STEIGEN IN STEILER KURVE. IN ITALIEN, SPANIEN UND DEN USA IST ES DRAMATISCH. ES STERBEN DORT DEUTLICH MEHR MENSCHEN ALS IN CHINA. AUS DEM ELSASS, FAST TEIL DER EIGENEN HEIMAT, LIEST MAN HEUTE DIE WACHRÜTTELNDE BOTSCHAFT: MENSCHEN ÜBER 80 JAHRE WERDEN NICHT MEHR KÜNSTLICH BEATMET. DIESE SEUCHE WIRD DIE WELT VERÄNDERN. WIR WOLLEN HOFFEN, DASS ES SICH ZUM GUTEN WENDET UND SOLLTEN JEDER AN SEINEM PLATZ ALLES DAFÜR TUN.
Deutschland strebt der Wiedervereinigung zu. Die Noch-DDR stellte in ihrer ersten demokratischen Wahl am Sonntag, dem 18. März, die Weichen unübersehbar in diese Richtung. An diesem Tag wählte die Kurstadt zeitgleich Ulrich Wendt, 44 Jahre alt, gelernter Jurist, Stabsstellenleiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe von 1978 bis 1981, Bühler Oberbürgermeister von 1981 bis 1989, seit 1988 Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Baden-Baden, im ersten Wahlgang zum neuen Stadtoberhaupt.
Zum 1. Juni 1990 trat er sein Amt an. Sein Vorgänger Dr. Walter Carlein blickte auf eine erfolgreiche 24-jährige Amtszeit zurück. Auf Basis des Stadt- und Kurort-Entwicklungsplans wurde systematisch und zielgerichtet von der grünen Einfahrt in Baden-Oos, der Landesgartenschau mit Schlossbergtangente, der Innenstadtsanierung als Fußgängerzone, der Umgestaltung des Leopoldsplatzes und letztlich mit dem Jahrhundertbauwerk Michaelstunnel 1989 ein veritabler Durchbruch erzielt. Die Kurstadt befreite sich im zentralen Bereich vom Durchgangsverkehr, an dem sie zu ersticken drohte. Die Realisierung der Caracalla-Therme gab der Bäderstadt einen weiteren Schub. Der Krankenhausneubau in Balg, als Meisterstück damals seiner Zeit weit voraus, bewährt sich bis heute als Zentrum des mittelbadischen Klinikums.
Mit der landesweiten Gebietsreform in Baden-Württemberg hatte die Stadt Anfang der 70er-Jahre mit den Reblandgemeinden Steinbach, Neuweier, Varnhalt sowie Sandweier, Haueneberstein und Ebersteinburg die 50.000-Einwohnergrenze überschritten und gewann wichtige Gemarkungsflächen, auch als größter kommunaler Waldbesitzer Deutschlands, hinzu. Ihr vorausgegangen war ein „mittelbadischer Befreiungskampf um Sein oder Nichtsein“. Baden-Baden, bis dahin Stadtkreis wie Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, sollte vom Landkreis Rastatt geschluckt werden! Das lässt sich an gefühlter Grausamkeit nur mit einem Höllenfeuer à la Hieronymus Bosch vergleichen, schlimmer noch als der Abstieg von der Landesliga in die Kreisklasse. Der junge Walter Carlein meisterte das vereint mit dem Baden-Badener Landtagspräsidenten Camill Wurz in buchstäblich letzter Sekunde. Vom Balkon des Theaters wurde es verkündet. Die Baden-Badener applaudierten begeistert, als Ludwig Braun lauthals „Freiheit!“ in die Menge rief. Es fehlte nur noch die Marseillaise.
Leider entwickelte sich die Bäder- und Kurverwaltung, die von den Spielbankgeldern gespeist und mit Kurhaus, Casino, Bädern, Kongressen, Theater, Orchester und Gartenanlagen das internationale Herzstück bildete, krass formuliert, vom Sorgenkind zum Spaltpilz. Diese BKV wurde hälftig von Stadt und Land getragen. Sie hatte glanzvolle Momente erlebt, litt in den 80er-Jahren aber zunehmend unter andauernden Streitigkeiten. Die Übernachtungszahlen, sozusagen die Pulsschlagkurve Baden-Badener Vitalität und seit den 70er-Jahren stagnierend, ließen im Auf und Ab jenseits der konjunkturellen Zyklen keine durchgreifende Besserung erkennen.
Читать дальше