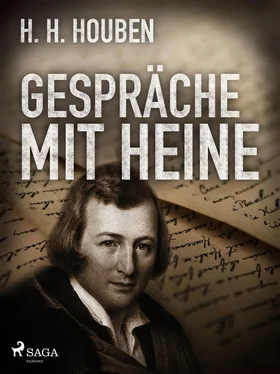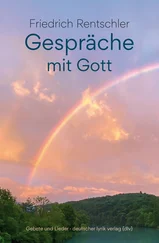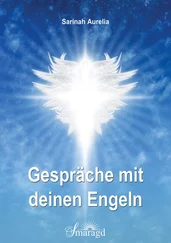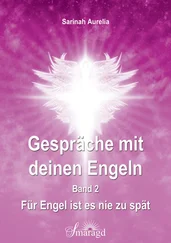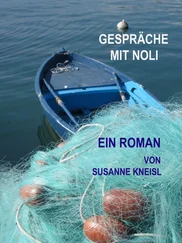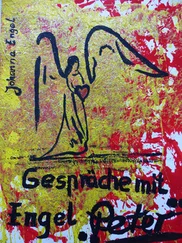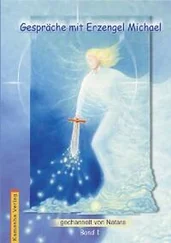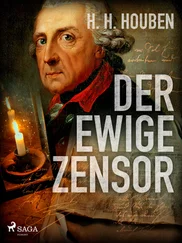Aber ich wollte von Heine reden. Ich kann nicht sagen, daß er damals noch im Werden gewesen sei, im Gegenteil, er war zu jener Zeit ebenso abgeschlossen wie jetzt [1835]: seine vorzüglichste Eigentümlichkeit besteht darin, von Anfang an genau gewußt zu haben, was er will, und dies mit eiserner Konsequenz zu verfolgen; denn, und das ist wahrlich viel gesagt, keiner seiner Freunde und Bekannten ist imstande, ihn auch nur der mindesten Inkonsequenz zu zeihen.
[Hierhin Nr. 817, s. Nachträge.]
April/Mai 1821
An einem Tage des zweiten Vierteljahrs 1821 stand ein junger Mann vor mir, fragend: ob ich Gedichte von ihm aufnehmen wolle, und ich empfing schön geschriebene „Poetische Ausstellungen“.
Da ich ehemals die mir oft und wahrscheinlich gebührend als Vernachlässigung angerechnete Gewohnheit hatte, Fremde, die ihren Namen im Gespräch nicht voranschickten, danach ungefragt zu lassen, sah ich nach der Unterschrift und las: „H. Heine“.
Auf meinen Wink hatte er sich gesetzt, und da er das Wenden seiner Handschrift bemerkte, sagte er: „Ich bin Ihnen völlig unbekannt, will aber durch Sie bekannt werden.“ Ich lachte, erwiderte: „Wenn’s geht, recht gern!“ und las dann lautlos etliche Verse. Heine selbst brachte mir mehrmals diese erste wortkarge Zusammenkunft in Erinnerung, und wie ich endlich nur noch geäußert hätte: „Kommen Sie gefälligst nächsten Sonntag wieder!“ – Begreiflich konnte ich nur wenige Verse gelesen haben, es waren folgende, das Gedicht: „Der Kirchhof“ beginnend:
„Ich kam von meiner Herrin Haus
Und wandelt’ in Wahnsinn und Mitternachtsgraus.
Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will,
Da winken die Gräber ernst und still.
Da winkt’s von des Spielmanns Leichenstein;
Das war der flimmernde Mondenschein.
Da lispelt’s: Lieb’ Bruder, ich komme gleich!
Da steigt’s aus dem Grabe nebelbleich.“
In dem Dichter denke man sich eine von schlottriger Kleidung umhüllte, krankhaft schlanke Gestalt mit blassem, abgemagertem Antlitz, dem Spuren zu frühzeitiger Genüsse nicht mangelten, und man wird es natürlich finden, daß jene Verse und der Eindruck des Persönlichen dem mir Fremden etwas Unheimliches anwehten. Unverkennbar ward mir aber, nachdem ich weiterlas, sein Dichtervermögen, und als Heine wiederkam, erklärte ich mich bedingungsweise zur Aufnahme des Beitrags bereit. In seinen ersten handschriftlichen Gedichten hatte er eine solche Menge von Häkchen an den selbst- und mitlautenden Buchstaben der Worte, und gebrauchte falsche Reime so allbequem, daß ich meinte: er könne die mir gegebenen fünf Gedichte in dieser Beziehung wohl nochmals prüfen. Er entgegnete: das sei alles dem Volkston gemäß, was ich nicht bestritt, aber noch bemerkte: daß ich nur hinweise auf übertriebene Anwendung solcher Herkömmlichkeiten, wenn sie dem Geläufigen eher hinderlich statt fördernd wären. Außerdem verhehlte ich ihm nicht: er sei in dem Gedicht: „Die Brautnacht“ so zügellos mit der Sitte umgegangen, daß manche Zensurlücke unvermeidlich, ich aber den Abdruck verweigern würde, wenn er nicht ein paar Stellen reinigen wolle. Zu nochmaligem Prüfen war er bereit, ich bin überzeugt, nicht mit dem freiesten Entschluß, doch änderte er sehr gewandt. Die ersten fünf [sic!] Gedichte (I. Der Kirchhof. II. Die Minnesänger. III. Gespräche auf der Paderborner Heide. IV. Zwei Sonette an einen Freund) erschienen im Mai 1821. „Die Brautnacht“ folgte erst einen Monat später, weil ich das Veröffentlichen wiederholt verweigern mußte, ehe Heine meine Ansicht befriedigte. Dergleichen hat sich später nur noch ein paarmal zwischen uns ereignet, und ich erzählte dies voraus, weil es den, von Heine erfundenen... Ausdruck „ Gubitzen “ erklärt. Mir blieb indes die Genugtuung, daß er auch in seinen Schriften die Gedichte, bei denen er dem „Gubitzen“ nachgab, völlig so abdrucken ließ, wie der „Gesellschafter“ sie in die Lesewelt eingeführt hatte...
Das zweite, was Heine mir brachte, war der „Sonettenkranz an A. W. v. Schlegel“.
Herbst 1821
Im Herbst 1821 ließ er mich bitten, ihn zu besuchen: er sei krank; als ich zu ihm kam, lag er auf dem Sofa und sah sehr angegriffen aus. Er machte mich zum Vertrauten seiner Zustände und Verhältnisse, soweit sie Einnahme und Ausgabe betrafen, wobei sich jene als nirgends zureichend, und infolgedessen eine Schuldenlast erwies. Da er auch – mir gegenüber zum erstenmal – den Millionär Salomon Heine in Hamburg seinen Oheim nannte, fragte ich: weshalb er sich in Geldverlegenheit nicht dorthin wende? Ich erfuhr nun, der Oheim habe schon mehrmals aus seiner Kasse Bedeutendes getan, wolle aber jetzt den Neffen sich selber und seinem Schicksal überlassen. – Ich wußte, daß der Berliner Bankier Leonhard Lipke mit Salomon Heine in lebhafter Geschäftsverbindung war, ging zu jenem, unterrichtete ihn davon, daß ein talentreicher Neffe des geldreichen Oheims in andringendster Bedürftigkeit sei, dieser also, was auch dazwischen läge, gewiß etwas tun würde für den Verwandten. Der von mir zur Vermittlung Angesprochene hegte darüber keinen Zweifel, half auch mit einem Vorschuß, versichernd: „Salomon Heine kommt mir unzweifelhaft dafür auf!“ Zugleich sagte er mir: sein Hamburger Geschäftsfreund habe nächstens in Berlin zu tun, er wolle mir anzeigen, wann er bei ihm anzutreffen wäre und ich mit förderlich werden könne; dies fügte sich aber erst im Frühling 1822. – Salomon Heine hörte meinen Bericht ruhig an, verhehlte jedoch nicht die Unzufriedenheit mit dem Neffen, und seine Gründe waren zureichend genug: schon oft waren gewichtige Unterstützungen nötig gewesen, ohne den erhofften Beweis zu gewinnen, er werde sich einer ernsten Richtung auf der Lebensbahn zuwenden. So erklärte sich der ehrenwerte Handelsherr in schlichter Art ohne Aufwallung und Wortgepränge, mit Bekräftigung durch Tatsachen, wonach der Erfahrungsvolle meinte: es bliebe wohl nur übrig, dem Sprichwort zu folgen: Wer nicht hören will muß fühlen. Ich entgegnete, was sich beihilflich entgegnen ließ: eine dichterische Natur sei oft zuwenig vertraut mit den Bedingungen der Wirklichkeit, bis diese sich doch ihr Recht verschaffe, und schloß mit der Ansicht: ein solcher Oheim dürfe einen solchen Neffen, bei dem der gewöhnliche Maßstab sich verlängern müsse, nicht verlassen. – „Hab’s auch nie gewollt; aber zu lernen hat er doch, daß man nützen soll das Geld, jeder nach seinem Beruf!“ so äußerte sich endlich der Angeregte, und zu Lipke gewendet fügte er hinzu: „Der Herr behauptet, es könne da verfallen ein großes Genie, ich will’s glauben. Zahlen Sie meinem Neffen jetzt zweihundert Taler gleich, dann jährlich fünfhundert Taler auf drei Jahre, und Weiteres mögen wir erleben.“ – Das war meine einzige Zusammenkunft mit Salomon Heine, und ich gedenke seines Behabens noch immer gern, da zumal unser Gespräch der Anlaß wurde zur dauernden Versöhnung des in seiner Weise gediegenen Oheims mit dem fast in jeder Weise flattrigen Neffen.
Der kranke Heinrich hatte mir auch ein Heft gezeigt, Gedichte enthaltend, „die ich selber scharf gefeilt habe, Sie wissen ja !“ warf er etwas anzüglich betont hin; „ein Bändchen würden sie füllen, ich finde aber keinen Verleger“. Ich vermittelte ihm die Maurersche Buchhandlung, und Ende 1821 (mit der Jahreszahl 1822) wurden „Gedichte von H. Heine“ ausgegeben.
[Nach Heines Brief an Moser vom 23. August 1823 hatte ihm der Onkel im Oktober 1822 durch Lipke auf zwei Jahre je 400 Taler versprochen; hinterher wollte er aber nur 500 Taler insgesamt zahlen, und eine „dauernde Versöhnung“ zwischen Onkel und Neffe ergab sich erst fünfzehn Jahre später.]
Читать дальше