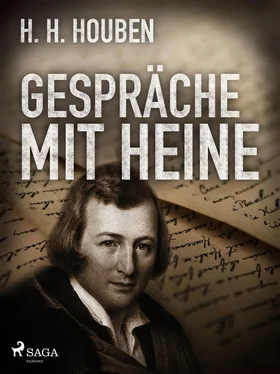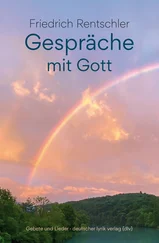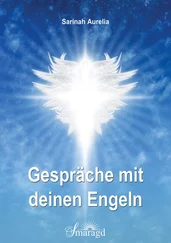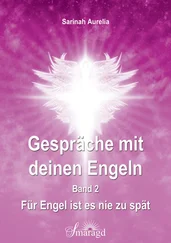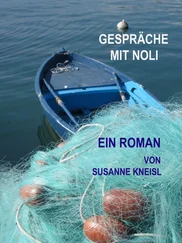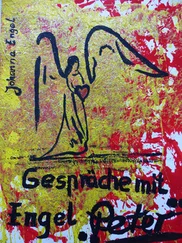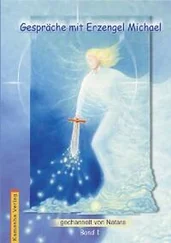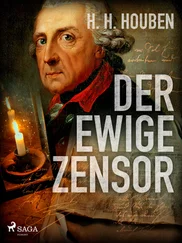Ende 1821
Von der Aufnahme seines ersten Liederbändchens, obwohl günstig, war Heine nicht befriedigt: er verlangte rasch zündende Wirkung... Ich hörte von Heine allerlei Ausfälle, die gesteigerte Mißstimmung verrieten hinsichtlich schriftstellerischer Erfolge, wohl auch von Einfluß waren auf mehrere seiner späteren Erzeugnisse. „Zur Anerkennung des neuen Genies und Talents muß man das abgestumpfte deutsche Gemüt foltern“, äußerte er, und nachdem ich einst über eines seiner Lieder, das nach Siegwartschem Anfange mit des Weiberhasses stachlichter Keule dreinschlug, zweideutig lachen mußte, lachte er zwar ebenfalls, bemerkte jedoch: „Bei den Deutschen wird man leichter vergessen als berühmt, jetzt zumal; sie haben in der Gefühlswonne so geschwelgt, daß zu ihrer Aufregung derbe Mittel unerläßlich sind, ganz so, wie Kirmeslust ihnen erst vollständig ist, wenn man sich zum Kehraus noch mit Schemelbeinen traktierte.“
[Hierhin Nr. 818, s. Nachträge.]
1821/22
Zu Berlin bewegte sich Elise [v. Hohenhausen geb. v. Ochs] in einem Kreise, welcher die Bewunderung für die schöne Frau bereitwillig genug auf die Erzeugnisse ihrer Muse übertrug, was auch dann geschehen sein würde, wenn diese minderen Wert besessen hätten, als sie wirklich besaßen. Heinrich Heine kam ins Haus, als Dichter der Welt noch unbekannt, aber von einer Anzahl bedeutender Männer schon für eine große Zukunft vorgemerkt. Auch Helmina [v. Chezy, meine Mutter] stimmte diesem Urteil bei, nicht etwa um der Gedichte halber, die Heine bereits geschrieben, sondern weil seine braunen Augen so schwärmerisch in feuchtem Glanze schwammen.
[Die Schriftstellerin Elise v. Hohenhausen aus Minden i. W. lebte 1820–24 in Berlin und hielt einen „Salon“, in dem Heine verkehrte; ihr Mann war Regierungsrat i. R. und figuriert in Heines Briefen als der „Ochs“, vgl. an Keller 15. Juni 1822.]
39. Friederike von Hohenhausen 51
1821/22
Er war klein und schmächtig von Gestalt, blond und blaß, ohne irgendeinen hervorstechenden Zug im Gesicht zu haben, doch von eigentümlichem Gepräge, so daß man gleich aufmerksam auf ihn wurde und ihn nicht leicht wieder vergaß. Sein Wesen war damals noch weich, der Stachel des Sarkasmus noch nicht ausgebildet, der später die Rose seiner Poesie umdornte. Er war selbst mehr empfindlich gegen Spott, als aufgelegt, ihn auszuüben. Die guten Empfindungen, die er später oft verlachte, fanden ein wohlklingendes Echo in seiner Seele.
[Friederike war die Tochter der Elise von Hohenhausen und 1812 geboren; was sie über jene Zeit erzählt, sind wohl hauptsächlich Erinnerungen ihrer Mutter.]
40. Friederike von Hohenhausen 51
1822/23
Jeder Dienstag führte dort [im Hause der Dichterin Elise von Hohenhausen] die genügsamen Berliner bei einer Tasse Tee zusammen. Viele literarische Notabilitäten waren darunter:Varnhagen, mit den feinen, aristokratischen Mienen; Chamisso, dem das lange, graue Lockenhaar phantastisch um das magere, aber edle Gesicht wallte; Eduard Gans, dessen auffallend schöner Kopf mit dem frischen Kolorit, den stolz gewölbten Brauen über den dunklen Augen, an einen geistigen Antinous erinnerte; Bendavid, der liebenswürdige Philosoph und Schüler von Moses Mendelssohn, übersprudelnd von Witz und köstlich erzählten Anekdoten. Dann damals noch junger Nachwuchs, jetzt lauter Männer in grauen Haaren und hohen Würden: der Maler Wilhelm Hensel, jetzt Professor; Leopold von Ledebur, damals ein studierender Leutnant, jetzt ein bekannter Historiograph und Direktor der Kunstkammer im Berliner Museum; der Dichter Apollonius von Maltitz, jetzt russischer Gesandter in Weimar; Graf Georg Blankensee, der ritterliche Sänger und Epigone Byrons, jetzt Mitglied der Ersten Kammer, usw. Unter den Frauen nahm Rahel natürlich den ersten Platz ein; neben ihr blühte damals ihre wunderschöne Schwägerin, Friederike Robert, Heines angebetete Muse... Amalie v. Helwig, geb. v. Imhoff, die Übersetzerin der Frithjofsage; Helmina v. Chezy, die fahrende Meistersängerin jener Zeit, gehörten nebst noch vielen geistreichen Frauen aus der höheren Berliner Gesellschaft, z. B. Frau v. Bardeleben, die Freundin Raumers, Frau v. Waldow, jetzt die Schwiegermutter A. v. Sternbergs, zu diesem Kreise. Heine las dort sein eben erschienenes „Lyrisches Intermezzo“, seinen „Ratcliff“ und „Almansor“ vor. Er mußte sich manche Ausstellung, manchen Tadel gefallen lassen, namentlich erfuhr er häufig einige Persiflage über seine poetische Sentimentalität, die wenige Jahre später ihm so warme Sympathie in den Herzen der Jugend erweckt hat. Ein Gedicht mit dem Schlusse: „Und laut aufweinend stürz’ ich mich zu ihren süßen Füßen“ fand eine so lachende Opposition, daß er es nicht zum Druck gelangen ließ. Die Meinungen über sein Talent waren noch sehr geteilt, die wenigsten hatten eine Ahnung von seinem dereinstigen unbestrittenen Dichterruhme. Elise von Hohenhausen, welche damals mit ihren Übersetzungen des gefeierten Briten, Lord Byron, beschäftigt war, proklamierte ihn zuerst als dessen Nachfolger in Deutschland, fand aber viel Widerspruch; bei Heine jedoch sicherte ihr diese Anerkennung eine unvergängliche Dankbarkeit.
[Auch hier schreibt die Tochter hauptsächlich die Erinnerungen ihrer Mutter. Das Gedicht „Allnächtlich im Traume seh’ ich dich“ mit den oben erwähnten Schlußzeilen war schon am 9. Oktober 1822 im „Gesellschafter“ erschienen und wurde dann in das „Lyrische Intermezzo“ aufgenommen; Heine hat es also keineswegs unterdrückt.]
April 1822
Der Friede zwischen Neffen und Oheim hatte sich durch dessen Güte angebahnt, und Heine beabsichtigte Reiseausflüge nach verschiedener Richtung, auch nach Hamburg, was sich etwas verzögerte durch eine Herausforderung. Er kam eines Tages zu mir, mich um Rat ersuchend, nachdem er berichtete: Baron v. Schilling habe sich beleidigt gefunden über eine öffentliche Äußerung, und nun sollten die Waffen zur Ausgleichung dienen... Meinerseits verweigerte ich die Einmischung, nannte aber einen, der zu solchem Zwischengeschäft tauge; nun entstand ein Übereinkommen, und Heine bat dringend um raschen Abdruck folgender Erklärung:
„Mit Bedauern habe ich erfahren, daß zwei Aufsätze von mir, überschrieben ‚Briefe aus Berlin‘ (Nr. 6, 7, 16 des zum ‚Rheinisch-Westphälischen Anzeiger‘ gehörigen ‚Kunst und Wissenschaftsblattes‘) auf eine Art ausgelegt werden, die dem Herrn von Schilling verletzend sein muß. Da es nie meine Absicht war, ihn zu kränken, so erkläre ich hiermit, daß es mir herzlich leid ist, wenn ich zufälligerweise dazu Anlaß gegeben hätte, daß ich alles dahin Gehörige zurücknehme, und daß es bloß der Zufall war, wodurch jetzt einige Worte auf den Herrn Baron von Schilling bezogen werden konnten, die ihn nie hätten treffen können, wenn eine Stelle in jenen Briefen gedruckt worden wäre, die aus Delikatesse unterdrückt werden mußte. Dieses kann der geehrte Redakteur jener Zeitschrift bezeugen, und ich fühle mich verpflichtet, durch dieses freimütige Bekenntnis der Wahrheit allen Stoff zu Mißverständnis und öffentlichem Federkriege fortzuräumen.
Berlin, den 3. Mai 1822.
H. Heine.“
Zugleich brachte er mir das angefügt zu lesende, ihm geweihte Sonett, wünschend, daß es mit jener Beschwichtigung in demselben Blatte erscheinen möge:
„Das Traumbild.
An H. Heine.
Von Morpheus Armen war ich sanft umfangen,
Als Phantasie, in eines Traumes Hülle,
Ein Bild mir wies in seltner Schönheitsfülle:
Bezaubert blieb die Seele daran hangen.
Читать дальше