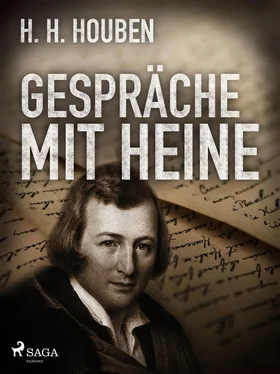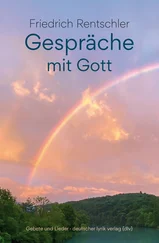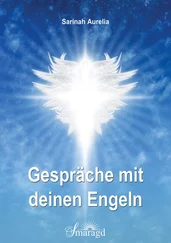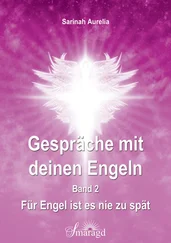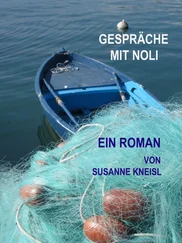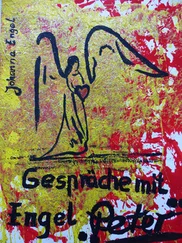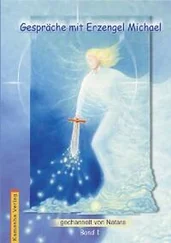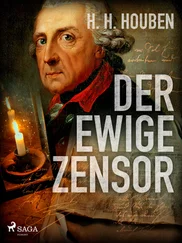Späterhin in seinem Leben, so oft von einem Menschen die Rede war, der sehr viel Glück hatte, sagte er nichts weiter als: „Hat das Barbierchen Glück!“ und erzählte dann ganz gemütlich, wie er seinen alten Samtrock und sein Barbier den neuen behalten hat.
[Strodtmann (I, 681) zweifelt diese Anekdote an, da Heine, nach dem Zeugnis von Neunzig, Steinmann und andern, nie einen altdeutschen Studentenrock getragen habe. Aber auch Maria Embden-Heine berichtet den Vorfall und fügt noch hinzu, daß seitdem die Redensart: „Hat das Barbierchen Glück gehabt!“ in der Familie sprichwörtlich geworden sei. Von Neunzig erfuhr Strodtmann einen andern, alltäglicheren Vorfall, der wohl jener Anekdote zugrunde liegt: „Eines Morgens ward Neunzig von einem Landsmanne aufgesucht, der um eine kleine Wegzehrung bat und dann auch nach Heines Wohnung frug. Neunzig zeigte ihm das Haus. Nachmittags kam Heine in sehr aufgeregter Stimmung hinüber und erzählte, sein Hauswirt habe einen fremden Menschen, den er für einen Studenten angesehn, in sein Zimmer gelassen, und dieser habe ihm seinen neuen Rock gestohlen. Der satirische Zug verschwand dabei nicht, er verzog sich vielmehr zu einem höhnischen Grinsen.“ Wenn der Pseudostudent seines Handwerks Barbier war, bestände wenigstens der traditionelle Familienscherz zu Recht.]
1820
Als Heine in Bonn Jura studierte, kam er in der Ferienzeit nach Düsseldorf herüber. Er war sehr milde, sanft und weichherzig, aber in Zorn gebracht äußerst heftig, selbst gegen seine Gewohnheit manchmal etwas gewalttätig. Ich erinnere mich noch, daß er über die Unverschämtheit und grobe Prellerei eines Karrenschiebers, der seinen Koffer von der Post ins elterliche Haus bringen sollte, außer sich geriet; ein anderer hätte dem groben Lümmel eine Ohrfeige gegeben. Heinrich, bleich vor Zorn, faßte sich, zahlte ruhig das ausgepreßte Geld, zupfte aber mit aller Vehemenz des Kerls großen schwarzen Backenbart, indem er freundlich zu ihm sagte: „Ich glaubte, mein Bester, Sie trügen einen falschen Bart.“
So habe ich, erzählte er später, meinem schrecklichen Ärger Luft gemacht, ohne daß der Kerl mich verklage konnte.
1820
In den sonnigen Mittagsstunden liebte Heinrich in unserm Hausgarten zu promenieren. Auf diesen Spaziergangen war ich oft im Gespräche an seiner Seite, und hier flößte er dem dreizehnjährigen Knaben die Liebe zur Poesie, zum Wissen ein; hier schöpfte ich zuerst aus dem reichen Borne seiner poetischen Seele. Der vortreffliche Bruder, frei von jedem Egoismus, bedauerte nicht die durch mich verlorenen Stunden, wenn ich auch oft wenig von seinen Mitteilungen verstand.
Heinrich liebte sehr das Arbeiten und Treiben der Spinnen zu beobachten. Einstmals standen wir vor einem großen wunderbar gearbeiteten Netze einer in der Mitte desselben lauernden mächtigen Kreuzspinne. „Sieh, Max,“ sagte er und zeigte auf die gefangenen und ausgesogenen Fliegen in dem Netze, „sieh, so geht es auch dem Dummen in der Welt. Die Spinne ist unser Lebensfeind, das Netz seine falschen und verlockenden Worte – aber der Kluge, der Entschlossene macht es so“, und damit schlug er mit einem Stocke das ganze schöne Netz rasch herunter. Auf der Erde kroch die große Kreuzspinne, er zeigte auf sie hin und sagte zu mir: „Töte sie ja nicht! Wenn man des Feindes Werk gründlich vernichtet, verstehst du, wenn man seine Pläne gänzlich vereitelt hat, braucht man ihn nicht mehr zu töten, man läßt ihn laufen.“
1820
Von meiner frühesten Jugend an liebte ich die deutschen Dramatiker; viel mag zu dieser Neigung beigetragen haben, daß ich, fast Kind noch, sehr oft in das Theater mitgenommen wurde. Es war dies die Zeit, wo die Ritterspiele auf der Bühne in vollem Flor standen. „Johanna von Montfaucon“, „Die Kreuzfahrer“, „Die Sonnenjungfrau“ usw. waren meine Lieblingslektüre. Ich war damals dreizehn Jahre alt. Mein Bruder Heinrich bemerkte ungern diese meine Lektüre.
„Max,“ sagte er eines Tages zu mir, „solche Bücher verderben den Geschmack, ich werde dir ein anderes Buch schenken, damit magst du dich in deinen Freistunden beschäftigen. Es ist auch ein Theaterstück.“ Bei diesen Worten nahm er von seinem Tisch ein kleines, in schwarze Pappe eingebundenes Büchlein und sagte: „Dies schenke ich dir.“ Ich schlug des Büchleins Decke auf und las zum erstenmal den Titel: „Faust, von Goethe. Der Tragödie erster Teil.“
Ich blickte in die ersten Blätter hinein, die den wunderschönen Prolog enthalten, dann, nach echter Knabenart, schlug ich die letzte Seite auf, wo die Worte: „Heinrich, her zu mir,“ – „Sie ist gerettet“, mir so rätselhaft klangen. Ich sah meinen Bruder ganz erstarrt an, als wie einer, der da sagen wollte: „ Die Komödie begreife ich nicht.“ Er nahm darauf das Buch zur Hand, griff rasch zur Feder und schrieb folgendes auf die innere Seite des Deckels:
„Dieses Buch sei dir empfohlen,
Lese nur, wenn du auch irrst:
Doch wenn du’s verstehen wirst,
Wird dich auch der Teufel holen.“
[Die Schlußworte des „Faust“ sind falsch zitiert; Max Heine tut’s nun mal nie anders.]
31. Johann Baptist Rousseau 174
1820
Mit besonderer Liebe studierte er Byrons Schriften, und nicht zu leugnen ist es, daß sich zwischen beiden eine geistige Wahlverwandtschaft findet. Das fühlte er damals auch selbst, und erkannte es, sich zu Freunden äußernd, oftmals an.
[Heine übersetzte damals Stücke aus Byrons „Manfred“ und „Childe Harold“; sie erschienen in seinen „Gedichten“ 1822.]
32. Johann Baptist Rousseau 174
Herbst 1820
Den Herbst 1820 brachte Heine in Beuel zu, dem freundlichen, Bonn gegenüber liegenden Dörflein, und begann dort in tiefster Zurückgezogenheit seine Tragödie „Almansor“... Er las es mir Szene vor Szene, wie es ihm eben aus der Feder geflossen war, vor, und gab mir zugleich manche gute, ihm durch die Praxis klar gewordene Lehre über die mögliche Formausbildung des fünffüßigen Jambus.
[Ende Oktober 1820 ging Heine nach Göttingen.]
Januar 1821
[Mündliche Mitteilung an Heinrich Bender:] Heine wurde aus der Göttinger Burschenschaft wegen Vergehens gegen die Keuschheit, begangen in der „Knallhütte“ zu Bowenden, ausgestoßen, und, da er trotzdem, als ob nichts vorgefallen wäre, am folgenden Tage auf dem Burschenhause erschien, aus diesem mit Gewalt hinausgeworfen.
[Am 21. Februar 1821 wurde Heine wegen Übertretung der Duellgesetze auf ein halbes Jahr relegiert. Er kehrte zunächst nach Hamburg zurück und blieb den Sommer über bei seinen Eltern, die damals in Oldesloe im südlichen Holstein lebten.]
März 1821
Vor vierzehn Jahren hatte ich Heine in Hamburg kennenlernen. Beide kaum von der Universität kommend, waren wir eben in das Leben getreten, mit gigantischen Hoffnungen und Plänen und einem gemeinschaftlichen großartigen Schmerz über Freunde wie Feinde, den jeder Eingeweihte leicht erraten wird; die übrigen geht er nichts an. Heines Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo waren soeben erschienen; die Leute starrten im allgemeinen das Buch an, nur wenige ahnten die Tiefe, die in demselben lag, den gepreßten Stolz, der sich großartig Luft machte, das beseligende Gefühl geistiger Herrschaft. Man wußte nur von dem Dichter, daß er sehr witzig und malitiös sei; was sollte man auch in dem guten Hamburg und vorzüglich in dem Kreise, in welchem Heine sich, durch Verhältnisse gebunden, bewegen mußte, und in dem ich mich, durch ähnliche Verhältnisse gefesselt, gleichfalls* befand, mehr von ihm wissen? In seinem Wesen lag etwas Zugvogelartiges, das die guten Hamburger, obwohl eine Nation, welche Welthandel treibt, nicht eben sehr lieben; sie können nicht begreifen, daß man in Hamburg ißt, trinkt und schläft und eigentlich am Ganges zu Hause ist, und die Sehnsucht nach der wirklichen Heimat nie zu beschwichtigen vermag...
Читать дальше