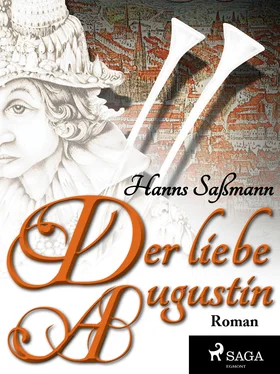Das Mariandl brachte die Frühstücksschokolade ans Bett; an der Türe klopfte es zweimal kurz, das Zeichen des Marquis, der seine Gattin jeden Morgen zu besuchen pflegte. Zärtlich neigte er sich über die Hand seiner Gemahlin und erbat sich Verzeihung, dass das Lever des Kaisers ihn zu lange aufgehalten. Die Marquise winkte dem Mariandl. Die Kammerzofe kam heran und nahm das Tablett fort.
„Welche Toilette wünschen Frau Marquise heute?“ fragte sie und blieb stehen.
„Die neue Robe transparente, die Silberbrokat mit die schwarze Spitzen“, erwiderte die Marquise, und das Mariandl verschwand. Der Marquis zog ein Taburett an das Bett seiner Gemahlin und setzte sich. Wie jeden Morgen berichtete er von der Stimmung in den intimsten Gemächern des Kaisers, wer von den Herren des Hofstaats zu ihrer Partei übergegangen oder von dieser abgefallen war, denn das wechselte jeden Tag. Das sei der Grund, warum man nicht ans Ziel käme, meinte die Marquise und warf ihre berühmt schönen Beine über den Rand des breiten Bettes. Seit Monaten kämpfe man darum, am Wiener Hofe die Maitresse en titre zu werden, die Schuhe mit den roten Absätzen tragen zu dürfen. Warum hatte man das gleiche Ziel nicht am Hofe des Sonnenkönigs zu Versailles erreicht? So fragte unvorsichtig Marquis de Valais. Die Marquise fauchte gereizt zurück, sie habe keine Lust gehabt, sich von der Marquise de Montespan täglich am Leben bedroht zu sehen. Der Gemahl meinte, der kleine Versuch der Damen, einander durch Gift zu beseitigen, sei nicht der Rede wert gewesen. Solche Scherze seien allgemein üblich in Paris. Die berühmte Voisin habe dem ganzen Hofstaat von Versailles ihre erlesenen Gifte geliefert; wer den doppelten Preis bezahlte, hätte auch die Gegengifte dazubekommen.
Schaudernd sank die Marquise in ihre Kissen zurück. Sie erinnerte sich an die Nacht ihrer geheimnisvollen Erkrankung im Damenflügel von Versailles und fasste wie Schutz suchend nach der Hand ihres Gemahls. Dieser hatte sich auf den Rand des Bettes niedergelassen; in schöner Eintracht sassen die beiden Gatten beisammen und erwogen wie jeden Morgen ihre Aussichten am Wiener Hofe. Die Marquise war etwas traurig, der Marquis tröstete sie. Hier habe sie mit keiner anerkannten Mätresse, vor allem mit keiner Montespan zu kämpfen, denn der Kaiser sei bisher ein vorbildlicher Gatte gewesen. Aber gerade die fromme Treue des Kaisers, der anscheinend mit jeder Gedankensünde in den Beichtstuhl oder in die Busskammer flüchte, gerade diese Gattentreue sei eine grosse Chance. Aus treuen Ehemännern würden bekanntlich ebenso treue Liebhaber. Und wenn die Marquise es verstünde, den Kaiser immer zu beschäftigen, ihm keine Ruhe zu gönnen, wenn sie nicht aufhöre, ihn mit Wünschen zu verfolgen, dann würde alles gut gehen. Sie müsse darin sehr erfinderisch und kapriziös sein. Nun lachte die Marquise. Sie habe den Kaiser um ein Seidenhemd mit vielen Spitzen aus Mailand gebeten, das müsse mit einem Kurier heute früh gebracht werden. Sie wolle es nach dem Bade anziehen. Der Kurier müsse schon auf dem Wege nach Wien sein. Anerkennend äusserte sich der Marquis, solche Launen seien der sicherste Weg zur Macht über einen Mann.
„Sie sehen, mon cher, ich verstehe es schon, ihn mit den meinen zu beschäftigen“, lächelte die Marquise.
Ein leichtes Pochen an der Tür liess den Marquis aufstehen. Er küsste abermals die Hand seiner Gemahlin, versicherte ihr, dass sie nicht nur ein Engel an Schönheit, sondern auch eine Göttin an Weisheit sei. Dann zog er sich gegen die Tür zurück, durch die jetzt das Mariandl eintrat.
„Das Bad für Madame ist bereit“, meldete Mariandl und knickste vor dem Marquis, der sich höflich gegen sie verbeugte, denn das Mariandl war bildhübsch.
In der grossen Hofküche drehten sich die Bratspiesse. An jedem der zwanzig Spiesse steckten fünf schöne gerundete Hühner, die Küchenjungen träufelten immer wieder das abtropfende Fett darüber. Wolfsgruber schritt von Spiess zu Spiess. Hinter ihm ging ein Hilfskoch, der einen Korb trug. Eine Anzahl gebratener Hühner lag bereits darin, sie hatten nicht die Gnade des Herrn Hofkochs gefunden. Jetzt musste das kaiserliche Huhn gewählt werden, es war höchste Zeit. Kritisch besah Wolfsgruber Stück um Stück der in fettem Glanz brutzelnden Hühner.
„Zu blass!“ rief er erbost. „Das da ist wieder nicht saftig genug! Weg damit! Das hier ist zu braun! Das da ist wieder ganz gelb! Nicht so langsam drehen! Mehr Fett aufgiessen! Nie könnt ihr die richtige Farbe herauskriegen!“ schimpfte er dabei. „Und es braucht doch nichts als ein bisserl Aufmerksamkeit und Liebe!“
In der Küche verbreitete sich jetzt grosse Nervosität. Die elfte Stunde, die Zeit des Mittagmahls der Kaiserlichen Majestät, rückte heran. Und noch immer hatte Herr Wolfsgruber nicht das richtige Huhn für den Kaiser gefunden. Er schwitzte Fett wie die Hühner an seinen zwanzig Spiessen.
„Alles nichts wert! Am Rücken muss es braun sein wie eine reife Haselnuss!“ rief er und suchte in seinen Taschen nach der Haselnuss, die er stets bei sich trug. Als er sie nicht gleich fand, rastete er seinen Körper ab und brüllte: „Wo hab’ ich denn diese vertrackte Nuss?“ Dann zog er sie aus der Hosentasche, in der sie sich verkrochen hatte. „Da ist sie ja! Her mit dem nächsten Spiess!“
Mit grosser Aufmerksamkeit verglich nun der Hofkoch seine Haselnuss mit der schönen braunen Färbung der vorgezeigten Hühner. Ein zweites Mal unterzog er die fettglänzenden Vögel einer allergenauesten Prüfung. Dann seufzte er befriedigt auf.
„Endlich! Da hier, das ist endlich, wie es sein soll und sein muss. Schnell herunter vom Spiess! Und gleich für die kaiserliche Tafel anrichten!“
Der Hofkoch wischte sich den Schweiss von der Stirne. Da kam Mariandl die Treppe herab. Wolfsgruber sah seiner Nichte freundlich entgegen.
„Hast leicht schon Feierabend, Mädel? Am hellichten Vormittag?“
„Madame badet!“ lachte das Mariandl. „Das müsst Ihr doch wissen, Herr Oheim!“
„Richtig“, erinnerte sich Herr Wolfsgruber. „Über diesen verfluchten Hühnern habe ich das ganz vergessen.“
„Isst denn der Kaiser sein Huhn jeden Tag?“ wunderte sich Mariandl.
„Weiss ich’s?“ erboste sich Wolfsgruber von neuem. „Auf den Tisch muss es jedenfalls kommen. Aber es ist höchste Zeit, dass es wirklich hinkommt.“ Er erhob sich und ging zum Serviertisch hinüber, auf dem das silberne Tablett mit dem Huhn des Kaisers stand. Das Mariandl folgte ihm.
Ein Küchenjunge, der dem Herrn Hofkoch ein Glas Wein brachte, hielt ihn auf. Es war das übliche Glas Bordeaux, das Herr Wolfsgruber jeden Tag nach der Fertigstellung des kaiserlichen Mahles zu sich zu nehmen pflegte. Es gab ihm einen Teil der verlorenen Lebensgeister wieder.
Während der Oheim sich dem Genuss seines Weins widmete, betrachtete Mariandl das Huhn auf der silbernen Platte. Dann sah sie sich vorsichtig um. Der Oheim trank langsam Schluck um Schluck, denn er war ein grosser Weinkenner, und der kaiserliche Keller barg edle Sorten. Rasch griff das Mariandl unter den Serviertisch und zog ein Körbchen hervor. Blitzschnell verschwand das mit so grosser Mühe ausgesuchte kaiserliche Huhn darin. Aus dem Korbe mit den von der allerhöchsten Tafel verbannten Hühnern griff Mariandl auf gut Glück eins heraus und legte es appetitlich auf der silbernen Platte zurecht. Dann rief sie fröhlich: „Auf Wiedersehen, Oheim!“ und enteilte über die Treppe.
Herr Wolfsgruber trank mit Genuss den letzten Schluck. „Antreten!“ rief er dann mit Donnerstimme durch sein Reich. Sofort sammelten sich alle Köche, Hilfsköche und Küchenjungen vor Wolfsgruber. Sie standen nach dem Grade ihrer Stellung gestaffelt, die Oberköche voran, dann die Unterköche, die Hilfsköche, ganz hinten stiessen sich die Küchenjungen. In vollster Würde sprach der Hofkoch: „Das Huhn für Seine Majestät ist glücklich ausgewählt. Die restlichen neunundneunzig Hühner bekommen heute die Kammerherren als Handsalbe, die Köpf’ und die Ingeweide kriegen die Stallburschen als Trinkgeld“, fuhr Wolfsgruber fort. „Die Haxen und die übrigen Knochen, die von der Hoftafel zurückkommen, kriegt der Weinkeller „Zum süssen Löchl“, die geben immer noch ein sehr feines Hühnersupperl für die armen Leut’. Ist alles klar?“
Читать дальше