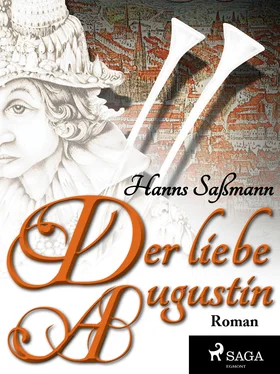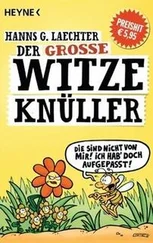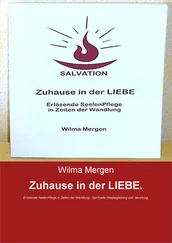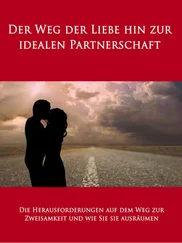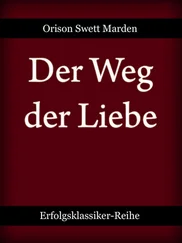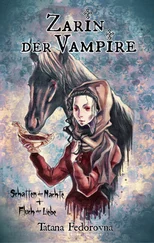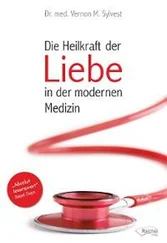Der Obrist stampfte seine sporenklirrenden Beine rechts und links gegrätscht auseinander und marschierte ab. Der Oberstkämmerer wandte sich wieder dem Inspector musicae zu.
„Sie müssen doch etwas vorsichtiger sein, wenn Sie auf die Suche gehen nach musikalischen Themen für den Kaiser“, sagte er etwas von oben herab zu dem verzweifelten Grafen Trautensberg. „Strassenmusizi spielen das Lied, das der Kaiser heute nacht komponiert hat! Blamabel für Sie, mon cher, sehr blamabel!“
„Mein Gott!“ seufzte der Musikgraf, „was sage ich nur Seiner Majestät?“
Der Oberstkämmerer zuckte unbekümmert die Achseln. „Ziehen Sie sich heraus, wie Sie können. Man sieht, wie frech dieses Volk geworden ist. Aber das kommt davon, dass die Musik am Hofe so geliebt und gepflegt wird. Seit Seine Majestät selbst mit seinen Musizi musiziert und für sie komponiert, hält ihn die ganze Wiener Bänkelsängergilde für einen von ihrer Zunft!“
Der Oberstjägermeister, der nun auch in die dritte Antichambre trat, stellte sich jetzt breitbeinig neben den Inspector musicae ans Fenster. „Überall Musik! Von oben, von unten!“ So schimpfte er: „Anstatt die Zeit mit fröhlichem Weidwerk zu verbringen, wird sie mit diesem welschen Gedudel vertan, das alles verweichlicht. Harfengezirpe und Geigengezupfe! Wir machen zuviel Musik! Das macht alles schlaff und verzärtelt, das ganze Leben hier wird zu einem übersüssen Brei. Wir machen zuviel Musik bei Hof!“
Aus der zweiten Antikamera zirpte jetzt ein Madrigal von Monteverdi. Dort sass der Kaiser mit hängender Unterlippe und lauschte dem Spiel seiner Hofmusizi, die ihn wie Schatten durch den Tag begleiteten. Mit Musik erhob sich Seine Majestät aus dem Schlaf, mit Musik speiste sie, mit Musik ging sie wieder zu Bett.
In den gewölbten Hallen der kaiserlichen Hofküche standen auf einem Tisch in einer der tiefen Fensternischen zwei derbe Männerbeine. Sie gehörten dem kaiserlichen Hofkoch Thomas Wolfsgruber, der durch die halbkreisrunden Küchenfenster knapp über den Boden des Burghofs sah. Er hatte mit Vergnügen dem Gesang der beiden Musikanten oben im Burghof gelauscht:
„Wer frisst im Land den Viehstand auf?
Ja, wer? Ja, wer?
Wer sauft den ganzen Keller drauf?
Ja, wer? Ja, wer?“
Es war ein bissiges Spottlied auf die schöne Marquise Hélène de Valais, das die zwei Bänkelsänger vor der Kaiserburg eben beendeten.
Jetzt stieg Thomas Wolfsgruber vom Tisch herab und maulte zu seinem Freunde, dem Tellermeister, dem er gerade die Speisenfolge des Tages diktieren wollte: „Wahr ist’s, die Wiener murren gegen die Verschwendung bei Hofe. Kein Wunder! Sie müssen sich den Ranzen immer enger schnüren, damit er nicht zu laut knurrt, und bei Hofe wird gewüstet!“
Der Tellermeister sah sich etwas ängstlich um, dann nickte er und sagte: „Verwüstet? Verludert wird alles für die futtergierigen Pariser Schmerbäuche. Der eine von den Musikanten war zwar auch wampert genug, aber der zweite war dürr.“
„Natürlich“, räsonierte der Hofkoch, „sie lassen nichts übrig, die französelnden Satansbuben, die alleweil um den Kaiser sind!“
Thomas Wolfsgruber rannte wieder zur Fensternische und bestieg den Tisch, denn im Burghof war jetzt ein Lärmen und Rufen von „Hussa und He“. Eine Rotte kaiserlicher Hatschiere war in den Burghof gestürmt. Der dicke Geiger hatte sie eher erspäht als sein Harfe zupfender Kumpan und nahm Reissaus. Dann hatte auch der Harfenist seine Harfe aufgenommen und war in grossen Sprüngen seinem Gefährten nachgerannt.
„Hoffentlich kommen sie ihnen aus“, sandte der Hofkoch den beiden Flüchtenden seine besten Wünsche nach. Sie erwiesen sich jedoch als vergeblich. Der Harfenist, behindert durch sein Instrument, fiel als erster in die Hände der Verfolger. Aber auch der Geiger wurde gefasst, obgleich er mit erstaunlicher Behendigkeit davongeschnellt war.
„Schade!“ meinte jetzt auch der Tellermeister, als die beiden Musikanten oben vorbeigeschleppt wurden. „Die armen Kerls werden nichts zu lachen haben.“
„Fünfundzwanzig Stockprügel wird jeder schon ausfassen“, meinte Wolfsgruber und wandte sich zur Arbeit des Tages zurück. Bevor er sie jedoch aufnehmen konnte, wurde er abermals unterbrochen. Seine Nichte, Mariandl Wolfsgruber, Kammerzofe der Marquise de Valais, kam die Treppe heruntergelaufen und schrie schon von weitem: „Das Bad für die Madame! Schnell! Schnell!“
Ärgerlich ging ihr Wolfsgruber entgegen. „Nur langsam, Demoiselle! Erst ansagen, in was die Madame heut baden wird!“
„In Bordeauxwein mit Rosenwasser“, erklärte das Mariandl wichtig. Sie übergab dem Oheim die grosse Kristallflasche mit der kostbaren Flüssigkeit. „Die Unze kostet zwei Dukaten.“
„So!“ erwiderte der Oheim trocken und besah die Flasche. „Mindestens fünfzig Unzen, also hundert Dukaten, und der Bordeaux dazu – ein kostspieliges Bad für die Madame.“ Er rief in die dämmrigen Hallen der Küche: „Den Bordeaux für das Bad der Madame!“
Eine Anzahl Küchengehilfen stürzten sich auf einige grosse Kannen, die in einem Winkel der Küche standen. Grinsend schleppten sie Kanne um Kanne zu dem grossen Kessel, um den schon seit geraumer Zeit ein Feuer brannte, und der rote Weinstrom ergoss sich in den Kessel. Die aufspritzenden Tropfen mit der Zunge aufzufangen, war ein beliebtes Spiel der Küchengesellen.
Wolfsgruber wandte sich einer Schar von Hilfsköchen zu, die jetzt die Spiesse herbeischleppten, auf denen die Hühner für den Kaiser staken. Hundert Hühner wurden jeden Tag gebraten, von denen Seine Majestät nur ein halbes ass.
„Knusprig und braun wie eine Haselnuss muss es sein!“ gab der Hofkoch seine Anweisungen. „Vorsichtig drehen!“
Dann begann Meister Wolfsgruber dem Tellermeister die Speisenfolge anzusagen: „Das Huhn für den Kaiser also als erstes! Klingt ganz einfach, wie? Ein Huhn! Sogar nur ein halbes Huhn, denn die Majestät isst nur die Hälfte. Aber was für ein Huhn! Unter den hundert Hühnern, die ich braten lasse, ist oft kein einziges da, das den Anforderungen entspricht. Die Hoftafel: eine Weinsuppe, dann als erster Gang Hecht, ferner Rindfleisch mit Klössen, Ochsenklauen, Sauerbraten; als zweiter Gang Kalbskaldaunen, Hirschbraten, Kalbsbraten; zum Schluss Spritzkuchen.“
Der Tellermeister verzeichnete sorgfältig die Speisenfolge und sah dann seinen Freund wartend an. „Und die Marquise?“ fragte er schliesslich, da der Hofkoch noch immer schwieg.
„Ja, die Marquise“, erwiderte Herr Wolfsgruber grimmig. „Schreib! Zwei Weinsuppen, als erster Gang Karpfen, Krebse, gebratene Vögel und gefüllte Lammbrust. Zweiter Gang: Rehrücken in Rosinensosse, Wildschweinschinken, Welschhuhn, Karauschen, Spanferkel. Zum Schluss Feigenrorte und Spritzkuchen.“
Der Tellermeister notierte eifrig. „Immer diese riesige Aufkocherei“, sagte er kopfschüttelnd. „Das kann sie doch unmöglich alles fressen!“
Der Hofkoch drosch seine Faust auf den Tisch. „Das frisst sie ja auch nicht! Aber gekocht muss es werden!“
Das Schlafgemach der Marquise Hélène de Valais war noch dunkel, der fahle Schein des Tages draussen lag auf den schweren Seidenhängen. Hélène de Valais war bereits wach, das schwache Pochen an der Tapetentür, mit dem ihre Kammerzofe Einlass begehrte, schien sie zu ärgern, denn sie überlegte eine kleine Weile, bevor sie ihr gereiztes „Entrez!“ rief. Hélène de Valais war heute nicht gut gelaunt. Es ärgerte sie, als sich die Tür öffnete und in dem helleren Licht, das vom Vorgemach her einfiel, Mariandl Wolfsgruber ihren fröhlichen „Guten Morgen“ knickste.
Träge öffnete die Marquise ihre Augen nun ganz dem Tageslicht. Was sie erblickte, ärgerte sie noch mehr. Die Zimmer, die ihr des Kaisers noch kühle Gnade angewiesen hatte, waren ein schwaches Abbild des Glanzes, den sie am Hofe Ludwigs XIV. verlassen hatte. Die Marquise seufzte leise, als sie die Gobelins betrachtete, hinter denen sie die kahlen Wände wusste; die schweren Moirévorhänge in zart rosa Farbe, die ihr Bett zierten, die Taburetts und Polstersessel, die umherstanden, das waren Geschenke der galanten Kavaliere am Versailler Hofe, Andenken, die ihr geholfen hatten, sich in der frostigen Wiener Hofburg einzuleben.
Читать дальше