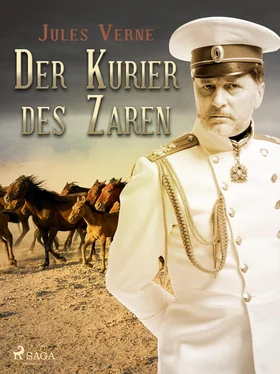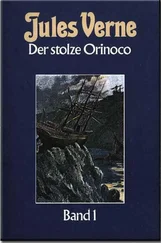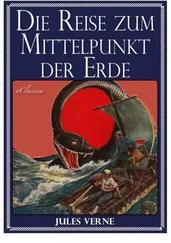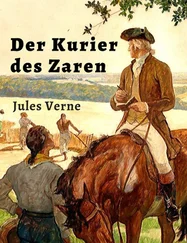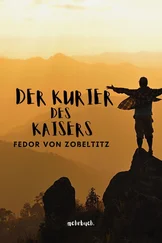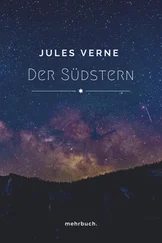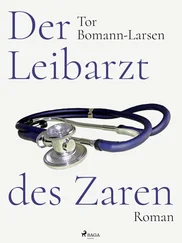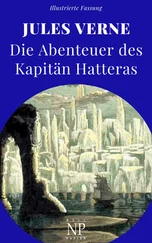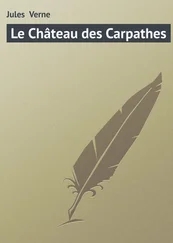Dies war die Lage, die Michael Strogoff klar überschaute, und er rüstete sich, ihrer Herr zu werden. Zuvörderst befand er sich unter anderen Verhältnissen als ein gewöhnlicher Kurier des Zaren. Es war sogar erforderlich, dass niemand unterwegs ahnte, dass er in dieser Eigenschaft reiste. In einem vom Feinde besetzten Lande wimmelt es von Spionen. Wenn er erkannt wurde, war seine Sendung vereitelt. General Kissoff hatte ihm wohl eine bedeutende Summe eingehändigt, die auf seiner Reise genügen musste und ihm diese in gewissem Masse erleichtern sollte, aber er hatte ihm keinen schriftlichen Ausweis mitgegeben, mit der Bezeichnung: „Im Dienst des Kaisers“ — was sonst doch stets ein wirksamer Zauberstab war. Er hatte ihm nur ein „Podaroschna“ ausgestellt auf den Namen Nikolaus Korpanoff, Kaufmann in Irkutsk. Darin war Nikolaus Korpanoff ermächtigt, sich im Notfall von mehreren Personen begleiten zu lassen, und es war besonders darauf vermerkt, dass das Podaroschna auch in dem Falle Gültigkeit haben sollte, wenn die russische Regierung es allen anderen Nationalitäten verbieten sollte, sich aus Russland hinauszubegeben. Das Podaroschna war nichts anderes als die Befugnis, Postpferde zu nehmen; aber Michael Strogoff durfte sich seiner nur in dem Falle bedienen, wo diese Befugnis ihn nicht der Gefahr aussetzte, seine Eigenschaft zu verraten, das heisst, solange er auf europäischem Boden war. Hieraus ergab sich, dass er in Sibirien, das heisst, während seiner Reise durch die aufständischen Provinzen, auf den Postämtern nicht als Mann, der Gehorsam zu fordern hat, auftreten konnte, dass er ferner nicht im Vorzug vor allen anderen mit Pferden bedient zu werden verlangen konnte, und dass er schliesslich auch die Transportmittel zu seinem persönlichen Gebrauch sich nicht verschaffen konnte. Dies durfte Michael Strogoff nicht vergessen; er war nicht mehr Kurier, sondern der einfache Kaufmann Nikolaus Korpanoff, der von Moskau nach Irkutsk reiste und als solcher allen Misshelligkeiten einer gewöhnlichen Reise unterworfen war. Unbemerkt hindurchzukommen — ob schneller oder langsamer — aber jedenfalls hindurchzukommen, das musste sein Vorsatz sein. Und nur die ersten 1400 Werst (1493 Kilometer), die die Entfernung zwischen Moskau und der russischen Grenze betrug, konnten keine Schwierigkeiten bieten. Eisenbahn, Postkutschen, Dampfboote und Pferde auf den verschiedenen Stationen standen aller Welt zur Verfügung und infolgedessen auch dem Kurier des Zaren.
Noch am Morgen des 16. Juli ging also Michael Strogoff nach dem Bahnhof, um mit dem ersten Zug zu fahren. Die Uniform war völlig verschwundert, er trug auf dem Rücken einen Reisesack und war in einfache russische Tracht gekleidet: die um den Leib zusammengebundene Tunika, den herkömmlichen Muschikgürtel, weite Hosen und Stiefel, die an den Kniekehlen zusammengeschnürt waren. Er hatte keine Waffen bei sich, wnigstens nicht sichtbar; unterm Gürtel verborgen aber trug er einen Revolver und in der Tasche eines jener langen Dolchmesser, die das Mittelding sind zwischen Jagdmesser und Türkensäbel und mit denen ein sibirischer Jäger einen Bären gut auszuweiden versteht, ohne den kostbaren Pelz zu beschädigen.
Auf dem Bahnhof von Moskau war recht grosser Andrang von Reisenden. Die russischen Bahnhöfe sind häufig Versammlungspunkte ebensogut für die, die jemand abfahren sehen wollen, wie für die Abfahrenden. Die Bahnhöfe sind gewissermassen kleine Börsen für Neuigkeiten. Der Zug, in den Michael Strogoff stieg, sollte ihn nach Nischni-Nowgorod bringen. Hier war damals die Eisenbahn zu Ende, die jetzt Moskau mit St. Petersburg verbindet.
Dies war eine Fahrt von etwa 400 Werst (426 Kilometer), die der Zug in zehn Stunden zurücklegen sollte. Von Nischni-Nowgorod aus wollte Michael Strogoff, je nach den Umständen, entweder den Landweg nehmen oder mit dem Wolgadampfer fahren, um möglichst bald das Uralgebirge zu erreichen.
Michael Strogoff streckte sich also in seiner Ecke aus, wie ein würdiger Bürger, dem seine Geschäfte nicht sonderliche Kopfschmerzen machen und der die Zeit durch Schlafen herumbringen will. Da er jedoch nicht allein in seinem Abteil war, so schlief er nur mit einem Auge und horchte mit seinen beiden Ohren. Das Gerücht vom Aufstande der Kirgisenhorden und vom Einfall der Tataren war in der Tat ein wenig laut geworden. Die Reisenden, die der Zufall zu seinen Gefährten gemacht hatte, sprachen darüber, allerdings mit Vorsicht und mit Zurückhaltung. Diese Reisenden, wie überhaupt die meisten von allen, die den Zug benutzten, waren Kaufleute, die nach dem berühmten Markt von Nischni-Nowgorod fuhren. Das war notgedrungen eine gemischte Gesellschaft, die aus Juden, Türken, Kosaken, Russen, Georgiern, Kalmücken und anderen bestand. Aber fast alle redeten die Nationalsprache. Man besprach das Für und Wider der ernsten Ereignisse, die jenseits des Ural sich zur Zeit vollzogen, und diese Kaufleute befürchteten, dass die russische Regierung, vor allem in den Grenzprovinzen, einige Massregeln zur Einschränkung ergreifen würde, unter denen der Handel jedenfalls zu leiden hätte. Allerdings, diese Egoisten betrachteten den Krieg, das heisst, die Unterdrückung des Aufstandes und den Kampf gegen die unrechtmässige Besitznahme, nur vom Standpunkt ihrer bedrohten Interessen aus. Die Anwesenheit eines einzigen Soldaten in Uniform — und man weiss, welche bedeutende Rolle in Russland die Uniform spielt — hätte sicher genügt, die Zungen dieser Kaufleute im Zaum zu halten. Aber in dem Abteil, wo Strogoff sass, liess nichts die Anwesenheit einer militärischen Person vermuten, und der Kurier des Zaren, dem daran lag, unerkannt zu reisen, war nicht der Mann danach, sich zu verraten. Er hörte also zu.
„Es wird versichert, der Karawanentee stiege im Kurse,“ sagte ein Perser, der an seiner Astrachanpelzmütze kenntlich war und an seiner abgetragenen, weitfaltigen Kleidung.
„O, es steht auch nicht zu befürchten, dass der Tee fallen würde,“ antwortete ein Jude mit runzligem Gesicht. „Was der Markt von Nischni-Nowgorod an Tee hat, das wird sich leicht nach Westen handeln lassen, aber leider wird es nicht das gleiche sein mit Sen Teppichen von Bochara.“
„Wie? Sie erwarten wohl eine Sendung aus Bochara?“ fragte ihn der Perser.
„Nein, aber eine Sendung aus Samarkand, und die ist eher noch mehr gefährdet. Wer möchte denn auf die Expeditionen eines Landes rechnen, das durch die Khans von Khiwa bis zur chinesischen Grenze in Aufruhr gesetzt ist!“
„Schön, entgegnete der Perser, „wenn die Teppiche nicht ankommen, dann werden wohl die Produktenzufuhren auch nicht ankommen, denke ich.“
„Und der Gewinn? Gott Israels!“ rief der kleine Jude. „Rechnet Ihr das gar nicht an?“
„Sie haben recht,“ sagte ein anderer Reisender, „die Artikel aus Zentralasien dürften am Markt wohl fehlen, und das wird mit den Teppichen Samarkands ebenso der Fall sein wie mit der Wolle, der Seife und den Tüchern des Orients.“
„He, Väterchen, nehmen Sie sich in acht!“ warf ein russischer Reisender mit dem Gesicht eines Spassvogels ein. „Sie werden sich Ihre Tücher wohl schön fettig machen, wenn Sie die Seife dazwischen packen.“
„Das ist nun was zum Lachen für Sie!“ versetzte ärgerlich der Handelsmann, der an dieser Art von Scherzen wenig Gefallen zu finden schien.
„Nun, wenn man sich auch das Haar zerrauft und sich in Sack und Asche tut,“ antwortete der Reisende, „würde das am Lauf der Dinge etwas ändern? Nein, und ebensowenig auch am Transport der Waren.“
„Man sieht, Sie sind kein Handelsmann,“ bemerkte der kleine Jude.
„Nein, meiner Treu, würdiger Spross Abrahams! Ich handle weder mit Hopfen noch mit Teer, weder mit Honig noch Wachs, ich mache weder in Hanfsamen noch in Pökelfleisch, weder in Kaviar noch in Holz, ich verkaufe weder Wolle noch Bänder, weder Hanf noch Flachs, weder Saffian noch Rauchware —“
Читать дальше