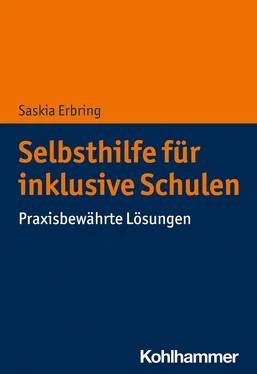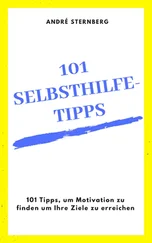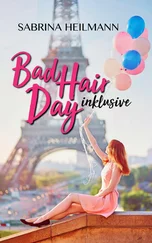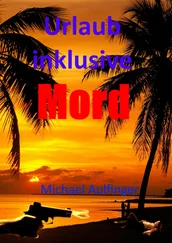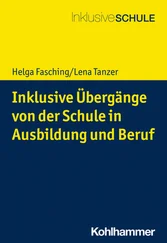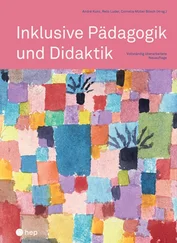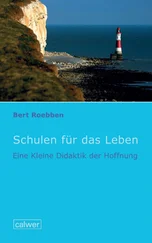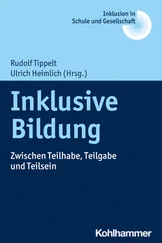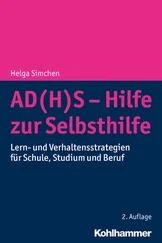Eine gesundheitsfördernde Schulentwicklung im hier vertretenen Ansatz nimmt auch schulische Arbeits- und Organisationsbedingungen in den Blick. Schulen unterscheiden sich von anderen Organisationen. Sie besitzen einerseits eine bürokratische Organisation und andererseits eine starke Autonomie mit eher loser Kopplung der Tätigkeiten der einzelnen Lehrkräfte, so dass dann das Gefühl aufeinander angewiesen zu sein und kooperieren zu müssen häufig fehlt. Oft verstehen Lehrkräfte sich noch als Einzelkämpfer und nicht als Mitglieder eines wechselseitig gebrauchten Teams. Dementsprechend stellt Schumacher (2012) heraus, dass sowohl für die Erreichung der Bildungsziele als auch für die Förderung von Gesundheit es unerlässlich ist, dass Lehrkräfte ihre Schule als Kollektiv begreifen, das gemeinsam seine Ziele verfolgt, Orientierung und Schutz bietet, aber auch Engagement und Loyalität verlangt. Im System Schule liegen demnach vielfältige Ressourcen, beispielsweise soziale Unterstützung und Wertschätzung seitens der Kolleg*innen und Schulleitung, ein hoher Zusammenhalt im gesamten Schulteam und eine gute, effiziente Schulorganisation, die wirksam zur Bewältigung von Stress und Belastung und zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit beitragen können.
Bezüglich einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung orientiert sich das hier entwickelte Selbsthilfeprogramm für Schulen auch an den Vorgaben der European Agency »Teacher Education for Inclusion TE4I« (EAFDISNE 2012). Demnach sind vier Bereiche im Hinblick auf die Qualifizierung von schulischem Personal zu berücksichtigen: Inklusion als Wertschätzung von Vielfalt (valuing learner diversity), Unterricht mit der Unterstützung aller Lernenden (supporting all learners), Zusammenarbeit innerhalb der Schule und darüber hinaus (working together), Weiterentwicklung des Personals (personal professional development).
Die Heterogenität der Ausgangsbedingungen an den Einzelschulen sowie der dringende Bedarf legen nahe, dass Bücher zur Entwicklung schulischer Inklusion als Ratgeber konzipiert werden – als »Hilfe zur Selbsthilfe«. Dieser Band bietet entsprechend konkrete Unterstützungsangebote, die auf die unterschiedlichen Ausgangslagen von Einzelschulen adaptiert werden können. Vielfach erprobte Erfolgskonzepte aus langjähriger Fortbildungserfahrung, die die Selbsthilfepotentiale innerhalb von Schulen aktivieren, sind hier gebündelt.
Das Buch ist erfahrungsbasiert und praxisnah konzipiert. Es enthält kurzgefasste inhaltliche Statements, Übersichten, Grafiken, Arbeitsblätter und Übungen sowie didaktische Hinweise. Adressat*innen des Selbsthilfeprogramms sind Schulen, die sich bereits in einer Umsetzungsphase der Inklusion befinden, ein reflexionsorientiertes Angebot wünschen und bereits sind zum gemeinsamen Austausch und zur gemeinsamen Entwicklung. Falls die Selbsthilfeangebote extern moderiert werden sollen, ist bei den Moderator*innen auf Beratungs- und Kommunikationskompetenzen zu achten. Insbesondere sollten diese ihre eigenen ambivalenten Einstellungen zu Inklusion kennen und in ihrer professionellen Rolle als Vorbild einen produktiven und konstruktiven Umgang damit vorleben. Weitere relevante Akteur*innen, z. B. aus der Region, sollten nach Möglichkeit im Prozess einbezogen werden.
Die hier gesammelten Übungen und Reflexionsanstöße können allein, zu zweit, in Gruppen bzw. Teams und im gesamten Kollegium eingesetzt werden. Im Buch wurden die Übungen mit entsprechenden Hinweisen versehen:
E: Einzeln
T: Tandem
G: Gruppen
K: Kollegium
In den hier erstellten Vorlagen und Arbeitshinweisen wurde im Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes gearbeitet, der in Selbsthilfeprozessen durchgehend beibehalten werden sollte. Teilnehmende werden gebeten, sich einzulassen und defizitäre Kommunikationsmuster zu unterbrechen. Dies setzt auch voraus, dass während gemeinsamer Arbeitsphasen ermüdende und kräftezehrende Argumentationen innerhalb von Arbeitsgruppen möglichst unterbunden werden. Dazu kann auch der Hinweis erfolgen, dass das Selbsthilfeprogramm als Experimentieren mit einer Ressourcenhaltung und als forschender Lernprozess gestaltet ist. In den einzelnen Übungen werden entsprechende Hinweise zu verwendbaren Arbeitsblättern und Folien gegeben, die die praktische Umsetzung unterstützen. Alle verwendeten Arbeitsmaterialien können über den Link im Inhaltsverzeichnis online abgerufen werden.
1.3 Übungen zu Beginn, Abschluss und während des Selbsthilfeprozesses
Übung 1: Soziometrische Aufstellungen in gemischten Gruppen (G/K)

ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Übung 2: Skulptur (G/K)

ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Übung 3: Gemeinsamer Spaziergang (T/G/K)

ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Übung 4: Eckengespräche zur Inklusion (G/K)

ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Übung 5: Sammeln von Erwartungen (T/G/K)

ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Übung 6: Kartenabfrage zu Gruppenpotentialen (G/K)


ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
1.4 Prozessbegleitung mit Fallberatungsgruppen
Übung 7: Einführung Kollegialer Fallberatung (G/K)


ZeitumfangInhalt und ZielDidaktischer Kommentar
Kollegiale Fallberatung (Leitfaden)
| Vorbereitung: |
Setzen Sie sich in einen Stuhlkreis ohne Tisch.Bestimmen Sie eine*n Moderator*in. |
| Problemsuche: |
Jede*r schildert ein Problem, einen ›Fall‹.Probleme zu haben ist Normalität. |
| Auswahl: |
Ein Fall wird ausgewählt. |
Folie 1: Leitfaden Kollegiale Fallberatung
1. Schritt Falldarstellung
2. Schritt Frage klären
3. Schritt Nachfragen
4. Schritt Ich als …
5. Schritt Ich als … werde …
Folie 2: Ablauf Kollegiale Fallberatung 1
| Sharing: |
Wer möchte kann erzählen, was der Fall bei ihm*ihr auslöst, was er*siemitnimmt oder etwas zur Methode sagen. |
| Abschluss: |
Feedback an die Gruppe/Moderation. |
Folie 3: Ablauf Kollegiale Fallberatung 2
Читать дальше