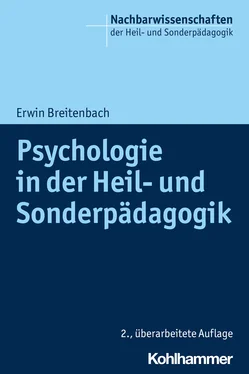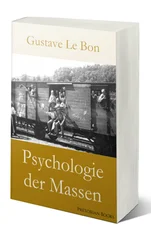In den Berichten internationaler Vergleichsstudien und bei einer Reihe von Autoren ist immer wieder zu lesen, dass hohe diagnostische Kompetenzen sich vor allem dann positiv auf Schülerleistungen auswirken, wenn auf die differenzierte Diagnostik aufbauend individuell gefördert wird (Baumert & Kunter 2006; Deutsches PISA-Konsortium 2001; 2002; Helmke 2007; Hesse & Latzko 2009; Paradies, Linser & Greving 2007). Runow und Borchert (2003) prüften das Wissen von Lehrkräften über die Effektivität von Interventionen im sonderpädagogischen Arbeitsfeld. Dazu befragten sie schriftlich 375 Lehrkräfte von Förderschulen, Sprachheilschulen, Schulen für Geistigbehinderte und Grundschulen aus Norddeutschland bezüglich der Einschätzung der Effektivität von 20 gut evaluierten Interventionsprogrammen und -methoden. Nur vier dieser 20 Interventionsformen wurden adäquat eingeschätzt, die meisten wurden in ihrer Wirksamkeit deutlich überschätzt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass ein Großteil der befragten Lehrkräfte eher wenig bis unwirksame Lehr- und Lernmethoden im Unterricht einsetzt. Die Sonderpädagogen unterschieden sich in ihren Bewertungen übrigens nicht signifikant von den Grundschullehrkräften. Eine vergleichbare Untersuchung führten Hintz und Grünke (2009) an der Universität Oldenburg mit 100 Studierenden der Sonderpädagogik und 101 Studierenden des kombinierten Grund-, Haupt- und Realschullehramtes aus höheren Semestern durch. Die Studierenden wurden gefragt, für wie effektiv sie sieben vorgegebene gut evaluierte Methoden zur Förderung lese-rechtschreibschwacher Kinder einschätzen und welche sie in der Praxis einsetzen würden. Ähnlich wie bei den Lehrkräften gab es bei der Einschätzung der Effektivität keine signifikanten Unterschiede zwischen den Studierenden der Sonderpädagogik und denen der Lehrämter für allgemeine Schulen. In beiden Gruppen besteht gleichermaßen die Tendenz, wirksame Konzepte zu unter- und unwirksame zu überschätzen, allerdings sind Studierende der Sonderpädagogik eher bereit, ineffektive Wahrnehmungs- und Motoriktrainings in der Förderung einzusetzen. Auch Schweizer schulische Heilpädagoginnen offenbaren in einer Online-Umfrage von Sodoge (2010) einen eklatanten Kompetenzmangel bei der Beurteilung von Konzepten, Materialien und Strategien zur Förderung lese-rechtschreibschwacher Kinder. Alle bekannten und zur Diskussion gestellten Fördermethoden halten sie für gleich wirkungsvoll und der Fokus ihrer Fördermaßnahmen zielt in erster Linie auf die ganzheitliche Stabilisierung der Persönlichkeit. Die große Bedeutung einer sprachspezifischen Förderung bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und die mittlerweile gut evaluierten Fördermethoden und Förderstrategien sind ihnen offensichtlich nicht hinreichend bekannt. Vergleichbare Kompetenzmängel decken Schmidt und Schabmann (2016) bei deutschen Referendaren auf.
In einer empirisch-qualitativen Studie von Luder et al. (2006) sollte die förderdiagnostische Praxis durch eine mündliche Befragung von 39 Schweizer Lehrerinnen und Lehrern an Klein- und Sonderklassen oder in Modellen der integrativen schulischen Förderungen untersucht werden. Dabei interessierten vor allem folgende Fragen: Welche förderdiagnostischen Konzepte verfolgen Lehrkräfte in der Praxis? Wie gehen sie bei der Erfassung des Lernstandes vor? Wie werden Förderziele bestimmt und Fördermaßnahmen geplant und wie erfolgt eine Evaluation und Anpassung der Fördermaßnahmen? Die Befragungsergebnisse zusammenfassend, halten Luder, Niedermann und Buholzer (2006) fest, dass vorhandene Materialien, Tests und förderdiagnostische Hilfsmittel zur Lernstandserfassung nur selten eingesetzt werden und dass sich die Lehrkräfte bei der Planung der Fördermaßnahmen sehr stark von der Situation beeinflussen lassen. Theoriegeleitete Konzepte zur förderdiagnostischen Arbeit stehen eher nicht zur Verfügung und sind somit auch nicht handlungsrelevant. Die Evaluation der Fördermaßnahmen erfolgt eher während der Förderung des Kindes; eine explizite und geplante Evaluation scheint dagegen in der Praxis nicht stattzufinden. Die Reflexion des förderdiagnostischen Prozesses als zentraler Aspekt der alltäglichen heilpädagogischen Tätigkeit ist relativ selten zu finden, stattdessen eher ein unprofessionelles, teilweise willkürlich anmutendes Vorgehen.
Gerne wird behauptet, dass sich die Beurteilung der Schüler durch ihre Lehrkräfte verbessere, wenn diese ihre Schüler besser kennen und verstehen. Oerke et al (2016) machen mit ihren Untersuchungsergebnissen auch diese Hoffnung zunichte. Der erste Eindruck einer Lehrkraft von einem Schulkind erweist sich als sehr stabil und durch spätere Erfahrungen kaum beeinflussbar. Darauf zu bauen, dass die diagnostischen Kompetenzen von Lehrern mit Zunahme der Berufserfahrung an Qualität gewinnen, stellt sich im Lichte empirischer Studien ebenfalls als unbestätigte Annahme heraus (Praetorius et al. 2011).
1.2 Diagnostische Aufgaben und geforderte Kompetenzen
Diese häufig beklagten Defizite bei den diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften sind umso schmerzhafter, als eine Reihe wichtiger diagnostischer Aufgaben im pädagogischen Bereich zu bewältigen sind und da nachgewiesenermaßen andere Kompetenzen davon mit betroffen werden.
So fanden Klug et al. (2012) einen signifikanten Zusammenhang zwischen der diagnostischen Kompetenz und der Beratungskompetenz bei Lehrkräften. Obwohl korrelative Zusammenhänge nicht ohne Weiteres kausal interpretiert werden können, vermuten die Autoren, dass eine gründliche Diagnostik wohl einem guten Beratungsgespräch zeitlich vorausgeht und es ermöglicht. Internationale Vergleichsstudien zeigen unmissverständlich, dass Schulsysteme, in denen differenziert diagnostiziert und darauf aufbauend individuell gefördert wird, in vielen Beziehungen unserem deutschen Schulsystem überlegen sind (Deutsches PISA-Konsortium 2001; 2002). Auch Ingenkamp (1989) verweist auf zahlreiche Untersuchungen zur Bedeutung individueller Lernbedingungen von Schülern, in denen offensichtlich wird, dass der Lernerfolg der Schüler in erheblichem Maße von den diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte abhängt und Paradies, Linser und Greving (2007) konstatieren, dass für das schwache Abschneiden Lernender die zu gering ausgeprägte Diagnosekompetenz von Lehrern verantwortlich sei, denn wer Lernrückstände nicht erkennt, kann diese auch nicht abbauen. Darüber hinaus seien diagnostische Kompetenzen zur Anpassung des Unterrichts an die Lernausgangslage erforderlich und ermöglichen rechtzeitige Präventionsmaßnahmen bei lern- und entwicklungsgefährdeten Kindern.
Die Aufgaben der Lehrer, bei denen diagnostische Kompetenzen erforderlich sind, werden von Langfeldt (2006) auf drei unterschiedlichen Ebenen beschrieben: der individuellen Ebene, der Klassenebene und der institutionellen Ebene. Auf der individuellen Ebene muss die Lehrkraft vor allem in der Lage sein, die individuellen Lernvoraussetzungen einzelner Schüler zu beurteilen, um diese angemessen fördern und fordern zu können. Auf der Klassenebene gilt es, die individuellen Unterschiede der Schüler zu erkennen, um z. B. effizientes, kooperatives Lernen in Gruppen zu organisieren oder die Lehrmethoden dem Niveau der Klasse anzupassen. Auf der institutionellen Ebene ist die Fähigkeit gefordert, faire und möglichst objektive Zeugnisse und Leistungsberichte zu erstellen und möglichst fehlerfreie Bildungsempfehlungen zu erteilen. Hesse und Latzko (2009) stellen folgenden Katalog zu expliziten diagnostischen Anlässen für Lehrkräfte zusammen:
• Planen von Unterricht
• Feststellen von Lernvoraussetzungen der Schüler
• Leistungsüberprüfung vor der Einführung neuer Themen
• Analyse des eigenen Unterrichts
• Konstruktion und Bewertung von Klassenarbeiten und Tests
• Bestimmung des Ausgangsniveaus: bei jeder Fördermaßnahme, vor jeder Nachhilfe oder Nachhilfeempfehlung, bei Lernschwierigkeiten einzelner Schüler, bei wichtigen Schullaufbahnentscheidungen, bei Übertritt in die 5. Klasse, Überprüfung der eigenen Bewertung und Zensurengebung.
Читать дальше