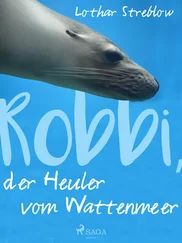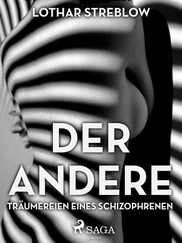Die Leitstute aber ließ sich Zeit. Immer wieder leckte sie ihr Fohlen sauber, das sie in der Morgendämmerung geboren hatte. Mit wackeligen Beinen schmatzte es seine erste Milch. Wirru betrachtete es neugierig aus der Ferne. Näher heran traute er sich nicht an das Kleine. Er hatte inzwischen dazugelernt.
Auch als die Leitstute sich mit ihrem Fohlen an die Spitze der Herde setzte, hielt Wirru respektvollen Abstand. Folgsam lief er seitlich hinter seiner Mutter. Um die Krähenschar, die sich lärmend um die zurückgelassenen Eihüllen balgte, kümmerte er sich nicht.
Es war wärmer geworden. Insekten schwirrten durch die Luft. Wirru hatte alle Mühe, aufdringliche Fliegen abzuwehren, die ihn mit ihren Stichen plagten. Unentwegt schlug er aus, zuckte mit den Ohren und kratzte sich.
Dabei achtete er kaum darauf, wohin er trat. Die Herde durchquerte eine geröllbedeckte Erosionsrinne bmit einzelnen Zwergsträuchern, eine ziemlich unwegsame Gegend. Wirrus kleine Hufe stolperten unbeholfen über die Steine.
Plötzlich rutschte er von einem Geröllbrocken ab. Sein rechter Vorderhuf knickte um, und der Stein prallte hart gegen seinen linken Hinterhuf. Wirru durchzuckte ein scharfer Schmerz. Ein klägliches Wiehern drang aus seiner Kehle. Nach ein paar humpelnden Schritten blieb er stehen, zitternd und mit geweiteten Nüstern.
Besorgt wandte seine Mutter sich ihm zu. Viel helfen konnte sie ihm nicht. Aber sie leckte ihm immer wieder tröstend über seine weiche Nase. Wirru hielt ganz still. Und allmählich ließ der Schmerz etwas nach.
Erst nach einer Weile wagte Wirru vorsichtig ein paar Schritte. Doch bei jedem Schritt kam der Schmerz wieder. Mühsam humpelte Wirru weiter. Der Hengst war wachsam beobachtend in der Nähe geblieben. Fürsorglich geleitete er die beiden zu der wartenden Herde.
Aber die Leitstute mit ihrem neugeborenen Fohlen lief nicht mehr weit. Sie war noch erschöpft von der anstrengenden Geburt. Und sie spürte Durst. Kurz darauf begann sie mit den Vorderhufen im Boden zu scharren, stieß schon dicht unter der Oberfläche auf feuchten Sand.
Allmählich begann sich Grundwasser in dem Loch zu sammeln, quoll nach und nach aus der Tiefe. Eins nach dem anderen tranken die Pferde gierig das kühle Naß. Es schmeckte leicht scharf nach gelösten Salzen. Doch das machte Wildpferden nichts aus.
Wirru und die anderen Fohlen bekamen ihre Milch. Die Großen weideten das harte Gras. Und schon lange vor der Abenddämmerung wanderte die Herde zurück in die Steppe.
Wochen vergingen. Wirru war größer geworden und schon ein wenig selbständiger. Von Tag zu Tag wurde es heißer. Die ersten Sommerregen fielen, und das Schmelzwasser aus den Bergen begann die trockenen Flußtäler zu füllen. Längst hatte Wirru seinen Schmerz vergessen und die Schwellung an seinem Bein. Er setzte seine Hufe jetzt vorsichtiger, wenn er in steiniges Gelände kam. Auf grasigen Ebenen aber tollte er übermütig.
Inzwischen war auch das kleine Hengstfohlen der Leitstute herangewachsen: Sarru, ein ziemlich kräftiger Bursche. Mitunter reizte er Wirru. Die Balgereien zwischen den beiden Junghengsten sahen manchmal recht gefährlich aus. Aber noch war alles nur Spiel, noch konnten sie mit ihren Milchzähnen nicht richtig zupacken; die Bisse blieben harmlos. Und meist unterwarf Sarru sich Wirrus Führung.
Von den westlichen Höhenzügen trieben dunkle Wolken heran, verdeckten die Sonne. Die Hitze war erträglicher an diesem Morgen, der sonst heiße Wüstenwind ein wenig kühler. Ausgelassen galoppierte Wirru an der Spitze der beiden Fohlen rund um die grasende Herde.
Erst als Senja nicht mehr mitkam und schnaufend zurückfiel, kehrte Wirru um und lief zu ihr. Zärtlich beknabberte er ihr den Hals und die Schultern. Sie schob ihren kleinen Kopf unter seinen Bauch, als suche sie dort nach Milch. Aber es war nur Müdigkeit. Wirru spielte aufmerksam mit den Ohren. So standen sie eine Weile dicht beieinander.
Der kleine Hengst Sarru wälzte sich ein Stück entfernt mit allen vier Beinen strampelnd im Gras, scheuerte sich das Fell. Mit einemmal sprang er auf und näherte sich den beiden. Offenbar schien Sarru ihr zärtliches Beieinander nicht zu gefallen. Er stellte sich auf die Hinterhufe und ging mit quietschendem Gewieher auf Wirru los.
Doch mit seinem scharfen Gehör hatte Wirru ihn längst bemerkt. Kurz bevor Sarrus Vorderhufe ihn trafen, schlug er nach hinten aus, versetzte ihm einen leichten Tritt vor die Brust. Verdutzt taumelte Sarru zurück, machte eine Kehrtwendung und preschte davon.
Im gestreckten Galopp sauste Wirru hinter ihm her, bog dann seitlich ab und versperrte ihm den Weg. Schnaufend standen die beiden sich gegenüber, Wirru mit hocherhobenem Kopf, Sarru mit seitlich zurückgehaltenen Ohren. Schaumflocken troffen von ihren Lippen. Jetzt hatten beide genug. Wirru berührte Sarru zur Begrüßung leicht mit der Nase und begann ihn versöhnlich zu beknabbern.
Wirru ging überhaupt sehr behutsam mit Schwächeren um. Er wehrte sich nur, wenn er angegriffen oder wenn ihm die Führung streitig gemacht wurde. Aber er war auch gleich wieder bereit zur Versöhnung.
In diesem Augenblick kam die kleine Stute herangetrabt. Senja fühlte sich alleingelassen und suchte die Gesellschaft der beiden. Nur lief sie eindeutig zu Wirru.
Sarru schnaubte und stieg wieder auf die Hinterhufe. Dann versuchte er ziemlich grob, die kleine Stute vor sich herzutreiben. Senja aber schlug geschickt einen Bogen und suchte bei Wirru Schutz.
Zögernd kam Sarru näher, wieherte kurz. Plötzlich spürte er einen harten Tropfen auf der Nase. Und dann noch welche, überall. Ein Regenschauer prasselte nieder, ließ die Steppe dampfen. Bei Regen hatte der kleine Hengst keine Lust zum Kämpfen. Sarru schüttelte sich und lief mit struppig-nassem Fell zu seiner Mutter.
Über der Wüste schwebte eine flimmernde Hitzeschicht. Selbst der Wind wehte heiß von den Dünen. Und wenn einer der seltenen Regenschauer niederging, verdampfte die Feuchtigkeit, kaum daß sie den Boden berührte.
In diesen Tagen war die Wildpferdherde weit durch die Wüste gezogen, wie jeden Frühsommer auf dem Weg in die Berge. Jetzt trieben auch die Hirten ihre Viehherden in die grünende Steppe. Jeden Tag wurden es mehr. Schafe und Rinder lagerten um die wenigen Wasserstellen, weideten an den mit Schmelzwasser von den Bergen gefüllten Flußläufen. Die Wildpferde mischten sich nicht gern unter brüllende Kühe und blökende Schafe. Sie brauchten die Wildnis, suchten die Einsamkeit der Weite.
Doch auch in den scheinbar endlosen Einöden Zentralasiens blieben sie nicht allein. Karawanenstraßen durchzogen die Wüste. Kamele und Esel stöhnten unter schweren Lasten, unerbittlich getrieben von ihren Herren, von kläffenden Hunden. Und manchmal rumpelte ein klappriger Lastwagen über die sandigen Pisten, eine mächtige Staubfahne hinter sich herziehend.
Wirru hörte die Geräusche nur von fern. Er wußte noch nicht, was sie bedeuteten. Er war müde und achtete nicht darauf, verließ sich auf den Schutz der Großen.
Die Leitstute aber wich allem Fremden aus. Im Laufe der Jahre waren die Wildpferde immer vorsichtiger geworden. Menschengeruch bedeutete Gefahr. An jeder Wasserstelle konnten Jäger lauern, um sie einzufangen, vor allem die Fohlen. Und meist bedeutete das den Tod des Hengstes und der Stuten.
So dauerte es lange, bis sie Wasser fanden, um ungestört ihren Durst zu stillen. Noch bekam Wirru seine Milch, doch seine Nüstern waren trocken vor Hitze und Staub. Tagsüber fand er kaum einen Platz zum Ruhen im heißen Sand. Erst wenn es gegen Abend kühler wurde, begann er sich wohler zu fühlen, und er knabberte ein wenig am Gras.
Im Sommer kam die Dämmerung spät. Die Strecken wurden länger, das Laufen mühsamer. Die Wüste hatte viele Gesichter: Sie war steinig und bedeckt mit geborstenem Geröll, selten nur flach und lehmig-trocken; manchmal ließen sich die haushohen Dünen aus Flugsand kaum überblicken, wirkten wie ein zu Sand erstarrtes Meer.
Читать дальше