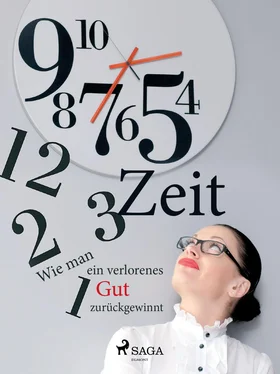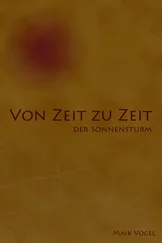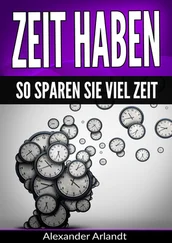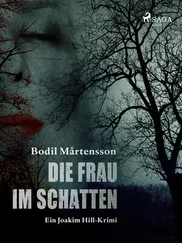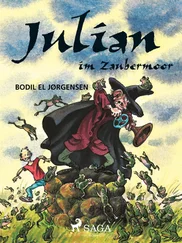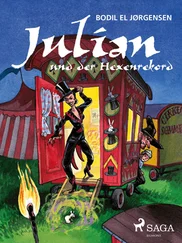Trotzdem bleibt es erstaunlich, dass diese Maßeinheiten überall auf der Erde verbreitet sind. Selbst Menschen in Weltgegenden, die nicht in Meter, Kilogramm, Grad Celsius messen, können mit Größen wie 1 m, 1 kg, 1 °C umgehen – sogar von einem System ins andere umrechnen. Und was die Zeit betrifft, so ist es doch bemerkenswert, dass eine Sekunde überall auf der Welt als Einheit akzeptiert wird.
Maßeinheiten sollten unveränderlich sein. Deshalb orientierte man sich früher an Phänomenen, die man beobachten konnte und für dauerhaft hielt. Folglich wurden die verschiedenen Maßeinheiten mit geografischen und astronomischen Phänomenen verknüpft. Zum Beispiel legte man die Längeneinheit 1 Meter als ein Zehnmillionstel der Entfernung zwischen Äquator und Nordpol in Höhe der Meeresoberfläche fest. Zeitbegriff und Zeiteinheiten wurden an astronomische Bewegungsphänomene gekoppelt. Als sich die Messtechniken verbessert hatten, stellte man jedoch fest, dass Himmelsphänomene durchaus nicht unveränderlich waren.
Im Jahre 1870 erklärte der englische Physiker James Clerk Maxwell: »Wenn wir absolute, unveränderliche Einheiten für Zeit, Länge und Masse gewinnen wollen, dürfen wir uns nicht an Bewegung oder Masse der Planeten halten, sondern müssen uns an Wellenlänge, Frequenzen und Massen von unvergänglichen, unveränderlichen und vollständig gleichartigen Atomen orientieren.«
Tatsächlich definieren wir heute den Meter anhand atomarer Wellenlängen und die Sekunde auf der Basis von Strahlungsfrequenzen von Atomen und Molekülen. Im Jahre 1967 wurde festgelegt, dass 1 Sekunde der Dauer von 9.192.631.770 Perioden der Strahlung gleichkommt, die dem Übergang zwischen zwei Hyperfeinniveaus im Grundzustand des Atoms Cäsium 133 entspricht.
Ich wüsste aber niemanden, der diese Definition im eigenen Zeitempfinden nachvollziehen könnte. Ihre Stärke liegt vielmehr darin, dass es sich um eine objektive, vom Menschen unabhängige Definition handelt. Als Kuriosum am Rande sei vermerkt, dass der Meter nunmehr – seit Donnerstag, dem 20. Oktober 1983 – direkt mit der Sekunde verbunden ist. 1 Meter wird definiert als die Strecke, die das Licht im Zeitraum (1/299792458)s durch das Vakuum zurücklegt. Länge wird heute also nicht mehr als Länge definiert, sondern als Zeitfaktor .
Das ist auf die seltsame Situation zurückzuführen, die in den siebziger Jahren entstanden war. Damals gelang es zum ersten Mal, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zu messen, ausgedrückt in m/s – womit sich zugleich auch eine präzisere Definition des Längenmaßes Meter ergab. Das musste natürlich genutzt werden, und deshalb wurde der Meter neu definiert und direkt mit der Sekunde verbunden.
In einem Punkt unterscheidet sich unsere subjektiv erlebte Welt aber nicht von der Definitionswelt der Uhrzeit: Auch im Alltag rechnen wir nicht in Entfernungen, sondern in Zeit!
Persönliche empfundene Zeit
Die physikalische Zeit, die Uhrzeit, ihre Definition und ihren Gang kann niemand beeinflussen. Man kann sich wohl eine herkömmliche mechanische Uhr zulegen und ausrufen, wie der Poet Gösta Ekstrof:
Ich will nicht so ein
digitales Wunder
das meinen Zeitverbrauch misst
Ich behalte
mein globales Orakel
das mir die Illusion der Unsterblichkeit bewahrt
Aber man kann nichts daran ändern, dass die Menschheit Zeit nun einmal partout auf eine vom Menschen unabhängige Weise definieren wollte, zuerst im kosmischen Raum, jetzt auch im atomaren Mikrokosmos.
Die persönliche Zeit dagegen, unser Zeitempfinden und wie wir mit der Zeit umgehen, gehört uns allein. Und sie bleibt uns auch erhalten, vielleicht für immer. Hinter der Uhrzeit jagen wir jedoch hinterher. Die wird »effektiviert«, zerstückelt. Und dann kaufen wir uns ein neues technisches Wunderwerk, um »Zeit zu sparen«. Damit erreichen wir meist das genaue Gegenteil dessen, was wir beabsichtigten – nämlich mehr empfundene Zeit zu haben.
Verletzungen des Zeitempfindens
Unterschiedliche Umgebungen bieten mehr oder weniger gute Voraussetzungen, um die persönliche Zeit, den eigenen Rhythmus zu empfinden. Eisenbahnzüge waren früher die perfekten Freiräume auf Rädern. Zwar werden Abfahrt und Ankunft des Zuges in Uhrzeit angegeben, doch dazwischen konnte man die Zeit auf ganz persönliche Weise erleben. Nirgendwo war man so ungestört wie im Zug.
Doch dann wurde uns Bahnliebhabern dieser Freiraum genommen. Die Handymafia hielt Einzug. Mit ihren Abschlussbilanzen, dem Ergebnis der Führerscheinprüfung und den Komplikationen bei Evas Keuchhusten. Wer will denn das alles wissen? Ich möchte in meinem Klangraum in Ruhe gelassen werden. Ich kann nicht akzeptieren, dass andere Menschen durch ihr Geschwätz im Bahnabteil meine persönliche Zeit so sinnlos zerstören. Oft wird in erheblicher Lautstärke telefoniert, und was gesagt wird, klingt immer irgendwie unnatürlich. Es ist ja auch unnatürlich, nur den einen Teil eines Gesprächs zu hören. So unnatürlich, dass man diese Störgeräusche nicht ignorieren kann – anders als das natürliche Hintergrundgeräusch, das sich zum Beispiel aus einer Unterhaltung zwischen anderen Reisenden ergibt.
»Liebe Bahn«, schrieb ich 1995. »Ich würde gerne auch weiterhin Eisenbahn fahren. Deshalb schlage ich vor, dass Sie der Handymafia ein Reservat zuweisen, wo sie sich ihrer Zeitzerstückelung hingeben kann. Wir anderen können derweil in den übrigen Waggons unsere freien Zeitzonen genießen. Übrigens werden sich dann bestimmt auch viele Handyterroristen zu uns in die handyfreie Zone setzen – so wie Raucher, die zwischendurch in Nichtraucherabteile übersiedeln. Denn wenn man erst erfahren hat, was empfundene Zeit bedeutet, will man sie auch nicht wieder verlieren.«
Und jetzt gibt es sie endlich, die handyfreien Bahnwagen, die geschützten Oasen. Vielleicht kann der Zug wieder zu einem Ort werden, an dem sich das Gefühl von empfundener Zeit verstärkt und erweitert.
Während ich entdeckte, dass es Uhrzeit einerseits und empfundene Zeit andererseits gibt, machte sich natürlich auch die übrige Welt Gedanken über diese Fragen. Man kann regelmäßig davon ausgehen, dass in dem Moment, wo man eine großartige und ganz neue Idee entwickelt, irgendwo auf der Welt einer oder mehrere Menschen genau denselben Einfall haben. Vielleicht formulieren sie ihn etwas anders, aber im Grunde handelt es sich um denselben. »Die Zeit denkt«, wie Kristina Persson, Regierungspräsidentin von Jämtland, zu sagen pflegt.
Aber ich war doch überrascht, dass ich mit meinen Überlegungen nicht so allein gewesen war, wie ich gedacht hatte. Der deutsche Philosoph Peter Heintril hat 1990 »Tempus« gegründet, einen »Verein zur Verzögerung der Zeit«. Das sollte kein Witz sein (auch wenn Vereinsmeier manchmal große Witzbolde sind), und Tempus hat inzwischen in Deutschland, Österreich, Schweden, Italien und der Schweiz an die tausend Mitglieder. Seit 1991 werden jedes Jahr Symposien veranstaltet. Die Vereinsmitglieder werden eingeladen, ganz konkret von ihrem Umgang mit ihrer persönlichen Zeit zu berichten. Der Verein ist recht locker organisiert, gibt aber diverse Publikationen und Videodokumentationen heraus.
Ich erfuhr von dieser Vereinsgründung erst Jahre später aus einer schwedischen Zeitung. Ich besorgte mir die Schriften des Vereins und las mit zinntellergroßen Augen über Chronos (eine genaue Kopie meiner »Uhrzeit«) und Kairos (was meiner »empfundenen Zeit« entspricht). »Zeitzeichen«, eins der von Tempus herausgegebenen Bücher, wird vorgestellt als das Buch für Menschen, die schon alles haben – nur keine Zeit. Andere Titel lauten: »Leb schneller, dann ist es rascher vorbei!« – »Ich habe Zeit – also bin ich« – »Sie können die Oliven überprüfen, sooft Sie wollen, sie werden trotzdem nicht schneller reif«.
Читать дальше