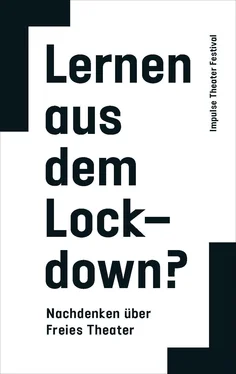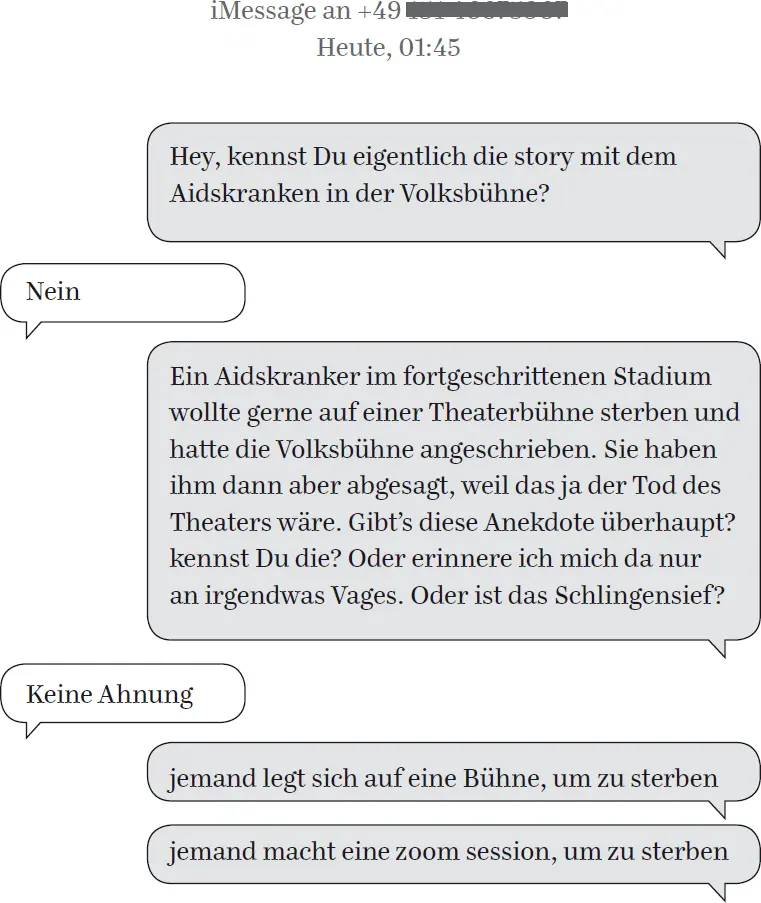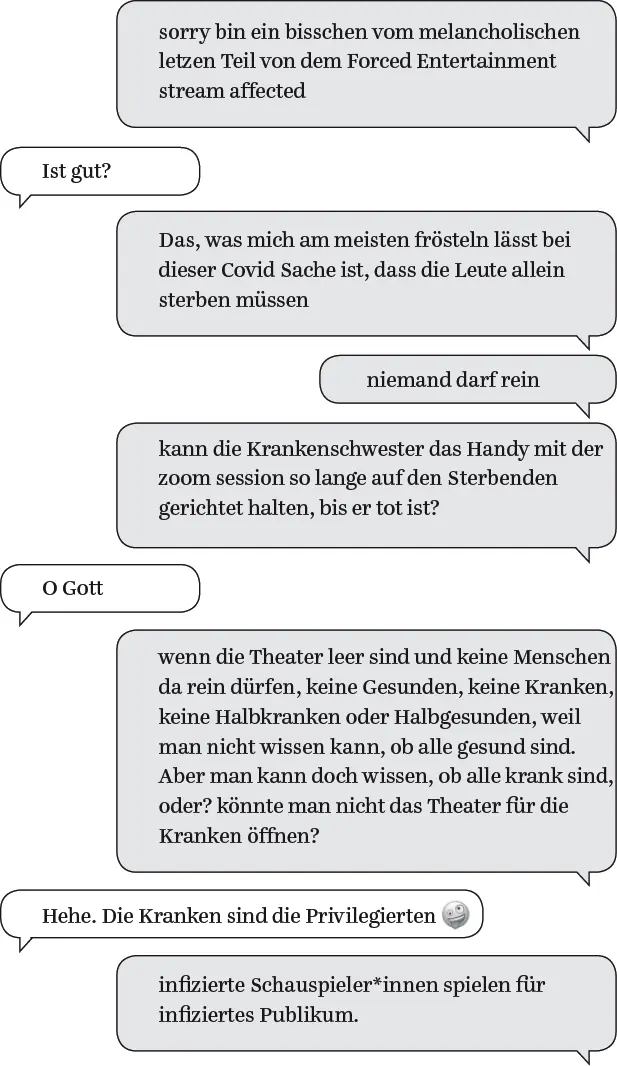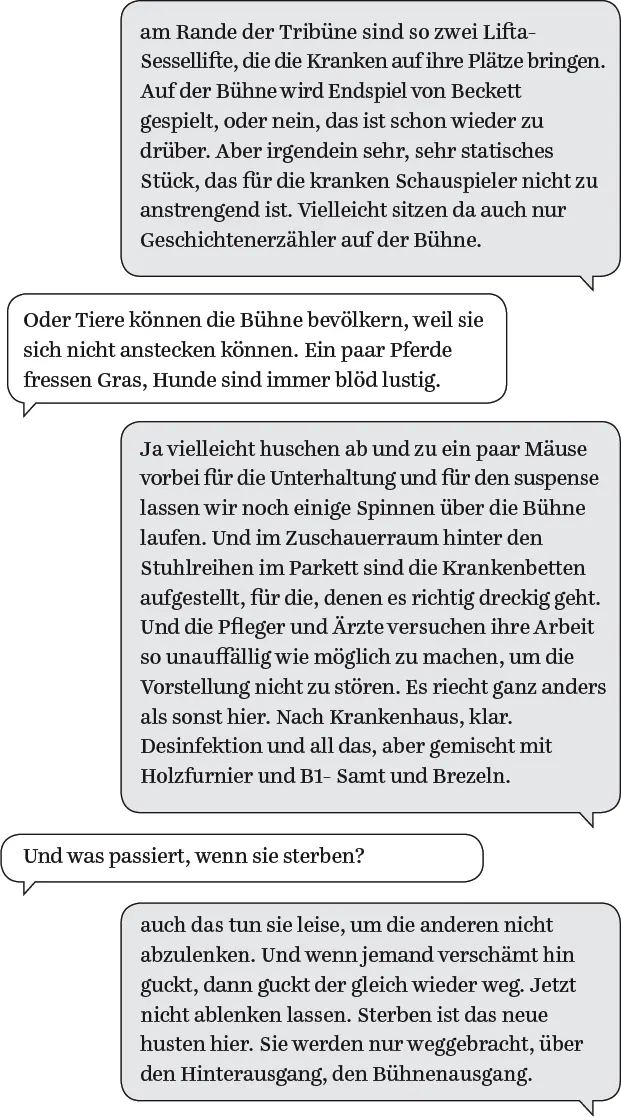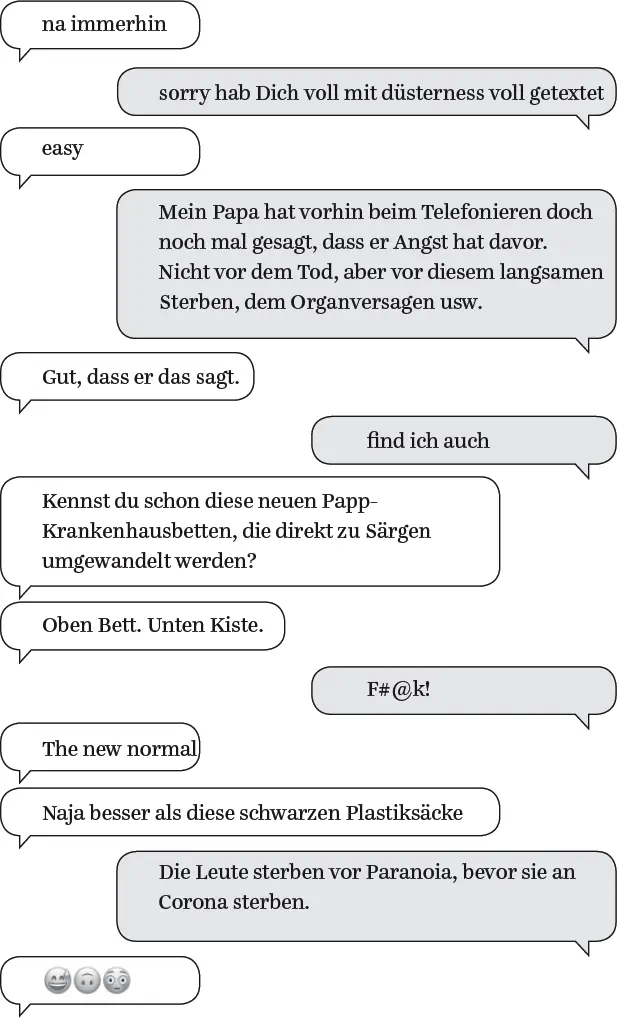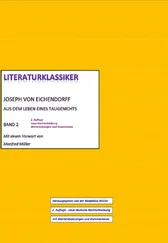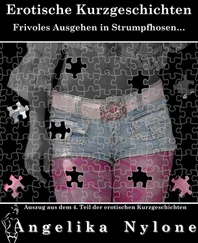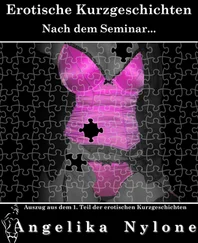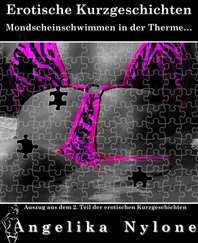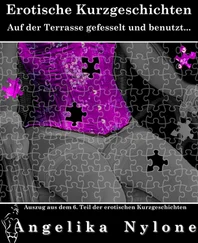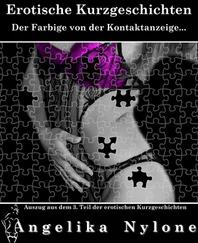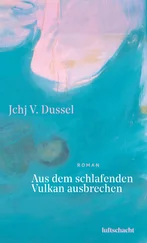Ein weiterer Aspekt des Theaters in Zeiten der Pandemie beschäftigt uns:
Kunst greift tagesaktuelle Themen auf. Zum Beispiel die Frage der Triage – wer bekommt die notwendige ärztliche Unterstützung, wenn die Ressourcen nicht ausreichen? Gerade jetzt wäre es wichtig, die Perspektive von Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, die hiervon ganz direkt bedroht sind, dazu jedoch kaum gehört werden. Aber wie können wir solche Themen besprechen, erklären, uns ihnen stellen, wenn wir einander nicht berühren, nicht trösten können? Und wenn wir die Auswirkungen von dem, was wir sagen, nicht an den feinen Reaktionen unseres Gegenübers ablesen und unser Verhalten darauf abstimmen können?
Wenn die Kunst im digitalen Raum stattfindet (und sich zudem Rahmenbedingungen und der gesellschaftliche Kontext täglich verändern), steigen Tempo und Anspruch an Aktualität. Damit Schritt zu halten fällt uns schwer. Und wir sind vor allem dann langsam, wenn wir wirklich als Gruppe weitergehen und nicht einige, zum Beispiel diejenigen ohne Internetzugang, zurücklassen wollen. Hier ist das Theater im digitalen Raum für uns eher Risiko als Chance.
„Ein Objekt aus Palmen aus vielen Farben, die Palmen aneinandergebunden. Ein Reetdach, eine Tür, ein Häuschen mit Fensterchen, durch die man durchluschern kann. Wir können uns da hinein verkriechen, wenn wir Schutz brauchen. Das Dach kann man öffnen, um Sonne zu tanken“, beschreibt Lina Strothmann ihr Schutzkonzept-Kunstwerk. Im Gegensatz zu Linas Palmenschutzraum können wir unsere Räume nicht eigenständig nach Bedarf öffnen. Wir sind einerseits freie Gruppe und andererseits Teil einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Einige von uns haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Zu den Regeln, die allgemein für die Theaterarbeit gelten, kommen so noch weitere Vorgaben hinzu, die uns auf absehbare Zeit eine noch stärker eingeschränkte (Proben-)Arbeit erlauben, Dienstreisen (= öffentliche Auftritte) sind untersagt. Es zeichnet sich ab, dass der Theaterbetrieb ab Herbst weitgehend ohne die Beteiligung von Künstler*innen mit Behinderung hochgefahren wird. Jedenfalls ohne uns.
Also werden wir in unserem Tempo neue Formate und digitale Performances entwickeln und versuchen, trotzdem sichtbar zu bleiben. Wir hoffen, dann noch ein Publikum zu finden, das sich neben einem realen Theaterbesuch auch für Theater im Netz interessiert. Und vor allem hoffen wir auf eine „Rolle vorwärts“ – um die inklusive Öffnung des Theaterbetriebs mit Impulsen aus dem Lockdown wieder in Schwung zu bringen.
Meine Damen und Herren ist ein inklusives Theaterkollektiv aus Hamburg. Seit 1996 arbeiten hier Schauspieler*innen mit sogenannter geistiger Behinderung. Aufführungsorte sind u. a. Kampnagel in Hamburg sowie das Forum Freies Theater in Düsseldorf. Das Team dieses Artikels besteht aus Katharina Bromka, Lis Marie Diehl, Josefine Großkinsky, Friederike Jaglitz, Melanie Lux, Tom Reinecke, Dennis Seidel, Paula Stolze, Lina Strothmann, Martina Vermaaten.

KAMPNAGEL, HAMBURG, 12. Mai 2020, Foto: Sophie Pulkus (Mitarbeiterin in der Kasse). Seit März ist die Kasse wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen und des eingestellten Spielbetriebs nur telefonisch zu erreichen, Karten werden keine verkauft.
Sahar Rahimi
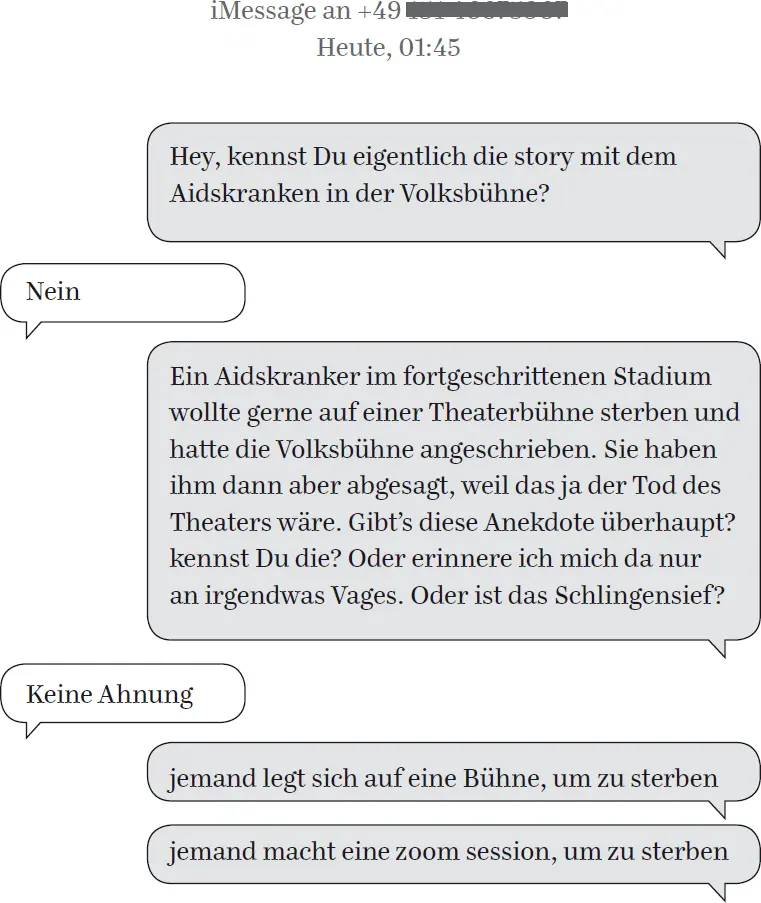
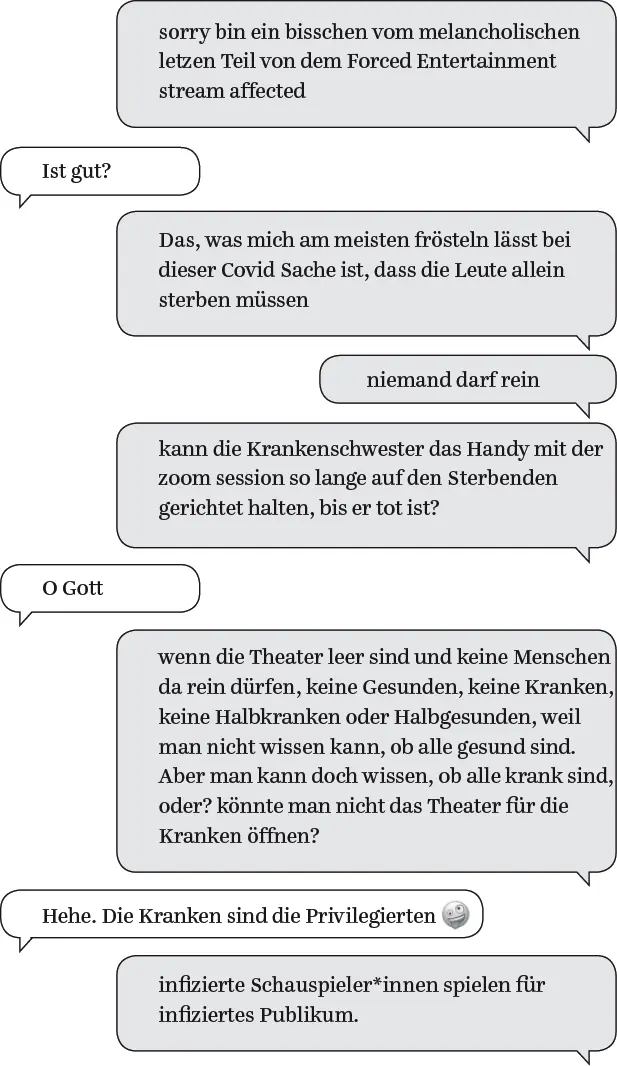
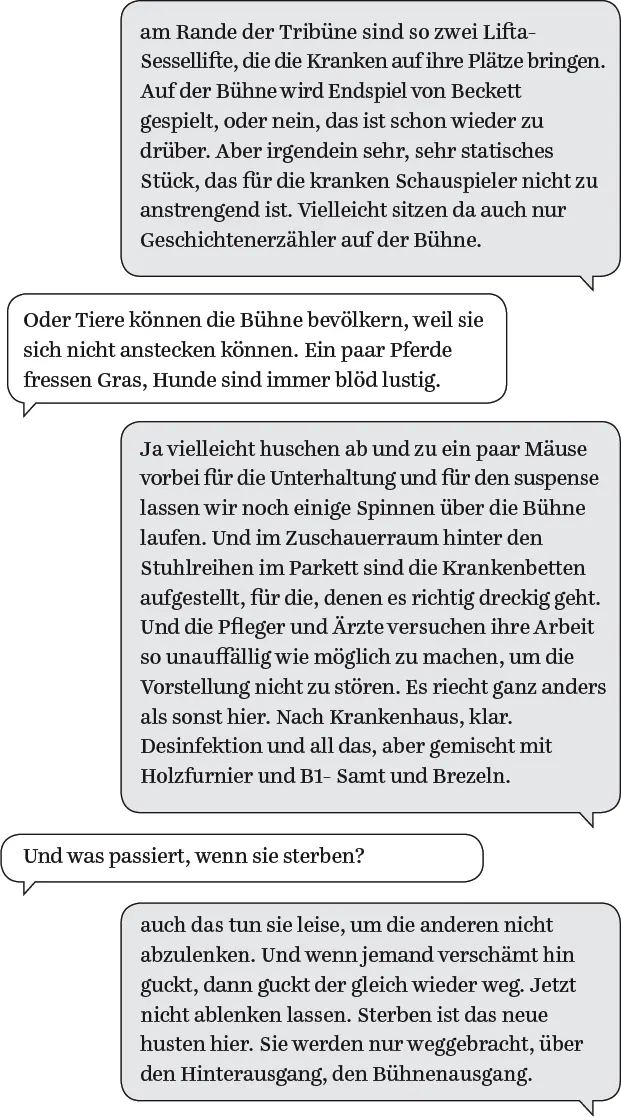
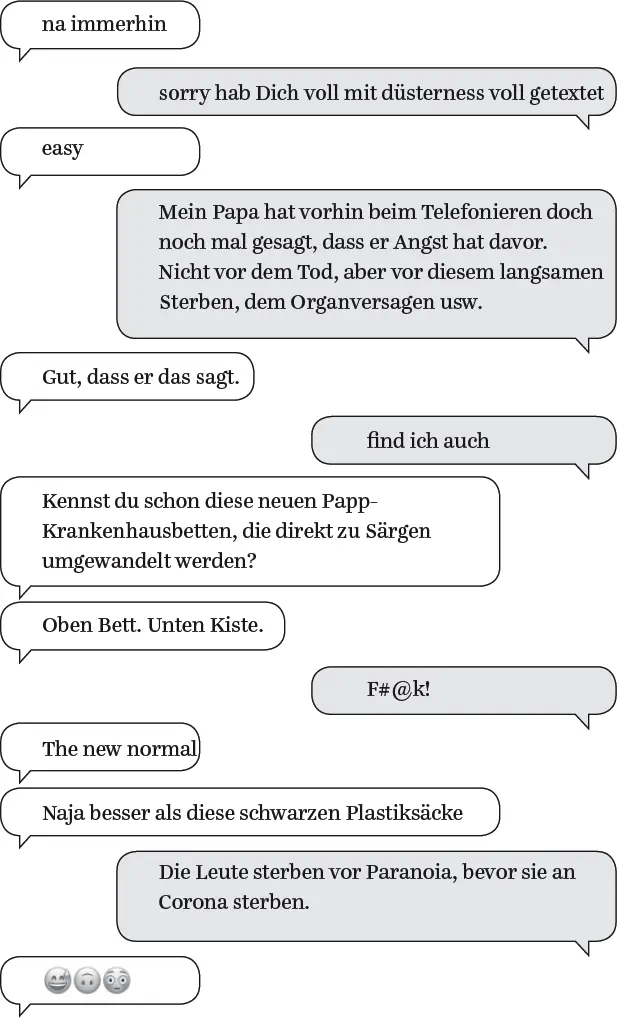
Sahar Rahimi , geboren in Teheran, ist Regisseurin und Performerin und lebt zurzeit in München. Sie studierte am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und ist Mitbegründerin der Performancegruppe Monster Truck, die in den Bereichen Theater, Performance, Video und Bildende Kunst arbeitet. Monster Truck realisiert Projekte in der Freien Szene und am Stadttheater, u. a. an den Sophiensælen Berlin, am Mousonturm Frankfurt, an den Münchner Kammerspielen und am Schauspiel Bochum, und war bei zahlreichen Festivals wie dem Impulse Theater Festival, dem Radikal Jung Festival, dem Israel Festival und dem lagos_live Festival zu Gast. Für ihre Arbeiten wurden Monster Truck mit dem Preis des Favoriten Festivals und dem Tabori Preis ausgezeichnet. Im Rahmen der Impulse-Akademie 2020 leitete Sahar Rahimi einen digitalen Working-Class-Stammtisch.

GESSNERALLEE, ZÜRICH, 30. April 2020, Foto: Sandro Burkart (Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), der beobachtete, wie ein alter Molton in der Halle geflickt wurde.
CIRCLES OF RESILIENCE AN OBSERVATION ON WOUND TOPOGRAPHY AND POSSIBILITY
Diya Naidu
She asks me to accompany her onto the balcony for a smoke. I go along, bracing myself for the chill outdoors. It is August 2015 and almost the end of my three month artist’s residency in Zurich. She and her sister had come to my studio presentation a few days before. The work was about violence against women. For the entire forty minutes of the performance, both were engaged, emotional and deeply connected. Both were wounded or, as I would later discover, triggered by a former hurt. One that was ancient and carried by the entire tribe. I would also discover this essential fact about wound topography – all wounds lead to each other, they are connected. This is something a certain microbe we now know as Covid-19 would ruthlessly demonstrate: the wound of racism (disproportionate infections among Black Americans), classism (millions of labourers walking home across thousands of kilometres in India), capitalism (the havoc caused to food supplies by the global supply chain) and patriarchy (whole nations and environments suffering at the hands of old male leadership, the rise in domestic abuse of women and children during lockdown) and how these bodies of pain all flowed into each other.
After my performance, the sisters had approached and invited me to lunch. Now here we were on their balcony, the gloom of an approaching autumn after a glorious Swiss summer. Nature was heaving and threatening and there was a stillness in the air that announced her impending confession. She handed it over to me to carry forever – the thing she had been aching to say: “I hate being white”. There was venom and pain in her eyes. In my imaginal realm, she morphed into a cobra with fangs turned inwards, gutting its own bleeding heart. I may have taken an abrupt step back. Being handed ancestral wounds and witnessing them is not easy work. She didn’t ask explicitly for a bandage. I don’t think she credited me with that kind of power but she knew I would listen, aware from my work that I was embracing the wound too, though seemingly a different one. “White people are the cause of all the bad things that have ever happened on this planet”, she vomited out. I wanted to say, “No, no… It’s not your fault that you are white …” or anything that would stop the wound from spewing. It wasn’t working. I could feel my eyes darting around unconvincingly while my mind processed images of British officers on horseback whipping starving Indians, of conquistadors and cowboys culling whole indigenous American populations, of European men raping African women, of chained slaves on ships, of Nazis and their genocidal camps, of refugees in rubber boats being unwelcome on European shores… I worked hard to stop this historical download of images. She saw it in my eyes. She knew that I pitied her in that moment. We were like two people standing on either side of the same wound, clearly seeing it but forgetting it existed inside us. The only way to resolve this was to begin the long walk towards each other through the space in between. In the landscape of the psyche and the soul, this space was the wound itself. We would have to enter it in order to heal it and ourselves.
Читать дальше