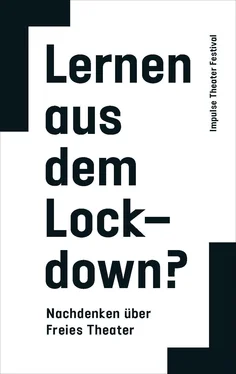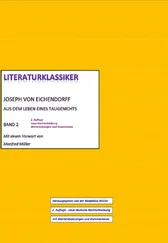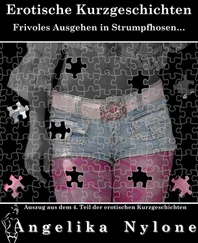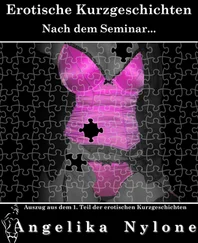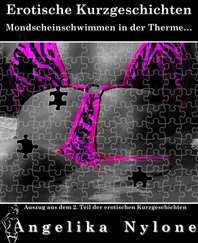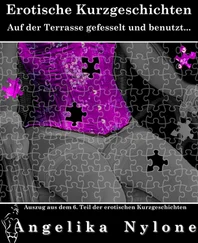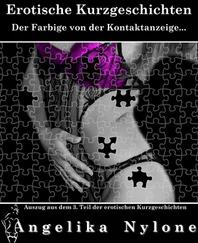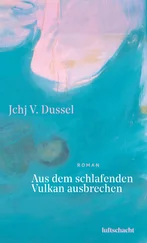Wilma Renfordt ist seit 2017 Dramaturgin beim Impulse Theater Festival. 1982 geboren, wuchs sie am Rand des Ruhrgebiets auf und arbeitete nach dem Theaterwissenschafts-Studium an der FU Berlin frei als Dramaturgin, Autorin und kuratorische Assistenz, u. a. als Teil der Gruppe copy & waste. 2016/17 war sie Dramaturgin beim steirischen herbst. Falk Schreiber, Kulturjournalist. Geboren 1972 in Ulm, Studium in Tübingen und Gießen, Zeitschriftenvolontariat in Hamburg. Seit 2018 freischaffend, schreibt u. a. für Theater heute, Tanz, Nachtkritik, Hamburger Abendblatt, taz über Darstellende und Bildende Kunst. Mitglied diverser Fachjurys. Lehrt journalistische Praxis.

LICHTHOF THEATER, HAMBURG, 6. Mai 2020, Foto: Gesine Lenz (Produktionsleitung), besuchte picnic beim Videodreh zu „aria for no audience“ im leeren Theater.
ATEMPAUSE WO SICH DAS LEBEN BAHN BRICHT
Stefanie Wenner
Pause war in der Schule immer das, wo das Leben stattfand. Pausen waren dazu da, der Schule einen Sinn zu geben, in großen Teilen. Die Pause war wild und frei, aufregend später, in der Pubertät. Sommerpause war in meiner Zeit als Arbeiterin an einem Theater so etwas wie Sendepause, aber in Teilen vergleichbar mit dem, was Pause in der Schule auch war: Leben. Wenn wir versuchen, unseren Atem zu pausieren, wird rasch klar, dass das enge Grenzen hat. Mit etwas Übung lassen sich diese Pausen verlängern. Mit etwas Übung wird auch erlebbar, dass wir mit unserem Atemrhythmus unsere Wahrnehmung massiv verändern und unsere körperliche Existenz intensivieren können. Wo die Atempausen enden, bricht sich das Leben Bahn, unser Leben. Das wir nicht beherrschen, das uns gegeben ist, Atemzug, für Atemzug. Willentlich aufhören zu atmen – eine unlösbare Aufgabe. In der Pause wird der Zug des Lebens erlebbar, etwas, das mich durchströmt, ich kann es nicht festhalten, aber ich kann meine Wahrnehmung dafür intensivieren. Die Pause, die das Theater hierzulande durch Covid-19 erfährt, stellt es in seiner gegebenen Form infrage. In „Pause“ steckt auch, dass etwas final endet, zur Ruhe kommt, aufhört. Das ist die Bedeutung der altgriechischen Wurzel des Wortes, die auf den Stillstand verweist. Die Menopause wäre so eine Art der Pause, die ein Ende benennt. Eine Pose, eine zur Ruhe gekommene Bewegung, hat indes ebenso mit der Pause zu tun. Eine Theaterpose assoziieren wir mit einer archetypischen, eher überkommenen Spielweise. Das Theater selbst kann eine Pose des Bürgertums sein, eine Kultur, deren Pause im absoluten Sinne womöglich gekommen ist. Denn dieses Theater basierte auf Verträgen und Konventionen, deren Wegfallen wir nicht betrauern müssen. So entsteht in der Pause Raum für Neues, für das, was Theater heute sein kann, erneut erneuert, Magie. Für neue, heilende Verträge, eine weitere Dimension der Pause, in der Etymologie des englischen put , setzen, stellen, legen, eine Handlungsoption aus dem Potenzial der Unterbrechung heraus, die nicht wieder aufnimmt, was vorher schon ein Problem war. So kann diese Pause, dieser Moment von Ruhe, zur Vorlage, zur Pause dessen werden, was kommen mag, was wir uns herbeiimaginieren. Was wir nun tun, welche Praktiken wir hier etablieren, kann zur Blaupause werden und zur Basis einer neuen Theaterkultur der Zusammenkunft menschlicher und nicht-menschlicher Körper, eine Feier der Gegenwart, anerkennende Teilhabe, Pause als Befreiung. Der Druck des Lebens bricht sich Bahn durch die versteinerten Institutionen, die Leben in ihrem Sinne angeeignet und verwertbar gemacht haben. Wir pausen ab, was die Pause ermöglicht hat, und kommen zu einem neuen, lebendigen Theater, new life theater . Wir atmen.
Stefanie Wenner , Professorin für Angewandte Theaterwissenschaft an der HfBK Dresden seit 2015, Promotion in Philosophie an der FU Berlin 2001, seither Kuratorin und Dramaturgin in der Freien Szene, u. a. am HAU Berlin und bei den Impulsen. Seit 2014 Betreiberin von apparatus, gemeinsam mit Thorsten Eibeler. Dort Arbeit an der Herstellung besserer Darstellung von Wirklichkeit mit den Mitteln von Theater und Kunst.
Falk Schreiber
Zeige deine Wunde. Mache dich angreifbar. Öffne dich, breite die Arme aus, atme tief ein. Atme die Aerosole ein. Mache dich angreifbar.
Hier deine Wunde. Hier dein Körper, hier deine Infektion, hier deine Verletzung. Hier deine Angst. Aufwachen, Schlafengehen, Aufstehen, Angst. Angst vor der Krankheit, vor dem Tod, vor dem Souveränitätsverlust. Zeige deine Wunde! Gib deine Souveränität auf! Souveränitätsverlust: irrelevant werden. Unsichtbar werden. Zeige deinen Antrag: Corona-Soforthilfe für Soloselbstständige! (Aber nicht für dich, nicht für dich!) Zeige das Ablehnungsschreiben.
Hier dein Körper. Sei nackt, sei angreifbar. Es gibt hier ein Problem: Gib dem Problem einen Namen. Finde eine Lösung für das Problem, finde keine Lösung. Gehe online, schaffe Sichtbarkeiten, brich zusammen, stelle fest: Das funktioniert alles überhaupt nicht! Das trägt sich nicht, da kommt kein Geld rein, die Miete für den nächsten Monat: fällt aus. Abendessen: fällt aus. Premiere: fällt aus. Oder: Das funktioniert doch. Warum auch nicht? Warum funktioniert das eine Projekt, warum funktioniert das andere nicht?
Hier dein Leben. Es gibt nichts mehr zu gewinnen, es gibt nur noch was zu lernen. Es gibt Netzwerke zu knüpfen, Solidaritäten zu entwickeln. Es gibt Strukturen, die hinterfragt werden wollen. Es gibt Ästhetiken, die neu gedacht werden wollen. Gibt es eine Ikonografie des Lockdowns? Gibt es Images der Angreifbarkeit?
Zeige deine Wunde. Öffne dich. „Let me see your beauty broken down / Like you would do / For one you love.“ (Leonard Cohen)
SHOWCASE IM SPLITSCREEN VIDEOBOTSCHAFTEN AN DIE DOMINANZKULTUR
Michael Annoff und Nuray Demir
DAS FREIE THEATER WAR SCHON IMMER IM LOCKDOWN
„Gimme my check, put some respeck on my check Or pay me in equity, pay me in equity Or watch me reverse out the debt“
APES**T, The Carters (2018)
Frühjahr 2020: Das Theater muss zu Hause bleiben. Auf eilig einberufenen Zoom-Konferenzen fängt es an, sich Sinnfragen zu stellen: Wie kann ich die Kunst der Begegnung und der Versammlung bleiben? Wie bleibe ich ohne öffentliche Orte lebendig? Was kann ich tun, um aus der Krise eine Chance zu machen?
Viele Theatermacher*innen erleben den pandemischen Lockdown als ein einschneidendes Ereignis. In der Quarantäne ist ihrer Arbeit die Grundlage genommen. Eingesperrt im Homeoffice eröffnet sich der Raum, nach der Zukunft ihrer Zunft zu fragen. Zwischen iMac und Yogamatte übt die kreative Klasse den Spagat zwischen Panik und Utopie. Wird der Kunst der Geldhahn zugedreht oder macht Not erfinderisch? Entsteht endlich ein postmigra … äh, -digitales Theater, das neue Publikumsgruppen viral erschließt? Das Leben muss irgendwie weitergehen. Was für viele Theatermacher*innen eine neue Erfahrung darstellt, ist für Andere schon lange Alltag: Die Grenzen sind dicht. Auf der Straße zu stehen und von der Polizei angesprochen zu werden. Bürgerliche Freiheit, aber kein Zugang zu bürgerlichen Institutionen. Depressiv, aber keine Therapie.
Im Jahr 2018 haben lediglich zehn Prozent der Menschen in Deutschland wenigstens einmal eine öffentlich geförderte Kulturinstitution besucht. Kann es sein, dass das Freie Theater für die Mehrheit der Menschen schon immer im Lockdown gewesen ist? Liegt es vielleicht daran, dass sich das Theater und sein Publikum schon lange vor Corona in Social Distancing geübt haben? Im Mai 2020 sind „systemrelevante“ Lohnarbeiter*innen längst wieder bei der Arbeit und schieben sogar Doppelschichten. Oder haben in Kurzarbeit andere Sorgen als Kulturbesuche. Offensichtlich erleben die Insider*innen des Freien Theaters den Lockdown viel dramatischer als ihre Nicht-Besucher*innen. In der Stille der Heimarbeit erwachen alte Audience-Development-Träume, in denen neue Besucher*innengruppen gewonnen werden, ohne dass man sich selbst ändern muss.
Читать дальше