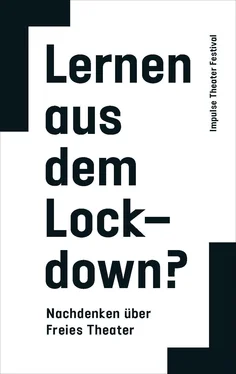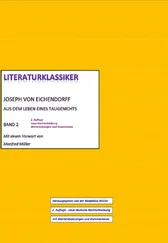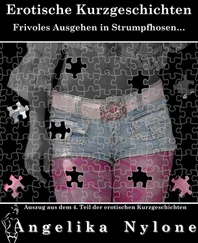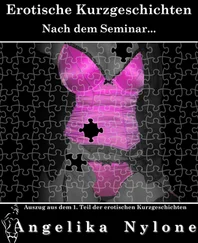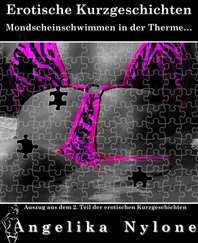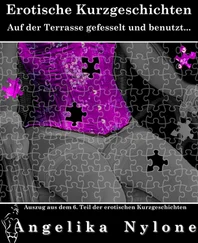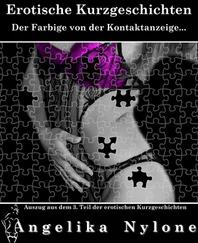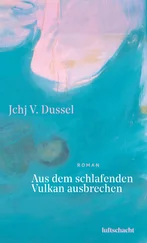Das Theater wird aber nur dann gestärkt aus der Krise hervorgehen, wenn es von vorne beginnt: bei seinem Programm und seinen Dramaturgien. 2018 drehten The Carters ihr „APES**T“-Video im Louvre und hatten schnell mehr Klicks als das Museum im ganzen Jahr Besucher*innen. Mona Lisa musste sich wie ein in die Jahre gekommener Stummfilmstar mit einer Statistinnenrolle begnügen. Traurig lächelnd schaute sie aus dem Hintergrund der Selbstkrönung einer Schwarzen Künstlerin zur Queen of Pop zu. In der Krise 2020 gehen TikTok-Tänze durch die Decke. Die Zuschauer*innenzahlen der Lockdown-Programme deutschsprachiger Kulturinstitutionen dümpeln jedoch im zweistelligen Bereich. Aus Millionen Menschen sind längst selbst mediatisierte Performer*innen geworden. Das Theater hat also nicht nur seine auratischen Aufführungsorte verloren, es muss auch noch auf denselben Plattformen wie falcopunch (mehr als acht Millionen Follower) und youneszarou (fünf Millionen Follower) um Aufmerksamkeit buhlen. Während die Lai*innen- und Alltagskultur in den ersten Tagen einen fulminanten Kreativitätsschub erlebt, dackelt die „Hochkultur“ mal wieder hinterher: Wozu Balkonkonzerte kuratieren, wenn die sich in vielen Nachbarschaften wie von selbst organisieren?
SZENEN EINER GESPALTENEN GESELLSCHAFT
„Die meiste Zeit sitzen wir in einem oder zwei Zimmern und arbeiten, während jeder uns zur Verfügung stehenden Sekunde. In fünf Jahren, erzählt mir jemand im Internet, wird es ein Drittel aller US-Amerikaner wahrscheinlich genauso machen: als Online-Freelancer freiberuflich und allein arbeiten.“ „Die Selbstsucht der anderen“, Kristin Dombek (2014)
Analoge Aufführungen fallen aus, die Theaterbühnen bleiben zu. In der unfreiwilligen Spielzeitpause wird frisch gestrichen, renoviert und Inventur gemacht. Die Programmverantwortlichen erproben zu Hause neue digitale Formate: Online-Inszenierungen und kontaktloses Theater, Live-Chats und Zoom-Panels, Screen-Sharings und Streams der guten alten Aufzeichnung von der Standkamera aus der letzten Reihe. Theater für alle (mit stabiler Internetverbindung). Die „neue“ Ästhetik des Splitscreens wird anscheinend zum Sinnbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Lockdown werden Wohnarbeitszimmer zum Guckkasten neuer Inszenierungsformen, die die Grenzen von Privatem und Professionellem verwischen lassen. Das Gegenwartstheater versammelt seine Akteur*innen in kleinen Kacheln unterteilt auf der Bühne des Screens. Auf allen Kanälen dasselbe Spiel: Dramaturg*innen und Künstler*innen beraten vor ewig gleichen Altbaukulissen, was zu tun ist. Hier und da ein Requisit bürgerlichen Dekors, aber irgendwie ironisch in Szene gesetzt. Weißer Stuck rahmt das Ganze.
Im Lockdown sind die Theatermacher*innen wie so viele in der Gesellschaft einer Illusion erlegen: dass sich in der Bedrohung durch einen pandemischen Virus alle in der gleichen Situation befinden. In der Krise tritt die Digitalisierung plötzlich wieder in ihrer alten Paraderolle auf, in der sie seit Mitte der 1990er Jahre niemand mehr sehen wollte: Sie darf noch einmal darbieten, dass das Internet eine grandiose Demokratiemaschine wäre. Und so verhüllt der Splitscreen im Freien Theater und anderswo seinen Apparat, der alte Ungleichheiten wiederholt und vergrößert. Die digitalen Formate und Dramaturgien sind Teil dieser Illusion, weil die Kacheln den Eindruck erzeugen, dass alle Akteur*innen wirklich den gleichen Background hätten.
Festangestellte Dramaturg*innen müssen den Apparat notgedrungen am Laufen halten. Die Risiken und Belastungen eines abrupt veränderten Bedarfs werden aber an die freischaffenden Künstler*innen outgesourct. Obwohl die Künstler*innen auf Ausfallhonorare hoffen und warten, machen viele Institutionen neue Rechnungen auf: Auch digitale Formatentwicklungen kosten Geld.
Die Neuerfindung des Theaters findet unter ungleichen Bedingungen statt. Während die großen Institutionen noch auf die Bedeutung der Kunst für Gesellschaft beharren, kratzen die Künstler*innen die nächste Miete zusammen. Und auch wenn Soli-Kampagnen so mancher Häuser Straßenzüge und Newsfeeds zieren, verschlimmert so manche kuratorische Idee die Ungleichheit in prekären Verhältnissen noch mehr. Die strukturelle Unterfinanzierung des Freien Theaters müssen nach wie vor vor allem die Künstler*innen aushalten und zugleich flexibel auf die Anfragen des digitalen Notprogramms reagieren.
Der Umbau des Apparats führt dazu, dass alte Illusionen weitergesponnen werden. Viele Programme erweckten vor der Krise den Eindruck, ihre Positionen und Perspektiven für ein breites Publikum in der postmigrantischen Gesellschaft zu diversifizieren. Was aber ausblieb, war bisher eine nachhaltige Veränderung des institutionellen Apparats, der vermehrt migrantisierte Künstler*innen auf die Bühne brachte. Die Institutionen werden bis heute vor allem von sozial privilegierten Theatermacher*innen betrieben. Insbesondere diskriminierte Künstler*innen müssen zur gleichen Zeit bangen, endgültig aus dem Spiel geworfen zu werden.
POSTMIGRANTISCHE PERSPEKTIVEN
„Voodoo, I can do what you do, easy“
Ready or not, The Fugees (1996)
Im Lockdown nimmt sich das Theater ganz viel vor. Auf seiner To-do-List steht: Nach der Krise muss ich die Kunst sein, die die postmigrantische Gesellschaft bei sich im Publikum versammelt. Tage und Wochen vergehen, und plötzlich ist so viel zu tun, dass das Theater vergisst, was früher schiefgelaufen ist. Es verzettelt sich mal wieder, denn schon vor der Krise hätte es besser mehr getan, als nur migrantisierte Künstler*innen in sein Programm zu integrieren. Auch wenn heute viel öfter von postmigrantischem Theater und Diversität die Rede ist, tun viele Institutionen so, als ginge es noch immer darum, sich „interkulturell zu öffnen“. Es geht aber nicht um die Bereitschaft weißer Dominanzkultur, sich selbst migrantisierte Positionen zur Seite zu stellen. Stattdessen müssen Institutionen lernen, dass sie keine Bollwerke sind, sondern flexible Systeme von Öffnung und Schließung. Theater muss lernen, seine Apparate ständig auseinanderzunehmen und neu zusammenzubauen, kaum dass sie zu laufen beginnen. Nachdem Deutschland jahrzehntelang seine Realität als Einwanderungsland verpennt hat, geht es nicht allein darum, bisher ausgeschlossene Akteur*innen, ihre Geschichte(n), Formate und Dramaturgien hereinzulassen. Ein postmigrantisches Theater ist nicht nur sein „diversitätssensibles“ Programm, es muss eine Institution sein, die sich kontinuierlich darauf vorbereitet, diejenigen am Apparat zu beteiligen, die in Zukunft noch dazukommen wollen.
Wenn das schon der Fall wäre, würde das Theater des Lockdowns vielleicht ganz anders aussehen. Das situierte Wissen von 70 Jahren Migrationsgeschichte(n) hätte Eingang in die Theaterarbeit gefunden. Denn lange bevor das Theater online ging, gab es schon Millionen Expert*innen für Homevideos in Deutschland. Mit Kassettenrecordern und Videokameras produzierten sogenannte Gastarbeiter*innen und ihre Familien schon mit modernsten Kommunikationstechnologien, als in weißen Amtszimmern noch von „Ausländerkulturarbeit“ die Rede war. Da wurden quer durchs Wohnzimmer bombastische Bühnenbilder gebaut, auf der Tanzbühne im Kinderzimmer probierte das Ensemble, und in der Küche schrie die Chefdramaturgin den Intendanten an. Wer solche Meisterwerke kennt, die als Kassetten- und Videobriefe an weit entfernte Verwandte und Freund*innen verschickt wurden, kann im Lockdown der Theater nur müde gähnen. Bereits 2004 analysierte Fatima El-Tayeb: „Das jüngste Medieninteresse an der ‚zweiten Generation‘ scheint kaum mehr als eine erneute Objektifizierung, eher hippes Saison-Thema als echtes Interesse an den Lebensumständen dieser neuentdeckten Gruppe.“ Stattdessen ist die Postmigrantisierung des Freien Theaters bereits vor der Pandemie ins Stocken geraten. Der Erfolg von Identitätspolitiken ist in ein kuratorisches Paradigma übersetzt worden, über das die Institutionen der Dominanzkultur die Sichtbarkeit marginalisierter Künstler*innen verwalten.
Читать дальше