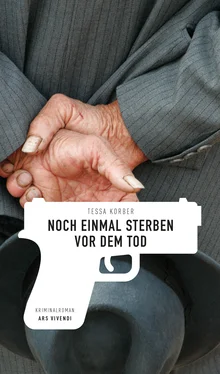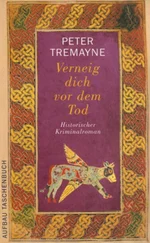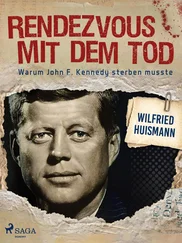Als er am Lift stand, erkannte er das Ausmaß ihres Problems. Der ganze weiträumige Aufzug, auf pflegebedürftige und behinderte Menschen eingestellt, war vollgestopft mit Gestalten wie jener, die ihn vergebens zu betreten suchte: Alte Männer und Frauen, in Anzügen und guten Kleidern, mehr oder weniger gebückt über ihre Rollatoren, standen dort dicht aneinandergedrängt und versuchten verzweifelt, die sich ineinander verhakenden Räder und Rollen auseinanderzuhalten. Man schob und zerrte, zupfte und lupfte, blickte argwöhnisch um sich, forderte Platz und verlangte Rücksichtnahme. Steinberger zweifelte daran, dass der ineinander verkeilte Haufen je wieder auseinanderfinden würde.
Der leicht entzündete Blick eines Mannes, der hilflos verrenkt in der Mitte gefangen war, traf den seinen: »Essenszeit«, sagte er resigniert.
»Mahlzeit!« Steinberger schob seine Besucherin mit einem nachdrücklichen Ruck in das Knäuel, sah die Tür vor die danteske Höllenszene gleiten und beschloss gerade, so lange es möglich war, die Treppe zu nehmen, als er, kurz bevor die Gleittür sich ganz geschlossen hatte, ein weiteres Gesicht sah. Eines, das seine Pupillen sich weiten und seinen Mund sich unwillkürlich öffnen ließ. Doch alles, was er hätte sagen können, hätte er dem Metallrücken der Tür sagen müssen.
2
Es dauerte eine Weile, bis Mauritius Steinberger den Abstieg aus dem achten Stock bewältigt hatte. Den größten Teil der Zeit verbrachte er auf einer Toilette neben dem Küchentrakt, wo er bemüht war, seinen Atem wieder zu normalisieren und seinen Knien das Zittern auszutreiben. Auf keinen Fall würde er Peter Quent hyperventilierend gegenübertreten.
Als es so weit war, schlüpfte er unauffällig in den weitläufigen Speisesaal. Er sah geneigte silberhaarige Köpfe, weiße Tischdecken, Blumengestecke, Weinkelche, Kochmützen und Servierschürzen, alles, was es brauchte, um das gepflegte Ambiente eines Hotels zu simulieren. Gestört wurde es nur von den vielen umherstehenden Gehhilfen. Angespannt musterte er die lichten Scheitel und gefurchten Gesichter. Das Gesicht von Peter Quent entdeckte er nicht.
Eine Servicekraft mit gestärkter Schürze wurde auf ihn aufmerksam und führte ihn, sein dringendes Sich-Umschauen missdeutend, an seinen Tisch, wo er aufgefordert wurde, zwischen den drei Tagesmenüs zu wählen. Seine Tischgenossen stellten sich vor und ermunterten ihn, ein wenig Konversation zu treiben. Das Gespräch plätscherte bald dahin, gebändigt durch gute Erziehung und Hinfälligkeit. Der eine oder andere funkelnde Blick traf ihn, doch Steinberger verstand es, ihn nicht zu erwidern. Außerdem war er nicht recht bei der Sache. Noch immer schweifte sein Blick durch den Saal. Es war die alte Gewohnheit des Jägers: Auf der Suche nach dem Wild, hinter dem er her war, musterte er den Rest rasch, sortierte und katalogisierte ihn und schob ihn als irrelevant beiseite. Bei ihm am Tisch saßen: die Spitznasige, der Besserwisser, die »Arme« – nach ihren wiederholten Bekundungen – und ein Mr. Siemens. Keiner von ihnen hatte das Zeug zum Gewalttäter. Keiner war Peter Quent. Doch Steinbergers Suche im weiteren Kreis blieb ebenfalls ergebnislos. Niemand sah Quent auch nur ähnlich. Verdächtig immerhin wirkte ein Mann mit Krücke und Freizeitkleidung, der mit einem prall gefüllten Rucksack zum Essen kam, den er dicht an sein heiles Bein stellte und in Abständen streichelte. Was da wohl drin war?, fragte sich Steinberger. Eine Frage, die ihn bei einer seiner Observationen interessiert hätte. Aber er war nicht beruflich hier. Er war nie mehr beruflich irgendwo.
Als er beim Dessert angelangt war, hatte sich schon die Ahnung Bahn zu brechen begonnen, dass er einer Verwechslung aufgesessen war, dem Aufblitzen einer Erinnerung, einer Freud’schen Fehlleistung. Peter Quent war nicht hier.
Am Fenster saß zwar ein Mann, der Quents Statur hatte, mittelgroß und schlank, von Natur aus elegant, und der eine ähnliche Neigung besaß, den Kopf hocherhoben zu halten. Doch das war auch alles. Am Nachbartisch ertönte ein ganz ähnliches Lachen, laut und raumgreifend, aufmerksamkeitsheischend. Da, dort hinten, nahe der Tür, war ein ungewöhnlich voller weißer Schopf auszumachen, über einer braun gebrannten Stirn. Aber Peter Quent gehörte er nicht.
Die Neigung Quents zu altmodisch-gutbürgerlicher Kleidung war gleich an mehreren der anwesenden Männer zu entdecken. Damals, Anfang der Neunziger, als Steinberger dem Bankraub in Lauf nachgegangen und auf Quent als Verdächtigen gestoßen war, hatte der Freizeitlook begonnen, seinen Siegeszug in der Mittelschicht anzutreten. Die ersten Grünen hatten Selbstgestricktes, Indienkleider und Sandalen für Erwachsene en vogue gemacht. Das Tragen von dandyesken Nadelstreifenjacketts, von Manschettenknöpfen und Hut war da eher ungewöhnlich erschienen. Als Quent ihm das erste Mal gegenüberstand, hatte der Mann Steinberger an eine Figur aus der Kindheit seines Sohnes erinnert, an Pan Tau. Und je länger das Essen dauerte, je ergebnisloser sein Umsehen blieb, umso mehr erschien es Steinberger so, als hätte er im Aufzug eine Märchengestalt gesehen, die nur an ihrem Hutrand zu wischen brauchte, um zu verschwinden. Am Ende hatte er nur einen Blick in seine eigene Vergangenheit getan, in die seltenen, so seltenen Nachmittage, an denen er mit seinem Sohn im Wohnzimmer gesessen und dessen Lieblingsserie geschaut hatte.
Wie auch anders?, sagte sich der alte Kommissar. In diesem Stift wohnten keine Bankräuber und Mörder.
Als er sich schon beinahe entspannt hatte und bereit war, an ein Hirngespinst zu glauben, fing Mauritius Steinberger aus den Augenwinkeln eine rasche Geste auf, ein Winken mit den Fingern, lässig, geringschätzig, beinahe tänzerisch. Wie oft hatte er diese Geste in Verhören bei Quent gesehen, Verhören, in denen sein, Steinbergers, »Ich seh dir bis ins Herz«-Blick nicht das Geringste bewirkt hatte. Ein unbekümmertes, souveränes Wischen war das gewesen, ausgeführt mit der unangezündeten Zigarette zwischen den Fingern, die zu rauchen im Befragungsraum nicht erlaubt war. Die Steinberger nicht zu rauchen erlaubt hatte. Und auch das schien Quent lediglich amüsiert zu haben. Unwillkürlich sprang Steinberger von seinem Stuhl auf. Halb aufgerichtet reckte er den Hals nach dem Urheber dieser Geste. Es war eine Dame mit androgynem Kurzhaarschnitt, großer Brille und einem baumelnden Medaillon vor dem Busen. Ihre langen Finger hielten einen Kugelschreiber, mit dem sie ein Kreuzworträtsel traktierte, unterstützt von ihren Tischgenossinnen. Nicht nur die erstaunten Blicke vom eigenen Tisch trafen Steinberger, der langsam wieder auf seinen Stuhl sank.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich dachte, ich hätte einen Bekannten gesehen.«
»Bekannte gehen ja noch«, meinte die spitznasige Dame links von ihm.
»Genau«, warf der Besserwisser sofort ein. »Schlimm wird es, wenn sie glauben, ihre Eltern zu sehen.«
»Wenn es bei mir so weit ist, hoffe ich, dass ich Claudia Cardinale sehen werde.« Der Siemensianer lachte dröhnend.
Die »Arme« an seiner Seite seufzte, und Mauritius Steinberger begann zu ahnen, dass diese beiden miteinander verheiratet waren. Das Gespräch nahm seinen zögernden Fortgang. Der alte Kommissar entspannte sich. Peter Quent war eine Einbildung.
Ein wenig mehr als das: Er war ein Schreckgespenst. Der einzige Fall, den er nicht gelöst hatte. Der einzige Verbrecher, den er nie hatte verhaften können. Der ihm eine Nase gedreht hatte. Sich aus allem rausgewunden. Ungreifbar. Steinberger würde nie den Moment vergessen, in dem er den tödlichen Unfall an der Bundesstraße bei Lauf und den Bankraub zusammenbrachte. Der Moment, in dem er sich über die Leiche des Jungen gebeugt hatte, von seinem Skateboard gefegt, am Straßenrand liegen gelassen, eine wütende Reifenspur im Grünstreifen, zeugend von der Fahrerflucht. »Wegen Ihrer Gier«, hatte er Quent damals entgegengeschleudert. »Weil Sie die 260.000 in Ihrem Kofferraum nicht aufs Spiel setzen wollten. 260.000 für das Leben eines Kindes.«
Читать дальше