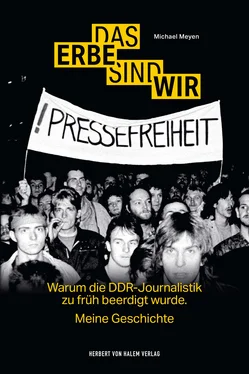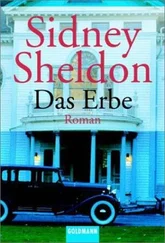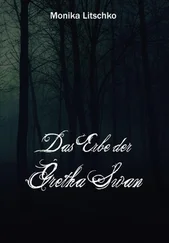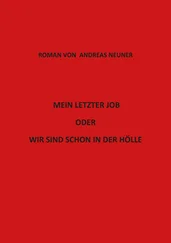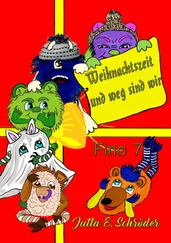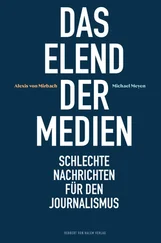In diesem Lager (um in Jans Bild zu bleiben) war ich dazu ausersehen, für gute Laune zu sorgen. Ist doch schön hier. Was nicht schön ist, wird schon noch. Habt Geduld. Im Zweifel ist der Kapitalismus schuld. Egal ob bei der Presse in Rostock oder beim Fernsehen in Berlin-Adlershof: In der DDR wurde man nur dann Journalist, wenn einem dieser Staat und seine Idee vom Sozialismus irgendwie gefielen. Ich habe mich immer amüsiert, wenn meine Studenten in München akribisch aufzählen wollten, was sich die SED alles ausgedacht hatte, um den Spielraum in den Redaktionen zu begrenzen. Agitationskommission, Abteilung Agitation, Donnerstags-Argu, Presseamt. Die Nachrichtenagentur ADN. Die Staatssicherheit. Und über allem der General-Chefredakteur, eine Rolle, die Erich Honecker viel mehr geliebt und gelebt hat als Walter Ulbricht. 4Das gab es, keine Frage. Nur: Wie überall steht und fällt auch in den Medien alles mit der Personalauswahl. Die Ostsee-Zeitung hätte nie und nimmer einen unsicheren Kantonisten eingestellt. Es war dort Mitte der 1980er-Jahre schon schwer, ein Volontariat zu bekommen, wenn man nicht versprechen wollte, gleich nach seinem 18. Geburtstag Kandidat der führenden Partei zu werden.
Ein SED-Mitglied an der Universität München. Ein kommunistischer Agitator. Ich werde später berichten, wie Ulrich Hörlein darauf reagiert hat, lange Ministerialdirigent im bayerischen Wissenschaftsministerium und dort 2002 für meine Berufung zuständig. So aufregend das für mich und meine Familie auch war (meine Frau bekam in dieser Zeit eine Gesichtslähmung, die man noch sehen kann, wenn man ganz genau hinschaut): Eigentlich ist das alles nichts, was man vor einem größeren Publikum ausbreiten sollte. Aus meinen Studien zur Medienlogik weiß ich, dass es dafür Prominenz braucht, Konflikte mit Spitzenleuten oder irgendetwas, das es so noch nicht gegeben hat. 5So vermessen kann niemand sein, der jeden Tag aus einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Haidhausen in ein kleines Universitätsinstitut am Rande des Englischen Gartens spaziert und dort Mühe hat, drei Retweets zu bekommen und den Vorlesungssaal bis zum Ende des Semesters wenigstens nicht ganz leer zu spielen.
WER WARUM DDR-GESCHICHTE SCHREIBT
Ich schreibe dieses Buch, weil es sonst niemand tut. Fast bin ich geneigt zu sagen: niemand tun kann. Wer Geschichte schreiben darf, bestimmt der Staat. Es braucht dafür eine Position im Wissenschaftsbetrieb (an einer Universität oder in einem Forschungsinstitut, in einem Museum oder in einer Behörde, die die Akten hütet). Natürlich kann sich jeder daheim an den Computer setzen und vorher vielleicht sogar in die Archive fahren, wenn sein Partner das denn toleriert und das Konto ein Auskommen sichert. Ohne eine Position im akademischen Feld aber bleibt das Selbstbefriedigung. Mehr noch: Es braucht eine Position am Machtpol dieses Feldes, um gehört (rezensiert, zitiert) zu werden. In der Wissenschaft ist Reputation alles und jedes Urteil über die Qualität von Forschung in diesem Licht zu lesen. Der Matthäus-Effekt 6: »Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat«.
Den Bürgerinnen und Bürgern der DDR ist ihre Geschichte genommen worden – zumindest all denen, die sich nicht wiederfinden in einem Narrativ, das vom Diskurs ›individuelle Freiheit‹ bestimmt wird und so ganz automatisch alles abwertet, was diese Freiheit einschränkt. 7Ein Staat, der sich offen einmischt in die Erziehung der Kinder, der den Feierabend in den Betrieben mitgestalten will und das Leben in Wohngemeinschaften und der zum Beispiel auch entscheidet, wie viele Menschen Journalistik studieren dürfen, und als Gegenleistung für den Studienplatz erwartet, dass jeder Absolvent die ersten drei Jahre nach dem Abschluss dort arbeitet, wo man ihn hinstellt.
Für meine Freundin und mich war das eine sehr konkrete Drohkulisse. Was tun, wenn der eine zurück an die Ostsee geschickt wird und der andere nach Karl-Marx-Stadt oder gar nach Hainichen? Wo würde unsere Tochter bleiben, die gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert hatte, als wir nach Leipzig kamen? Wir haben uns deshalb im Frühsommer 1989 einen Termin beim Standesamt besorgt (für den 1. September 1990, kurz vor Beginn des dritten Studienjahres, in dem die Kommission entscheiden sollte und das dann hoffentlich zum Wohl des frisch vermählten Paares tun würde), und ich habe schon im zweiten Semester begonnen, auf eine Promotion hinzuarbeiten, um vielleicht als Forschungsstudent in Leipzig bleiben zu können und damit in der Nähe aller Lokalredaktionen der Freien Presse . Beides hat uns dann tatsächlich geholfen, allerdings ganz anders als gedacht. Die Wohnung, die wir im Herbst 1989 in Flöha bekommen hatten, stand im Frühjahr 1990 plötzlich unter Privilegienverdacht. Zweieinhalb Zimmer in einem Plattenbau, der inzwischen abgerissen worden ist und in dem man damals den Nachbarn beim Pullern lauschen konnte. Keine große Sache. Schwiegervater war aber im Ehrenamt Vorsitzender der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft ›1. Mai‹ und wie alle Funktionäre plötzlich suspekt. Sollte er nicht doch der eigenen Tochter an allen Regeln vorbei etwas zugeschanzt haben, was nur Verheirateten zustand? Ein Glück, dass wir den Trausaal im Schloss Augustusburg schon lange reserviert hatten. Und nochmal Glück, weil aus der Dissertation eine Laufbahn in der Wissenschaft wurde und damit ein Lebensunterhalt für die Familie.
Zurück zum Thema: Strukturen wie das System aus Delegierung und Absolventenlenkung, das die SED im Mediensystem der DDR etabliert hatte, schränken das eigene Handeln ein. Immer und überall. 8Ich konnte nicht einfach an die Universität gehen und mich für Journalistik einschreiben, und mir wäre ganz sicher nicht in den Sinn gekommen, nach Abgabe der Diplomarbeit mal eben beim Fernsehen anzurufen und mich dort als Nachfolger von Heinz Florian Oertel zu bewerben. Genauso wenig komme ich heute aber auf die Idee, das zu verurteilen, was damals war. Ohne Strukturen kann man nicht handeln. Ich wusste, wie man in der DDR Journalist wird. Am besten schon in der Schule ein paar Beiträge schreiben für die örtliche Presse, vielleicht einen der Lehrgänge für Volkskorrespondenten besuchen, sich womöglich für einen längeren Wehrdienst verpflichten, wenn man ein Mann war (als Loyalitätsbeweis), auf jeden Fall ein Volontariat durchlaufen, von dort hoffentlich zur Aufnahmeprüfung für das Studium delegiert werden und schließlich mit einem Diplom in der Tasche die Welt verbessern. Warum nicht. Wie bei jeder Struktur war auch der Weg in den DDR-Journalismus längst nicht immer so geradlinig, wie ich ihn gerade skizziert habe. Es ging zum Beispiel auch ohne längeren Wehrdienst, und wenn Mama und Papa Beziehungen hatten, dann hat die Zeitung die Tochter aus gutem Hause auch ohne Textproben und Test genommen. Dazu später mehr.
Worauf es mir an dieser Stelle ankommt: Solche Geschichten aus dem Alltag werden nicht erzählt – zumindest nicht in den Leitmedien, die das DDR-Bild bestimmen, und auch nicht in den Schulbüchern oder in den Museen, die der Staat finanziert. Es gibt dort keine DDR ohne Stacheldraht, ohne bärbeißige Funktionäre und ohne Spitzel, obwohl der Geheimdienst längst nicht omnipräsent und den allermeisten Menschen vor dem Herbst 1989 eigentlich egal war. 9Was seitdem in der Öffentlichkeit über die DDR erzählt wird, dient vor allem dazu, das politische System der Bundesrepublik zu legitimieren. Dieser Staat lässt sich das etwas kosten und fährt dabei Geschütze auf, vor denen jeder Einzelforscher nur kapitulieren kann.
Unser ›Wissen‹ über die DDR ist Ergebnis einer Geschichtspolitik, bei der es auch um den Zugang zu Fördertöpfen und Steuergeldern ging und geht, um Eitelkeiten, um persönliche Macht. »Delegitimierung der DDR«: Das sei der »Sonderauftrag« für Joachim Gauck gewesen, schreibt Daniela Dahn, einst Journalistik-Studentin in Leipzig, in ihrer »Abrechnung« mit der »Einheit«. Dieser »Sonderauftrag« erlaubte Gauck, eine Behörde aufzubauen, die zeitweise 3.000 (!) Mitarbeiter hatte und jedes Jahr immer noch rund 100 Millionen Euro kostet. 10Das ist mehr Geld, als die Universität Bamberg in ihrem Etat hat, und erklärt, wie das entstehen konnte, was Wolfgang Wippermann »Diktatur des Verdachts« nennt. 11Folgt man diesem westdeutschen Historiker, Jahrgang 1945, dann wurde die ›Dämonisierung‹ des anderen deutschen Staates nicht nur von den Hütern der Stasiunterlagen vorangetrieben, sondern zum Beispiel auch vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Klaus Schroeder oder von Hubertus Knabe, der 1992 eine Stelle bei der Gauck-Behörde bekam, dann von 2000 bis 2018 Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen war und bei Wippermann als »Großinquisitor« firmiert. 12
Читать дальше