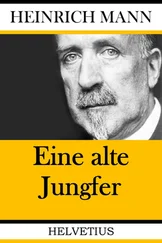Der Kellner, den sie am besten kennt, steht plötzlich in der Tür, ein Hauch von Mitleid ist in seinen neugierigen Augen zu sehen.
»Er kommt erst in einer Stunde.«
Die verschmähte Liebhaberin, die im Stich gelassene Braut, eine lächerliche Figur in jeder Beziehung. Der Fluchtimpuls ist überwältigend, trotzdem bleibt sie stehen.
Der Kellner hat sich bereits umgedreht, um wieder hineinzugehen.
» S’il vous plaît. «
»Oui?«
»Wo finde ich ihn?«
Sie sieht ihm direkt in die Augen, unterdrückt das Zittern in ihrer Stimme.
»Woher weiß ich, daß er dich sehen will?«
Der Kellner läßt eine Hand durch sein glänzend schwarzes Haar streichen, sein Blick ist etwas unsicher.
»Das will er.«
Sie hält seinen Blick fest, bis er die Achseln zuckt.
»Aber sei etwas diskret, ja?«
Er beugt sich vor, zeigt mit dem Daumen.
»Im vierten Stock«, sagt er und verschwindet wieder pfeifend im Restaurant.
Der Geruch nach Fritieröl und heißem Seifenwasser bildet in dem schmalen Treppenschacht eine fettige Spirale. Sie schleicht sich mit angehaltenem Atem an einer mattierten Glastür vorbei. Die Tür steht einen Spalt offen, und sie kann die Umrisse von Menschen dahinter erkennen, deren fleckenfreie Baumwollpullover und knisternde weiße Schürzen sie wie Pfleger in einer altmodischen Anstalt aussehen lassen, geisterhafte Wesen, die sich in dem Dunst bewegen. Ein Messer blitzt, die dumpfen Schläge eines Fleischklopfers punktieren den Lärm lauter Stimmen, klappernder Küchengeräte.
Die Türen mit dem verschrammten Metallbeschlag sehen aus, als könnten sie jeden Moment auf ihren abgenutzten Scharnieren aufschwingen und unbeschreibliche Gefahren freilassen. Hinter einer meint sie plötzlich die wütende Stimme des Onkels zu hören, dazu eine Frau, die ihm antwortet, schluchzend, in Tränen aufgelöst.
Der Schreck läßt sie stolpern, sie schlägt sich an der obersten Stufe der Treppe das Knie auf, bringt sich atemlos hinter einer halboffenen Tür in Sicherheit.
Fünf braun gestrichene Türen. Ein angelaufenes metallenes Waschbecken am Ende des Flurs, eine einen Spalt offene Tür zu einem Stehklo, der Metallstift der Wasserspülung klemmt, ein gebogenes Ausrufungszeichen. Die Luft in dem engen Flur ist schwer von warmem Staub, Naphtalin und Urin.
Mit pochenden Schläfen steht sie im Dämmerlicht des Dachfensters. Sie horcht angespannt in die Stille, kann aber keine menschlichen Geräusche hören, nur das Rauschen in den Rohren, die entlang der Flurdecke verlaufen, das Fallen des Wassers in einem Abfluß ein Stück entfernt.
Ein dunkelbrauner Schmetterling fliegt irgendwo aus den Schatten herauf, flattert samten vor ihrem Gesicht dahin und läßt sich still auf einem Türpfosten nieder.
»Yann.«
Ihre flüsternde Stimme ist rauh, sie räuspert sich, versucht es noch einmal.
Irgendwo hinter einer Tür knackt eine Bodendiele. Dann steht er da, eine Silhouette vor dem Licht aus dem Zimmerfenster, sie sieht die kleinen Härchen auf seinen Schultern in dem kräftigen Gegenlicht, goldene Daunen auf einer Frucht, und sie will ihn berühren, kann es aber nicht.
Stumm läßt er sie an sich vorbeigehen, ins Zimmer, schließt sorgfältig die Tür hinter ihr. Dreht ihr den Rücken zu, um ein Handtuch von einem Metallständer neben dem Waschbecken in der Zimmerecke zu nehmen. Sie starrt ihn wortlos an, sieht die Rasierutensilien auf dem Bord, die weißen Schaumspritzer auf dem Spiegel.
Hinter der Tür bleibt sie stehen und sieht, wie er sich das Gesicht abtrocknet, ein weißes Hemd von einer Stuhllehne nimmt, ihrem Blick ausweicht. Sie folgt ihm mit den Augen, während er sich die schwarze Schleife vor dem Spiegel umbindet, die Schaumspritzer mit dem Handrücken wegwischt. Seine Bewegungen sind abgemessen, energisch, ein Mann, der sich auf die entscheidende Schlacht vorbereitet und keine Kräfte verschwenden will. Ein fremder Mann, der ihr den Rücken zuwendet, seinen Gürtel öffnet, um das Hemd hineinzustopfen, es gerade zieht, sich aufrichtet und das Hemd mit mechanischen Bewegungen zuknöpft, sich wappnet.
Die Worte sammeln sich zu Sätzen in ihrem Mund, aber die Zunge klebt ihr am Gaumen, und sie ist stumm, außerstande, die Formel zu finden, die ihn wieder in Yann verwandelt, und sie kann es nicht in diesem Zimmer mit einem Fremden aushalten.
Die Tränen blenden sie, als sie stolpernd auf den Flur läuft, da hört sie seine Stimme hinter sich.
»Nanna.« Die Stimme klingt belegt, als hätte er seit vielen Tagen nicht mehr gesprochen. »Ich wäre gekommen.«
Er zieht sie wieder zu sich ins Zimmer, auf das ungemachte Bett.
»Ich wäre gekommen«, wiederholt er.
Auf seiner Oberlippe zeichnen sich Schweißtropfen ab, ein Blutstropfen an seiner Wange ist fast getrocknet, sie reibt ihn mit einem Finger weg.
»Sie hat nein gesagt.« Die Knöchel in ihren Händen schmerzen unter seinem Druck. »Ich bin alt genug, sie muß mir keine Erlaubnis geben, aber du verstehst nicht, was das bedeutet, meine Mutter und ich.«
Ein anderer hat die Entscheidung für sie getroffen, vielleicht ist das trotz allem das beste.
»Mein Vater«, sagt sie, will damit trösten, »der weiß nicht mal, daß es dich gibt.«
Sie spürt, wie er erstarrt, ihre Hände losläßt.
»Was willst du damit sagen?«
»Ich wollte es ihm sagen. Später.«
»Später? Wenn ich tot bin?«
Sie sieht an seinem verletzten Blick, daß sie ihn verraten hat, so wie er sie verraten hat, sie sind beide gefangen in dem Schatten ihrer Eltern, einem undurchdringlichen Netz.
»Soll ich gehen?« flüstert sie und hört, wie er nach Atem ringt.
»Wenn es das ist, was du willst.«
Seine Faust landet auf der Matratze, daß die Federn singen. Sie kommt auf die Beine, steht unentschlossen vor ihm.
Die Schweißflecken auf dem weißen Hemd, das Haar, das an der Stirn klebt, trotz der Scham in seinen Augen ist es ihr Mann, den sie jetzt sieht, und es besteht zwischen ihnen kein Abstand mehr, nur die verzweifelte Lust der überstandenen Anspannungen.
Die Honigsüße der Lindenbäume strömt durch das offene Fenster herein, vermischt sich mit dem Salz auf seiner Haut, der leichten Bitternis des Schweißes, und sie werden zu Zungen und Lippen, zu Zähnen und nackter Haut, eine Wildheit, die sie wie Beutetiere schüttelt, bis sie atemlos liegenbleiben.
Yann hat sich halb aufgerichtet, wühlt in einer Hosentasche.
»Warte.«
Sie nimmt ihm das kleine Päckchen aus der Hand.
»Nein«, sagt sie.
»Dein Vater ist kleiner geworden«, sagt die Stiefmutter.
Nanna hat ihr mit dem Abwasch nach dem Mittagessen geholfen, jetzt sitzen sie beide mit ihren Kaffeetassen vor dem Kamin im Wintergarten. Vater ruht sich in seinem Zimmer oben aus, müde von der Arbeit des Vormittags mit dem halbwüchsigen Jagdhund, der jetzt in seinem Korb an der Gartentür liegt und im Schlaf piepst.
Nanna zupft mit ihren Nägeln an einem losen Faden in der Armlehne des Sofas. Sie hat es auch gesehen, möchte es aber am liebsten nicht wahrhaben. Vater ist nach unten gewachsen, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hat, er ist grau und eingefallen geworden. Seine Wangen hängen, Cockerspanielohren über dem faltigen Hals, das ist jetzt deutlich zu sehen, wo er nicht mehr täglich einen Schlips trägt, sondern sich weiche Hemden mit Halstüchern und Tweedjacken angeschafft hat, der perfekte Country-Gentleman.
Das runde Gesicht der Stiefmutter unter dem aschblonden Haar hat senkrechte Falten bekommen, sie ist fünfundvierzig, sitzt mit einem herzkranken Mann weit draußen auf dem Land. Das Haus ist groß und schwer instand zu halten, mit Kaminen und Öfen in allen Zimmern, Vater will lebendiges Feuer um sich haben, friert aber in den hohen Räumen, wickelt sich in Decken ein. Die große unpraktische Küche schreit geradezu nach einer Hilfe, aber Nanna ahnt, daß die Frau, die ein paarmal in der Woche kommt und »das Gröbste macht«, wie die Stiefmutter sagt, alles ist, was das Budget erlaubt. Vater will mit Stil leben, und sein Bekanntenkreis, der aus seinen alten Jagdkameraden aus dem niederen Landadel der Gegend besteht, fordert ein gewisses Niveau hinsichtlich der Gastfreundschaft.
Читать дальше