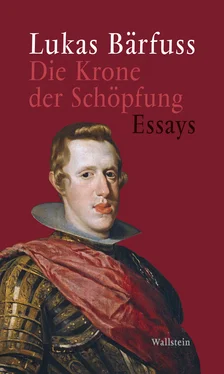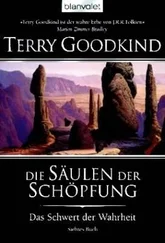Gemeinsam mit ihren dargestellten Figuren ersehnt diese Literatur die Erfahrung und das Leben, und weil es niemals geschieht, weil überhaupt nichts geschieht, spricht, wer diese Art von Literatur verteidigt, gerne über »Atmosphäre«, flüchtet sich in »die Stimmung«, in »das, was ungesagt bleibt«. Sie verzichtet auf eine historische Situation, arbeitet jedoch exzessiv mit dem Kolorit einer Epoche. So wird in dieser Erzählung ganz zu Beginn eine gewisse Jacqueline Kennedy erwähnt, besser gesagt ihre Frisur, die unsere Heldin nachahmt. Wer diese Person ist, wird nicht erklärt. Die Autorin geht stillschweigend von einem gemeinsamen kulturellen Hintergrund aus, der durch die Erwähnung eines toupierten Schopfs eine Kaskade von stereotypen Bildern auslöst: bestimmte Automobile, eine besondere Art von Musik, eine Kulisse, in der wir eine gewisse Zeit erkennen sollen, ohne länger darüber nachzudenken. Es handelt sich hier um eine weitere Andeutung, die ihre spezifische Funktion zu spielen hat.
Diese Erzählung ist zum ersten Mal im Jahre 2004 erschienen, das heißt, kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001, in einer Zeit, die von großer Verunsicherung geprägt war. Niemand wusste, in welche Richtung sich die gesellschaftliche Entwicklung bewegen würde. Die fünfziger und frühen sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, jene Epoche, da die gesellschaftliche Revolution von 1968 die Übersichtlichkeit und die Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Gruppen noch nicht eingerissen hatte, waren zu einer Zeit geworden, die ein Mensch jener Tage mit nostalgischen Gefühlen betrachtete. Es geht nicht um die Analyse einer Epoche, es geht um das Gefühl der Sehnsucht, und ihre belletristische Produktion folgt den Gesetzen eines bestimmten Marktes.
Ein literarischer Text im Spätkapitalismus muss, ganz im Einklang mit den Forderungen an irgendeine andere Ware, viel versprechen und wenig halten. Es ist sein Fetischcharakter, der ihm seinen Wert gibt. Der Fetisch steht für das Abwesende, das nicht Verfügbare. Der literarische Text darf nicht vollständig verstanden werden. Das Erzählen flüchtet sich deswegen in die Allegorie, in das andere Bild, in die Andeutung, den Verweis, damit wir dort als Leser ein Geheimnis vermuten, das niemals zur Sprache kommen kann und das wir ersehnen. An nichts leidet der bürgerliche Mensch so sehr wie an der Entzauberung seiner Existenz. Diese erzählerische Tendenz, diese Flucht vor der Klarheit und der Verständlichkeit findet vorderhand keine Korrektur, im Gegenteil, es scheint so etwas wie eine Eskalation zu geben. Je eindeutiger die Trivialliteratur wird, je mehr sie sich den absoluten Kategorien von Thriller und Porno angleicht, desto mehr flieht die sogenannte Belletristik ins Ungefähre. Das ist der Platz, der dieser Literatur geblieben ist, die Funktion, die sie zu erfüllen hat, und es scheint gut möglich zu sein, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Leserinnen und Leser die Literatur des ausgehenden zwanzigsten und beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts als grotesk empfinden werden, nicht wegen der Überzeichnung, sondern wegen exzessiver Langeweile.
Aber genug davon, nun endlich zu Scolytus scolytus und seinem Reifefraß, der am Anfang dieser Tragödie steht.
Alle lachen, niemand weiß, worüber
Zu Anton Tschechows »Der Kirschgarten«
Am 30. Januar 1904, einem Samstag, zeigte das Moskauer Künstlertheater in der Kamergersky Gasse zum ersten Mal das Stück »Der Kirschgarten« von Anton Pawlowitsch Tschechow, der am Tag zuvor vierundvierzig Jahre alt wurde und am Ende der Vorstellung die Ovationen des Publikums entgegennahm. Der Schriftsteller war dem Tode nahe und ein Ebenbild jener Karikatur, die ein Kritiker mit der Bemerkung, er sehe aus wie ein wandelnder Leichenwagen, von ihm gezeichnet hatte. Kein halbes Jahr später sollte Tschechow der Tuberkulose erliegen, in Badenweiler, einem Kurort im Schwarzwald, wohin er Ende Mai mit seiner Frau gereist war, geschwächt und entgegen dem Rat seiner Freunde und Ärzte. Wahrscheinlich wollte der Dichter einfach aus Moskau verschwinden, um seiner nächsten Umgebung das schreckliche Schauspiel seines Sterbens zu ersparen.
Es war aber nicht nur seine Krankheit, die Tschechow am Premierenabend behelligte und ihm die Feierlaune verdarb, es lag auch an der Inszenierung, die in keiner Weise seinen Vorstellungen entsprach. Dabei war das Künstlertheater unter der Führung von Konstantin Sergejewitsch Stanislawski und Wladimir Iwanowitsch Nemirowitsch-Dantschenko die führende Bühne Russlands, vielleicht das erste Theater Europas. Stanislawski, der in »Der Kirschgarten« schließlich die Rolle des Gajew spielen sollte, besaß einen grenzenlosen künstlerischen Ehrgeiz und wollte dem grassierenden Dilettantismus den Garaus machen.
Aber das hatte Tschechow nicht beruhigt. Den Herbst und Winter hindurch versuchte er von der Krim aus, wo er in Jalta ein Haus besaß, Einfluss auf die Besetzung und die Konzeption zu nehmen. Unablässig schrieb er Briefe an Nemirowitsch-Dantschenko, an Stanislawski und an seine Ehefrau Olga Leonardowna Knipper, die für die Hauptrolle der Ranjewskaja vorgesehen war. Im Oktober hatte der Dramatiker nach großen Mühen endlich die letzte Fassung ans Künstlertheater geschickt – aber auch jetzt entstanden täglich Probleme und Missverständnisse, die er ausräumen musste. In Moskau hegten sie völlig verquere Besetzungsideen. So wollte Nemirowitsch-Dantschenko die Rolle der Anja einer gewissen Maria Fëdorowna geben, obwohl diese dafür zu alt sei und gewiss die ganze Zeit nur heulen würde, obwohl diese Anja im ganzen Stück niemals weine und nur im zweiten Akt Tränen in den Augen habe – und nein, der dritte Akt spiele gewiss nicht in einem Hotel, auch wenn dieser grässliche Kritiker Nikolai Jefimowitsch Efros ebendies in seiner Zeitung behaupte. Und er, Tschechow, werde gewiss nicht weiter insistieren, um herauszufinden, auf welche Weise und durch wessen Hände diese Person an den Stücktext gelangt sei, und falls er in dieser Angelegenheit in früheren Briefen Unschuldige verdächtigt habe, so möge man ihm dies nachsehen. Ferner habe er vernommen, dass Stanislawski allen Ernstes daran denke, einen ganzen Zug über die Bühne fahren zu lassen, was nur dann hinzunehmen sei, wenn dies vollkommen ohne Geräusche geschehe. Frösche im Hintergrund? Dazu Wachtelkönige? Ausgeschlossen! Beides passe nicht zur Jahreszeit.
Wie viele seiner geringeren Kollegen in einer ähnlichen Situation versuchte auch einer der größten Dramatiker seine Vorstellungen des eigenen Stückes durchzusetzen, argumentierte und intrigierte – und fand sich trotz allem bald einem Missverständnis gegenüber, das seine Stücke bis auf den heutigen Tag begleitet. Niemand erkannte in seinem Stück jene Komödie, die er hatte schreiben wollen, und noch drei Monate nach der Premiere, am 10. April, stellt er in einem Brief an Frau Olga die Frage, warum auf den Plakaten und Zeitungsannoncen das Stück beständig »Drama« genannt werde. Man spürt die Verbitterung, die Resignation, überhaupt den Ärger mit dem Theater, der Tschechow auch in den letzten Monaten seines Lebens nicht verlassen sollte, und tatsächlich verfolgten ihn die Querelen um die Publikation seines Stückes bis auf das Totenbett im Schwarzwald.
Jeder Text, egal welcher Art, ob prosaisch oder dramatisch, ob literarisch oder pragmatisch, transportiert im selben Augenblick einen Sinn und einen Unsinn. Text entbehrt der Mimik, der Gestik, all der nonverbalen Mittel, mit denen wir unsere Sprache verständlich machen wollen. Die Begriffe erklären nichts endgültig, sie öffnen bloß einen Bedeutungskorridor. Jeder, der schon einmal einem Theater sein Stück zur Inszenierung überlassen hat, kann davon berichten, auf wie viele unterschiedliche und oft widersprüchliche Arten ein Satz gesprochen werden kann – einmal als Drohung oder als Trost, ernst oder ironisch, gleichzeitig als Frage oder als Antwort. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ein Schauspieler genau jene Variante wählen wird, die der Dramatiker für sich selbst ausgeschlossen hat.
Читать дальше