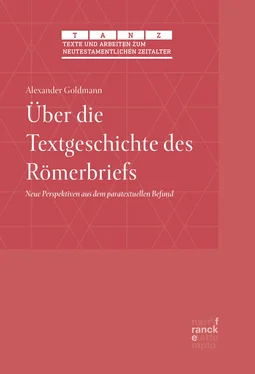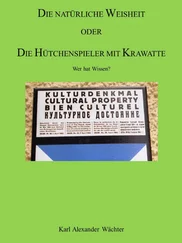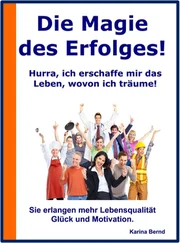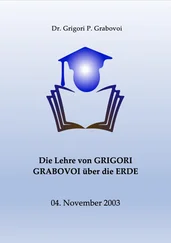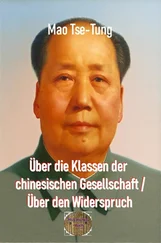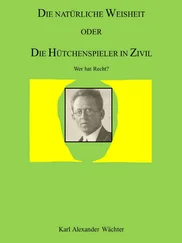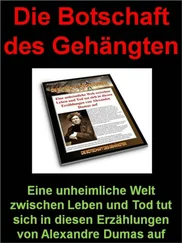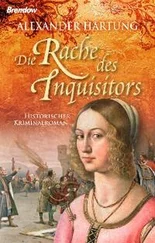Ihre ehemals gängige Bezeichnung als Marcionitische Prologe (= Prol Ma) verdanken sie den wegweisenden Studien von Donatien de BRUYNE8 und Peter CORSSEN,9 die unabhängig voneinander10 den marcionitischen Ursprung der argumenta zu den Paulusbriefen nachweisen wollten. Als Beleg ihrer Theorie führten de BRUYNE und CORSSEN sowohl formale als auch inhaltliche Überlegungen ins Feld. Einerseits rekonstruierten sie die ursprüngliche Reihenfolge (zumindest in den entscheidenden Teilen) der argumenta , die sich mit der von Tertullian und Epiphanius für Marcion bezeugten Anordnung der Briefe in dessen Apostolos deckte. Andererseits schien ihnen auch das in den Prologen entfaltete Paulusbild, gleichsam das inhaltliche Profil, für eine marcionitische Verfasserschaft derselben zu sprechen.
Die Tragweite und Überzeugungskraft dieser „epochemachend[en]“11 Entdeckung wird unschwer deutlich, führt man sich vor Augen, wie zahlreich und zeitnah die Reaktionen darauf erfolgten. In England erfuhr die Theorie unmittelbar Zustimmung von HARRIS (1907)12 und WORDSWORTH und WHITE (1913),13 in Deutschland waren es zunächst HARNACK (1907),14 ZAHN (1910)15 und LIETZMANN (1919),16 welche den marcionitischen Ursprung der Prologe für „eine ausgemachte Sache“17 bzw. als consensus doctorum 18 erachteten.
Die marcionitische Verfasserschaft der argumenta wurde als Erstes von MUNDLE (1925) in Frage gestellt.19 Dessen Studie kommt zu dem Resultat, „daß alles, was in den Prologen als marcionitische Anschauung […] gemeinhin angenommen ist, im Rahmen altkatholischer Paulusauslegung auch möglich war.“20 Konkret weist MUNDLE hier auf den Pauluskommentar des Ambrosiaster hin, den er sogar als literarische Vorlage der argumenta identifiziert.21 Wenngleich HARNACK MUNDLEs Einwände umgehend zurückwies,22 mehrten sich in der Folge diejenigen Positionen, welche den marcionitischen Ursprung der argumenta bezweifelten. So votierten FREDE (1964),23 REGUL (1969),24 FISCHER (1972)25 und GAMBLE (1977)26 dagegen, Marcion (bzw. einen Marcioniten) als Verfasser der Prologe zu betrachten. Eine innovative und überaus beachtenswerte Arbeit lieferte Nils Alstrup DAHL 1978.27 Auch er verneint die Annahme einer marcionitischen Verfasserschaft, verschiebt dabei aber erstmals die Perspektive der Untersuchung auf die dahinter liegende Briefsammlung, auf welche die Prologe zurückgehen. DAHLs Lösungsansatz wirkte für viele nachfolgende Studien richtungsweisend, sodass auch CLABEAUX (1989),28 SCHMID (1995)29 und EPP (2004)30 dagegen stimmten, die Prologe als marcionitisch zu verstehen.
Dieser Konsens ist in letzter Zeit allerdings wieder kritisiert worden, wie ein Blick auf die jüngsten Forschungen zum Thema belegt. SCHERBENSKE (2013),31 VINZENT (2014)32 und JONGKIND (2015)33 kommen übereinstimmend zu dem Fazit, sie als marcionitisch zu verstehen, ja sogar als „the rediscovered and recovered work of Marcion himself.“34
Nach diesem knappen Abriss der bisherigen Forschungsgeschichte wird es im Folgenden darum gehen, die Relevanz der Prologreihe im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausführlicher aufzuschlüsseln. Auch die Frage der Verfasserschaft der kompletten Serie muss aufs Neue diskutiert werden. Bis dahin wird in der vorliegenden Studie die neutrale Bezeichnung altlateinische Paulusprologe (statt marcionitische Prologe ) verwendet.
Das auffälligste Spezifikum der Prologe ist zweifellos ihre Reihenfolge. Zwar tauchen die Prologe in allen Handschriften, in denen sie zu finden sind, in der kanonischen Reihenfolge auf, d.h. in derjenigen Reihenfolge, in der auch die tatsächlichen Briefe zu lesen sind, für die sie gleichsam als Vorworte fungieren. Studiert man jedoch den genauen Wortlaut der Prologe, so fällt schnell auf, dass einige argumenta Rückbezüge enthalten und an zuvor Erwähntes anknüpfen. Liest man die Prologe also hintereinander, so treten diese Verklammerungen recht offen zutage und legen es tatsächlich nahe, dass die Prologe ursprünglich als kohärenter Text verfasst wurden. Allerdings stimmt die Reihenfolge der argumenta , die sich aus ihrem Inhalt und den besagten Rückbezügen ergibt, nicht mit der Reihenfolge der kanonischen Briefe überein, denen sie beigegeben sind.
Um festzustellen, welche Reihenfolge die Prologe bzw. die Briefsammlung originär hatte, für die sie ursprünglich verfasst worden sind, soll zunächst der Prolog zum ersten Korintherbrief in den Blick genommen werden. Dabei stellt sich die Frage, wie die Wendung et hi similiter zu verstehen ist – mit wem werden die Korinther hier gleichgesetzt? Auf wen ist dieser Rückbezug ausgerichtet? Die Römer können nicht gemeint sein, denn diese haben das Evangelium nicht von Paulus verkündet bekommen – das macht bereits der Prolog zum Römerbrief selbst deutlich, in dem davon die Rede ist, dass die römische Gemeinde auf das Wirken von falschen Aposteln zurückgeht (nicht also auf Paulus). Dagegen betont der Prolog zum Galaterbrief explizit, dass die Galater das Evangelium zuerst (!) von Paulus empfangen haben ( primum ab apostolo acceperunt ). Der Galaterprolog muss also erstens (sehr wahrscheinlich direkt) vor dem an die Korinther gestanden haben und zweitens führte er mit einiger Sicherheit auch die Sammlung an.
Weiterhin verwirrt im Prolog zum Brief an die Kolosser die im Eingangssatz zu lesende Wendung et hi sicut Laudicenses sunt Asiani . In der handschriftlichen Überlieferung geht dem Kolosserprolog der Prolog zum Brief an die Philipper voran. Bei den Philippern handelt es sich allerdings nicht um Asiani , sondern um Macedones . Stattdessen muss dem Kolosserprolog ursprünglich (unmittelbar) ein Prolog vorangegangen sein, der ebenfalls Asiani als Adressaten nennt – wahrscheinlich ist hier an eben jene im Kolosserprolog erwähnten Laodizener zu denken, da diese (neben den besagten Kolossern) im gesamten Prologkorpus die einzigen Asiani sind.1
Zuletzt erwähnt der Prolog zum Philipperbrief, dass auch (!) die Philipper Macedones sind ( Philippenses ipsi sunt Macedones ).2 Da im Rahmen der Prologe allein die Thessalonicher noch als Macedones vorgestellt werden, heißt das auch hier, dass – entgegen der kanonischen Reihung der beiden Briefe – der Philipperprolog ursprünglich nach dem Thessalonicherprolog zu lesen war.
Für die altlateinischen Prologe ergeben sich also folgende Eckpunkte bzgl. ihrer ursprünglichen Reihenfolge:
1 Der Prolog zum Galaterbrief stand unmittelbar vor dem Korintherprolog und eröffnete mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Sammlung.
2 Direkt vor dem Kolosserprolog war mit einiger Sicherheit der Prolog zu einem Brief an die Laodizener zu lesen.
3 Der (oder die) Prolog(e) zu den Thessalonicherbriefen fand(en) sich vor dem Philipperprolog.
All diese Schlussfolgerungen wurden in der Forschungsgeschichte zu den altlateinischen Paulusprologen zu keiner Zeit widerlegt. Zwar unternahm MUNDLE einen solchen Versuch, konnte allerdings nicht überzeugen.3 Nichtsdestoweniger weist er zu Recht darauf hin, dass die mutmaßliche Reihenfolge der Prologe noch lange nicht als zwingender Beweis für die marcionitische Verfasserschaft derselben gelten kann.4 Dennoch bleibt zunächst festzuhalten: die von den Prologen vorausgesetzte Reihenfolge der Paulusbriefe entspricht genau derjenigen, die anhand Tertullians und Epiphanius’ Zeugnis auch für den marcionitischen Apostolos gesichert scheint.5
Die nachfolgenden Überlegungen geschehen unter der weithin vertretenen Annahme, dass die Prologe ursprünglich als ein zusammenhängender Text, also eine Art Einleitung zu einer Sammlung von Paulusbriefen, entstanden sind. Fragt man nach dem originalen Umfang dieser altlateinischen Prologreihe, sind die Positionen weniger einhellig als bzgl. ihrer Reihenfolge. Folgende Probleme sind zu klären: Setzt die Prologreihe für die ursprünglich dahinter stehende Briefsammlung einen Brief an die Laodizener oder an die Epheser voraus? Sind die Prologe zu den Pastoralbriefen sekundär? Existierten ursprünglich auch Prologe zu 2 Kor und 2 Thess oder gab es jeweils nur einen Prolog zu den Korinther- bzw. Thessalonicherbriefen? In Hinblick auf den eigentlichen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist v. a. danach zu fragen, welche Version des Römerbriefes die Prologe voraussetzen. Für die Frage nach der marcionitischen Verfasserschaft der argumenta sind die genannten Fragen von einiger Bedeutung – denn Marcions Apostolos beinhaltete bekanntlich einerseits keine Pastoralbriefe, las andererseits den (kanonischen) Epheserbrief unter dem Titel Πρὸς Λαοδικέας und enthielt – wie später noch gezeigt wird – eine weitaus kürzere Version des Römerbriefes, in welcher u. a. die letzten beiden Kapitel fehlten.1
Читать дальше