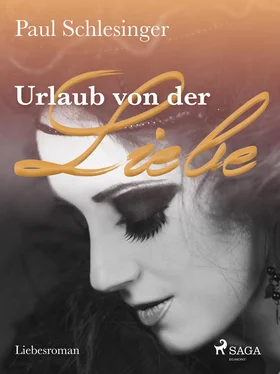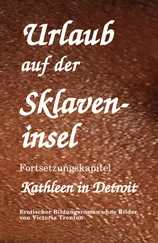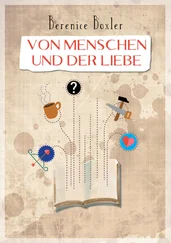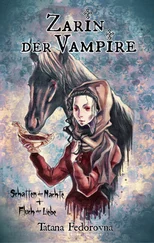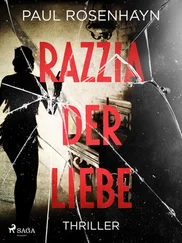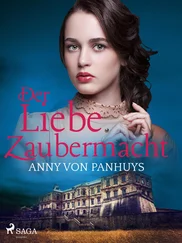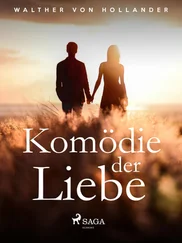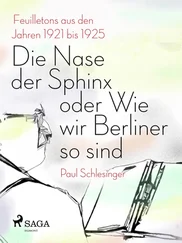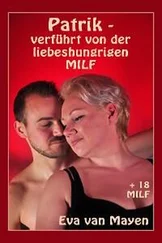Und an den schiefgestellten Spiegelscheiben der Auslagen begegnet Oskar Gundermann seinem eigenen Bild. Nein, es ist nicht erfreulich, wiewohl eine gewisse, längst abgenutzte Fröhlichkeit um die Augenwinkel an den frischen, ewig jungen, grossen Bruder Robert erinnert. Aber die Augen selbst sind weniger blau und weniger hart, der Schnurrbart lässt sich immer trüber zu den Mundwinkeln herab, und die Haut der Wange ist nicht prall und gerötet, sondern hängt lasch und faltig an den Knochen. Oskar Gundermann denkt auch heute an seinen Anzug. Er sieht genau jene feinen Merkmale, die schiefgeschnittenen Jackentaschen, die schwarzen Einfassungsborten, mit denen sich auch dieser Anzug in der Blüte seiner Entstehung von anderen Anzügen zu unterscheiden versuchte. Aber die Mode ist mit Riesenschritten vorwärtsgeschritten, und zurück blieb eine abgegriffene, verschollene Geckenhaftigkeit.
Und dann das Bäuchlein. Wie kam es und woher? Hatte man so reichlich zu essen, musste man sich nicht mit einem sehr gewissen Taschengeld begnügen, das in aller Oeffentlichkeit die Firma Robert Gundermann und Sohn mittels Postanweisung nach Steglitz sandte? Postanweisung für was? Ja, war man nicht Onkel, hatte man nicht das Talent gehabt, die schnurrigsten Geschichten zu erzählen? Hatte man nicht Bonbons in den Taschen für die Kinder und eine Zärtlichkeit auf den Lippen für die Frauen?
Oskar Gundermann schreitet die Fenster eines Warenhauses ab. Da ist eines in seiner ganzen Höhe und Breite gefüllt mit Aschbechern, Zigarrenabschneidern, Lesezeichen — alle von demselben Muster mit dem Eisernen Kreuz. Onkel Oskar schiebt die Unterlippe in die Höhe — Gundermann, Gundermann; wahrscheinlich lauter echte Gundermanns. Aber, lieber Gott, ist das wirklich das Ziel eines wohlgefälligeren Lebens als das meine? Ich will meinen Bruder bei Ihnen nicht anschwärzen, er ist vortrefflich, unterstützt mich, und ich verkenne die Wohltat keinen Augenblick. Er arbeitet, er hat eine überlegene Intelligenz, einen scharfen Blick, er meistert sein Schiff — aber dieser Aschbecher, ist er das Erzeugnis eines Geistes, der es sich erlauben darf, mir mit einer noch so freundlichen Herablassung zu begegnen? Es ist wahr, es lässt sich nicht leugnen: auch ich lebe von diesen Aschbechern, von dieser überlegenen Intelligenz, von dieser Augenschärfe! Aber — bin ich schon talentlos — würde ich nicht vielleicht besser leben, wenn Seine brüderliche Gnaden es noch ein bisschen weiter gebracht hätten? Ist eine Mietswohnung mit acht Zimmern das höchste der Ziele, selbst am Kurfürstendamm, selbst mit Zentralheizung? Oder wie, hätte sich nicht mein eigenes schwaches Daseinchen ganz anders entwickeln können, wenn des hohen Bruders Kraft und Zielbewusstsein sich auf etwas höherliegende Dinge gerichtet hätten? Ich will ihn nicht anschwärzen, lieber Gott. Aber man kann nicht wissen, und die Talentlosigkeit für Aschbecher beweist noch gar nichts ...
Als Onkel Oskar mit dem bescheidenen Abendbrot im Arm seine Wohnung betritt, findet er das Telegramm. Erst begreift er nicht und dann immer noch nicht. Es ist schon fast dunkel im Zimmer. Aber Onkel Oskar ist es noch zu hell. Er lässt die Rolläden herunterschnarren.
Nach einer halben Stunde macht er sich zum Ausgehen fertig. Unter dem grossen Bestande alter Kleidungsstücke hat er eines gewählt, das ernst genug ist und doch nicht auf einmal alles sagt. Dann aber nimmt er aus dem verschwiegensten Schubfach seines Schreibtisches die kleine verstaubte Nachbildung seines Eisernen Kreuzes von 70. Nein, er hat den Orden nicht getragen, auch nicht, wie so manche alten Herren, als der Krieg ausbrach. Aber heute soll er das Sprechen erleichtern. Und aus demselben Schubfach nimmt er einen weissen Brief, der Heinrichs Handschrift trägt.
Und wie er so zur Strassenbahn hinschlendert, geht ihm durch den Kopf: Sehen Sie, lieber Gott, es ist doch ganz gut, wenn einer in der Familie ist, dem man eine solche Nachricht ohne Vorbereitung vorsetzen kann, einer, der den Schlag verträgt! Ein Onkel sozusagen. Die Postanweisung macht sich schliesslich doch noch bezahlt.
Als Onkel Oskar auf den Balkon tritt, begegnet ihm ein kaltes Lächeln.
„Na, Oskar, du auch mal wieder?“
„Steglitz ist so weit.“
Und dann gibt’s ein Reden hin und her von gleichgültigen Dingen. Herr Robert Gundermann legt kaum die Zeitung aus der Hand. Aber Mathilde ist sofort aufgesprungen, dem Schwager noch ein Nachtmahl aufzutragen. Der hat es nicht hindern können und isst mit mechanischen Kaubewegungen ein paar Bissen, um schliesslich zu danken. Die elektrische Lampe bescheint nur einen engen Kreis, und das Eiserne Kreuz ist ausserhalb des Scheins geblieben. Das Essen wird hinausgetragen. Robert streckt dem Bruder die Zigarrenkiste hin, und Oskar greift zu.
„Du zitterst ja, Oskar.“
„Man wird nicht jünger, Robert.“
„Na ja, aber ich hatte das bei dir nie bemerkt.“
Fritz reicht dem Onkel das brennende Streichholz, und das Licht flammt bei dem kurzen heftigen Zuge hell auf.
„Du trägst ja dein Kreuz, Onkel?“
„Ach so, ja. Eigentlich eine kleine Bosheit von mir. Ich kam heute an einem Warenhausfenster vorbei. Da waren lauter Aschbecher mit dem Kreuz. Du kannst natürlich nicht dafür, Robert, dass du damals nicht im Felde warst. Aber warum soll ich so gänzlich schmucklos bleiben?“
Herr Gundermann schliesst ein bisschen die scharfen Augen, kneift die Lippen fester zusammen, um eine kräftigere Antwort zurückzuhalten. Dann sagt er:
„Und du fragst gar nicht nach Heinrich?“
Onkel Oskar bemüht sich, ein ganz harmloses Gesicht zu machen. Aber wann soll er denn eigentlich anfangen?
„Heinrich — nun ja — Heinrich — man wagt ja gar nicht so recht an da draussen zu denken.“
„Wieso?“ Robert sitzt ganz aufrecht im Lehnstuhl und hat die Zeitung endgültig aus den Händen gelegt. „Es geht doch vorwärts, gewaltig vorwärts.“
„Nun ja — Robert — es geht vorwärts, aber es kostet auch was.“
„Was — ja, was meinst du denn eigentlich?“ Mathilde sitzt auch steif aufgerichtet da, und Fritz meint für sich, dass die Mutter noch gar nicht die alte Frau sei. Sie ist wie sprungbereit. Die grauen Augen, die für alle Tage so verloren blicken, sind plötzlich mit Licht gefüllt. Der sanft gekrümmte Nacken, die Wange — Fritz sieht plötzlich unter dem grauen Schleier des Alters die junge Mutter. Dann sagt er:
„Weisst du, Onkel, man sollte den Eltern so etwas gar nicht vor die Augen halten. Die Dinge sind schlimm, und man bessert sie nicht, wenn man sie sich vorstellt.“
„Nein, Fritz,“ sagt Mathilde, „der Onkel hat recht. Ich habe an dich gedacht, wie du draussen warst, und ich denke an Heinrich. Aber es ist in unseren Gefühlen immer etwas, was sich beruhigen will, sich zufriedengeben. Und es kommen Briefe und Karten, und man wird wirklich ruhig und sitzt auf dem Balkon, als ob nichts wäre.“
Mutter Mathilde steht auf. Sie hat ihr Taschentuch in der zitternden Hand und geht mit unsicheren Schritten in das dunkle Wohnzimmer. Die drei Männer bleiben schweigend zurück, bis sie ein Schluchzen hören.
„Du hättest ihr das alles nicht sagen sollen, Oskar.“
„Ich habe ja doch nicht viel gesagt, Robert —“
„Nein, nicht viel, aber sie weint.“
„Frauen denken, wenn sie weinen.“
Robert sieht missbilligend auf den Bruder, steht auf, folgt seiner Frau ins Dunkle. Dann erhebt sich auch Fritz. Er tastet sich zurecht, stolpert fast über die Füsse des Vaters, der lang ausgestreckt im Lehnstuhl liegt — und findet endlich die Mutter, die auf dem Sofa sitzt und den Kopf mit beiden Händen auf den Tisch stützt. Endlich trottet Oskar hinterdrein, sucht sich aber ein bescheidenes Stühlchen nahe der Balkontür. Als sich die Augen gewöhnt haben, sehen sie ganz gut die verschwommenen Umrisse von Mutter und Sohn, ein bleiches Leuchten auf Robert Gundermanns kahlem Schädel, vor der Glastür aber den warmen Lichtschein, der das giftige Grün des wilden Weins und die roten Pelargonien so jäh aus dem Schlaf weckt.
Читать дальше