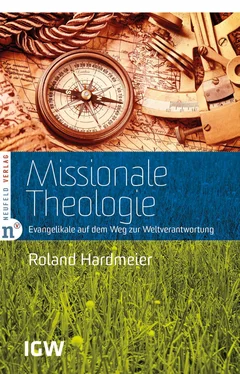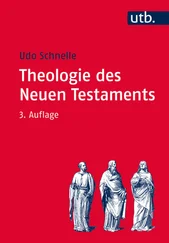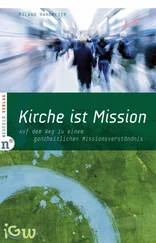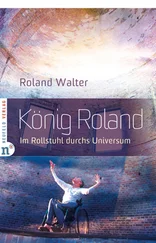Lieber Roland, vielen Dank für dieses Buch, das in die Hand aller gehört, die sich sachlich und engagiert mit dem Thema Missionale Theologie aus der Perspektive eines evangelikalen Autors befassen wollen – ja noch mehr: die an einer missionalen Lebensgestaltung interessiert sind.
Liestal, 2. Januar 2015
Dr. Bernhard Ott
Dekan der Akademie für Weltmission, Korntal
Studienleiter der Masterprogramme am Theologischen Seminar Bienenberg, Liestal
Vorsitzender der European Evangelical Accrediting Association
1.Missional – Modewort oder Paradigmenwechsel?
Seit einigen Jahren ist der Ausdruck „missional“ in der Theologie in aller Munde – auch in der evangelikalen Welt. Gemeinden geben sich eine missionale Ausrichtung. Theologische Ausbildungsstätten bieten missionale Programme an. Internationale Missionskonferenzen versehen den Auftrag der Kirche mit dem Attribut „missional“. 1In Büchern und Blogs wird eifrig diskutiert. Man spricht von Gesellschaftsrelevanz, der Ganzheitlichkeit des Evangeliums und davon, die Welt mit der Guten Nachricht zu transformieren. Kein Zweifel: Die Evangelikalen haben ihre Weltverantwortung entdeckt.
Die Reaktionen auf diese Entwicklung fallen unterschiedlich aus. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die in der missionalen Theologie einen Paradigmenwechsel erblicken. Sie glauben, dass wir uns in Richtung eines neuen Verständnisses von Kirche und ihrer Aufgabe in der Welt bewegen. Und dass diese neue Richtung notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Kirche in der postmodernen Welt das Evangelium glaubhaft bezeugen kann. Auf der anderen Seite stehen die, welche in der missionalen Theologie eine Gefahr erblicken und dabei auch schon mal von „Irrlehre“ und „antichristlichen Vorzeichen“ sprechen. Sie glauben, dass die eingeschlagene Richtung einer biblischen Grundlage entbehrt und zur Preisgabe des Evangeliums führt. 2Dazwischen gibt es eine „kritische Mitte“, die verschiedene Einsichten der missionalen Diskussion konstruktiv aufnimmt, den Anspruch der Bewegung insgesamt aber für gewagt hält. 3Hier ist man sich nicht sicher, ob „missional“ ein Modewort ist, das kommt und geht, wie viele andere theologische Begriffe in der Vergangenheit.
Die protestantische Mission blickt auf ein Jahrhundert dramatischen Wandels zurück. Die erste ökumenische Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 löste eine enorme missionarische Begeisterung aus. Man ließ sich in die Verantwortung nehmen, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, und sprach von einem „Wendepunkt in der Geschichte“, der „zu den größten Jahren in der Geschichte des Christentums“ führen könnte, wenn sie recht genutzt würden. 450 Jahre später hatte sich die protestantische Mission zu einem humanistischen Unternehmen gewandelt, in welchem persönliche Evangelisation nur noch eine Randerscheinung war. In einer von Armut und Ungerechtigkeit zerrissenen Welt wollte man nicht mehr bloß das Evangelium verkünden, sondern zu sozialem Wandel und politischer Befreiung beitragen.
Angesichts der liberalen Einflüsse schieden die evangelikalen Kräfte in den 1960er-Jahren aus der ökumenischen Bewegung aus und begannen, eigene Missionskonferenzen abzuhalten. Doch auch hier klopften die Nöte der Gegenwart hartnäckig an die Tür und erzwangen einen Wandel. Das zeigen schon die verwendeten Schlagwörter. In den 1970er-Jahren war die Rede von der „sozialen Verantwortung“. Intensiv wurde darüber diskutiert, welchen Platz diese im Sendungsauftrag der Kirche hat. In den 1980er-Jahren war dann die Rede von der „Transformation der Gesellschaft“, auf welche die Kirche hinwirken sollte. Mit diesem Begriff wurde zum Ausdruck gebracht, dass Christen sich für die Umwandlung (Transformation) der gesellschaftlichen Strukturen engagieren sollten. Aus dieser Diskussion entwickelte sich in den 1990er-Jahren der Gedanke eines „ganzheitlichen Missionsverständnisses“, das auch als „integral“ bezeichnet wird. Es besagt, dass die Kirche die Aufgabe hat, sich sowohl für die Verbreitung des Evangeliums als auch für die Veränderung der Welt einzusetzen. Seit der Jahrtausendwende setzt sich im deutschsprachigen Europa immer mehr der Begriff „missional“ durch. Er wird vor allem in Bezug auf den Gemeindebau verwendet, scheint sich allerdings als Überbegriff für einen ganzheitlichen Sendungsauftrag zu etablieren.
Der Begriff „missional“ stammt aus dem Englischen und bedeutete ursprünglich dasselbe wie „missionarisch“. Älteste Belege gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück. 5Nach Reppenhagen wurde der Begriff „missional“ in den 1970er-Jahren zum ersten Mal für die Beschreibung des missionarischen Wesens der Kirche verwendet. 6Reimer führt die heutige Bedeutung des Begriffs auf das Konzept der „Missio Dei“ auf der ökumenischen Weltmissionskonferenz in Willingen (1952) zurück, wo die Kirche von ihrem Wesen her als missionarisch verstanden wurde. 7In den 1980er- und 90er-Jahren begann sich der Begriff als Ausdruck eines Paradigmenwechsels von der sendenden zur gesandten Kirche zu etablieren. 8Schließlich brachte die Veröffentlichung des Buches Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America (1998) den Durchbruch für den Begriff.
Verschiedene Theologen werden mit dem Begriff „missional“ in Verbindung gebracht. Die meisten Befürworter einer missionalen Theologie nennen als Anreger den britischen Missionar und Missionswissenschaftler Lesslie Newbigin und den südafrikanischen Missiologen David Bosch. Ihr Beitrag zur Entstehung missionalen Denkens werde ich in Teil 4 ausführlich würdigen. Zu nennen wäre auch der nordamerikanische Mennonit John Howard Yoder, dessen Ekklesiologie missional war, bevor der Begriff gebräuchlich wurde, und der die Evangelikalen maßgeblich in Richtung einer missionalen Theologie beeinflusste. 9In Deutschland ist der Missionswissenschaftler und Gemeindegründer Johannes Reimer der profilierteste Vertreter.
Wo liegt der Unterschied?
Was will die missionale Theologie und wofür steht sie? Im Vordergrund der missionalen Diskussion steht die missionarische Aufgabe der Kirche in der Postmoderne: „Die missionale Theologie will Impulse und Denkanstöße für Mission und Evangelisation der Kirche des 21. Jahrhunderts vermitteln. Sie will grundsätzliche Fragen zur Gestalt der Gemeinde in der postmodernen und nachchristlichen Kultur diskutieren.“ 10Dabei geht es weniger um Gemeindemodelle als um eine Theologie der Kirche und ihres Auftrags: „Die missionale Theologie will keine Modelldiskussion führen, sondern intensiv über die Grundlagen der Kirche der Zukunft nachdenken.“ 11Im Zentrum der missionalen Theologie steht der sendende Gott, der sein Volk beruft, missionarische Vertreter seiner Liebe und Herrlichkeit zu sein. 12
Gilt eben Gesagtes nicht auch für das traditionelle Attribut „missionarisch“? Scharfe Abgrenzungen zwischen „missionarisch“ und „missional“ erweisen sich als schwierig, da beides damit zu tun hat, das Evangelium den Menschen zu bringen. Allerdings unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie dieser Auftrag verstanden wird. Auf die Gefahr hin, die Unterschiede zu überzeichnen, kann Folgendes gesagt werden:
Mission : Traditionell ist der Begriff „Mission“ ein geografischer Begriff . Mission fand in Übersee unter den nicht christianisierten Völkern statt. 13In der missionalen Theologie ist der Begriff „Mission“ ein Sendungsbegriff . Mission findet überall statt. Die Grenzen zwischen Heimat und Missionsland werden bewusst aufgehoben. Die missionale Theologie hat sich ganz besonders aus dem Bewusstsein entwickelt, dass der säkularisierte Westen Missionsland ist.
Читать дальше