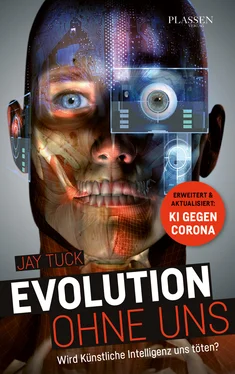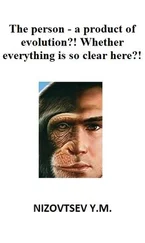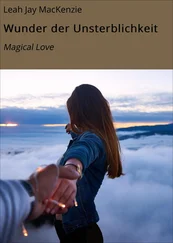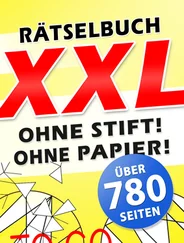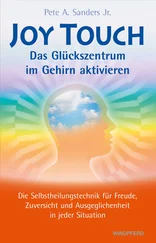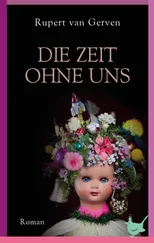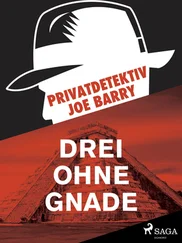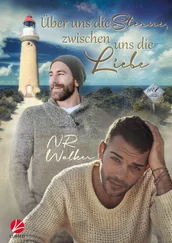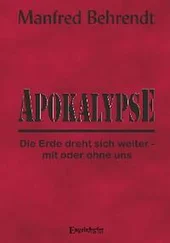Die Rede ist von Anatoli Kutscherena, profilierter Putin-Freund und Mitglied im Aufsichtsorgan des russischen Geheimdienstes FSB. Ohne seinen Segen, so berichten Besucher, läuft mit Snowden nichts.
In seiner Flüchtlingszeit bewies Snowden immer wieder einen ausgeprägten Sinn für Dramatik. Wenn er am Laptop tippte, zog er eine rote Kapuze über den Kopf, damit Überwachungskameras seine Passwörter nicht erfassen, wie er erklärte. Unter die Tür schob er ein Kissen, um Abhörmaßnahmen zu blockieren. Die Mobiltelefone von Besuchern packte er in den Kühlschrank, damit sie keine Signale abstrahlten.
Sicherheitsmaßnahmen waren auf jeden Fall erforderlich.
Der flüchtige amerikanische Spion war in akuter Gefahr.
Die US-Regierung wollte ihn haben.
Daran besteht kein Zweifel.
„Snowden hat mehr Schaden angerichtet als jeder andere Spion in der Geschichte unseres Landes“, so die Einschätzung des damaligen NSA-Chefs Keith Alexander. „Das wird unsere Arbeit die nächsten zwanzig bis dreißig Jahre beeinträchtigen.“ 10/11
Ein solcher Täter darf nicht unbehelligt davonkommen. Nicht aus Sicht der US-Dienste, die ihn im Verborgenen verfolgen. Und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen. Deutlich wurde das am 2. Juli 2013, als eine gewagte CIA-Operation fehlschlug.
An diesem Tag war Boliviens Präsident Evo Morales zu einem Staatsbesuch in Moskau. Es gab einen Geheimtipp: Snowden sollte an Bord des Präsidialjets heimlich aus dem Land geschmuggelt werden. So die Informationen. Daraufhin verweigerten mehrere EU-Länder den Überflug. Das Flugzeug des Präsidenten wurde zur unplanmäßigen Landung in Wien gezwungen.
Der Tipp entpuppte sich als Ente, die Aktion als Flop. Snowden war nicht an Bord. Diplomatisch war es ein Desaster. Aus ganz Europa folgte Kritik. Der österreichische Außenminister sah sich gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen. 12
Für die ganze Welt wurde sichtbar, wie weit die Amerikaner gehen würden, um den abtrünnigen NSA-Spion zu schnappen.
Die Enthüllungen von Edward Snowden machten Schlagzeilen.
Rund um die Welt.
Monatelang.
Mit dramatischen Folgen.
Bürger waren schockiert, Politiker empört, Nachrichtendienste verunsichert. Die Washingtoner Regierung wollte Snowden schnellstmöglich ins Gefängnis befördern. Deutsche Datenschützer feierten ihn als Helden. Einige wollten ihm Asyl gewähren, andere sogar für den Friedensnobelpreis nominieren.
Wie auch immer man die Taten von Edward Snowden wertet, eines steht fest: Seine Veröffentlichungen haben für große Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Der Umfang der gespeicherten Informationen, das merkten alle, hat unsere Gesellschaft unwiderruflich verändert.
Die Debatte um Big Data hat begonnen.
Und da Big Data nur von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden kann, wird die Debatte um Künstliche Intelligenz sehr bald folgen.
_____________
*Als Director of National Intelligence beaufsichtigt James Clapper u. a. Central Intelligence Agency (CIA), Defense Intelligence Agency (DIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), National Geospacial-Intelligence Agency (NGA), National Reconnaissance Office (NRO), National Security Agency (NSA), Drug Enforcement Agency (DEA), Department of Energy (DOE) und das Department of Homeland Security (DHS).
Big Data haben wir nicht kommen sehen. Mit einem Schlag war sie da, eine fast grenzenlose Speicherkapazität, fast grenzenlose Datenbestände, fast grenzenloses Überwachungspotenzial. Big Data ist das Ergebnis eines exponentiellen Wachstums in der Hardware-Industrie.
Wir sind heute erst dabei, die Konsequenzen zu verstehen.
Und das Wachstum setzt sich unaufhörlich fort.
Exponentiell.
Nach den Veröffentlichungen von Bradley „Chelsea“ Manning bei WikiLeaks und Edward Snowden in der Weltpresse wurde klar, dass die Menschheit am Ufer eines gigantischen Datenmeers steht. Wir schauen in die Ferne, können aber weder Weite noch Tiefe begreifen. Wir haben keine Übersicht, geschweige denn Kontrolle.
Der Speicherplatz, der hier entsteht, ist das Gedächtnis eines neuen Wesens, das der Menschheit bei Weitem überlegen sein wird. Das Gehirn kommt noch.
Solche Datenmassen sind nur durch Maschinen beherrschbar. Eine Erfassung, Verwaltung oder Auswertung durch Menschen ist undenkbar. Auch die Software, die Menschen schreiben, kann es nicht schaffen. Supercomputer mit Supersoftware sind die einzige Lösung. Big Data wird eines Tages das Gedächtnis einer neuen weltumspannenden Künstlichen Intelligenz (KI) werden.
Big Data hat das Potenzial, das Wissen der gesamten Menschheit zu erfassen, Informationsmassen, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Es könnte Bücher, Brockhaus-Enzyklopädien und sogar sämtliche Bibliotheken der Welt zur Makulatur machen.
In den ersten vierzehn Jahren seiner Existenz ist der Datenumfang von Wikipedia allein in englischer Sprache auf über fünf Millionen Beiträge gewachsen. Weltweit enthält das Werk heute 28 Milliarden Wörter in 52 Millionen Artikeln in 309 Sprachen. Zwischen dem Schreiben dieses Manuskripts und der Veröffentlichung als Buch ist davon auszugehen, dass Wikipedia sich schon wieder verdoppeln wird.
Manning und Snowden haben geholfen, die Folgen von Big Data für die Weltöffentlichkeit anschaulich zu machen. Schockierende Schlagzeilen, düstere Leitartikel und polemisierende Politiker taten den Rest.
Die öffentliche Beunruhigung richtet sich fast ausschließlich auf staatliche Daten, insbesondere auf die US-Abhörbehörde National Security Agency, NSA. Sie ist keineswegs der einzige Datensammler, der unsere Intimsphäre verletzt, vielleicht auch nicht der gefährlichste.
Interessanterweise waren einige der sogenannten Enthüllungen von Edward Snowden inhaltlich nicht neu. Einige Presseberichte wurden aufgebauscht, einiges an Empörung geheuchelt.
Aber die Bevölkerung hat eines verstanden:
Big Data bedeutet Big Danger.
Es war vor allem das Abhören des Handys von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Deutschland wachgerüttelt hat. Es war eine persönliche Attacke gegen seine Bundeskanzlerin. Wenn die Privatsphäre von „Mutti“ Merkel für die alliierten Freunde in Amerika nicht heilig ist, wie steht es mit dir und mir? Bundesbürger begannen zu begreifen, was Big Data in der Spionagewelt von heute bedeutet: Die Öffentlichkeit wird komplett beobachtet.
Seinerzeit war die Öffentlichkeit erschüttert.
Das Vertrauen in den transatlantischen Bündnispartner ebenso.
„Einen Angriff auf die Souveränität eines demokratischen Staates“ nannte das Thomas Oppermann (SPD), Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollkommission im deutschen Bundestag. „Wer so dreist ist, der hat auch keine Hemmung, die Mobiltelefone der Bürger abzuhören und ihre E-Mails zu lesen.“
Über „einen schweren Vertrauensbruch“ beschwerte sich der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU). „Nicht hinnehmbar“, schimpfte Belgiens Regierungschef Elio Di Rupo. Der damalige EU-Kommissionschef José Manuel Barroso warnte gar vor „Totalitarismus“. In der Presse gab es zahlreiche Vergleiche mit den Abhörpraktiken der DDR-Staatssicherheit.
Das persönliche Mobiltelefon der Bundeskanzlerin anzapfen, fragten viele, wie geht das technisch?
In der Presse kursierten die schrillsten Erklärungen. Stern-TV machte „den Abhörtest“ 13. In einer Sendung vom 30. Oktober 2013 stellten sich Redakteure auf dem Rasen vor dem Reichstag auf die Lauer. Aus einem geparkten Minibus demonstrierten sie, wie man mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers in der Nähe befindliche Mobiltelefone orten und identifizieren, abhören und die Daten abspeichern kann.
Читать дальше