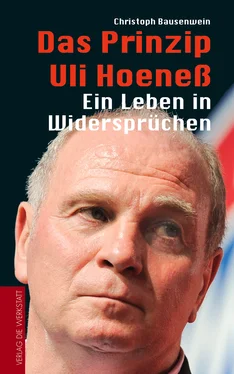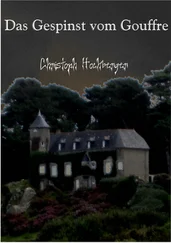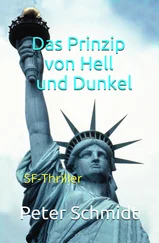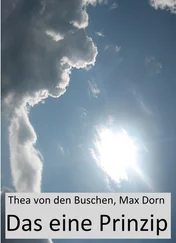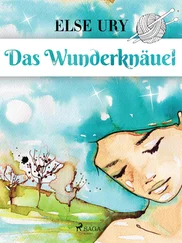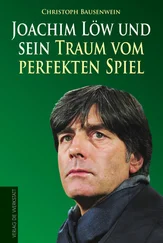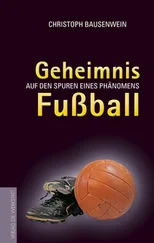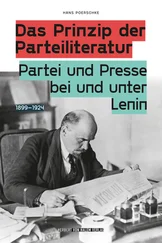In einem aber waren und blieben die Eltern Vorbild: in der Vorsicht, das Geld zusammenzuhalten. Im Haus von Erwin und Paula Hoeneß wurde nie mehr Geld ausgegeben, als da war, Schuldenmachen war verpönt. Sohn Uli hielt sich an das elterliche Gebot, und der Gedanke an eine Kreditaufnahme sollte ihm auch in seinen späteren Jahren als Bayern-Manager stets zuwider bleiben. »Das ist eine rein menschliche Sache«, begründete er diese schwäbische Bedachtsamkeit. »Manche können mit Schulden leben und sind bereit, gewisse Risiken einzugehen. Meine Sache ist das nicht. Ich habe noch nie Schulden gemacht, auch im Privaten nicht.« Insofern ist es wohl kein Zufall, dass er seinen ersten großen geschäftlichen Erfolg als »Schuldenvernichter« feierte: Als Schulsprecher des Schubart-Gymnasiums sanierte er die defizitäre Schülerzeitung. Der Chefredakteur war ein guter Schreiber, aber ein Chaot. Also ließ Hoeneß ihn schreiben, während er sich um die Geldbeschaffung kümmerte. Und bald hatte er so viele Anzeigenkunden für die »Schubart-Chronik« geworben, dass alle finanziellen Sorgen der Vergangenheit angehörten. »Plötzlich hatten wir einen Überschuss«, berichtete Uli Hoeneß stolz, »und mit dem haben wir jedes Jahr ein Riesenschulfest für 2.000 Leute veranstaltet.« Geradezu »legendär« seien diese Schulfeste in seiner »Ägide« gewesen, schwärmte noch der Fünfzigjährige: »Höhepunkte in Ulms Kulturleben.« Alle seien begeistert gewesen, vor allem seine Kumpels, die als Ordner arbeiteten und dafür Freibier erhielten. »Einer hat 25 Halbe geschafft an einem Tag.«
Der Macher selbst langte beim Bier weniger hin und erfreute sich vielmehr an einem anderen angenehmen Nebeneffekt seiner Tätigkeit. Zur Professionalisierung der Schülerzeitung hatte er eine Kooperation mit einer Mädchen-Realschule initiiert und dabei ein nettes Mädchen kennen gelernt, das dort Schulsprecherin war. »Wir waren ein erfolgreiches Gespann und hatten tollen Erfolg bei den Geschäftsleuten, die wir zusammen abklapperten«, erinnerte sich die spätere Susi Hoeneß und war voller Stolz auf ihren Uli, der sich geradezu als Werbegenie erwies. »Ihm fiel immer wieder etwas Neues ein, wenn es darum ging, die Zeitung zu finanzieren.« Auch der Geldeintreiber vom Schubart-Gymnasium war zufrieden mit sich und genoss die Anerkennung, die er sich erarbeitet hatte. Ein Klassenkamerad charakterisierte seinen Mitschüler mit den Worten: »Hoeneß hat immer Sachen für die Allgemeinheit getan. Aber ihm war auch klar, dass er sich damit eine gewisse Position verschaffen konnte.« Der junge Uli Hoeneß war ein psychisch Frühreifer und das, was man im Schwabenland ein »Gscheitle« nennt. Im Prinzip immer redlich, mitunter schlitzohrig, vor allem aber äußerst ehrgeizig und stets etwas vorlaut eine geistige Überlegenheit herauskehrend.
Der Fußball blieb freilich weiterhin die Hauptsache im Leben des Uli Hoeneß. Bereits als Siebzehnjähriger war der angehende Fußballstar Thema einer Sendung im Südfunk-Fernsehen. Der Film zeigt den stets mit guten Noten glänzenden Vorzeigeschüler beim Unterricht im Schubart-Gymnasium, bei einer Sitzung des Schülerrates, dessen Vorsitzender er war, bei einem Fußballspiel im Ulmer Stadion zwischen einer Auswahl des Schubart-Gymnasiums und des Gymnasiums Ellwangen, das die Ulmer mit Hilfe zweier Hoeneß-Tore 4:2 gewannen, beim Training mit Ulm 1846, beim konzentrierten Erledigen der Hausaufgaben, schließlich beim Tennisspielen. Er erschien wie ein Tausendsassa, dem man alles zutrauen konnte.
Eine leichte Trübung dieses Bildes gab es erst, als er sich nach dem Abitur – da hatte er bereits einen Vertrag bei den Bayern – zum Studium der Betriebswirtschaft an der Maximilians-Universität in München anmelden wollte. Da er aus Baden-Württemberg kam, wurde ihm der Numerus Clausus zum Verhängnis. Der lag bei 3,0 und war eigentlich keine große Hürde, aber als Nicht-Bayer bekam er einen Malus von einer ganzen Note – und so wurde aus seiner Abi-Durchschnittsnote von 2,4 eine 3,4. An die große Glocke gehängt hat er das damals nicht, und vermutlich hielt sich eben deswegen in der Sportpresse noch lange Zeit die Auffassung, er sei ein Einser-Abiturient gewesen. Anfangs sei er sehr ehrgeizig und oft Klassenbester gewesen – im Gegensatz zum Bruder Dieter, der einmal eine Ehrenrunde hatte drehen müssen. Uli hatte erst im Alter von etwa 15 Jahren etwas nachgelassen, als der Fußball immer wichtiger geworden war. Immerhin sei sein Notendurchschnitt aber ganz beachtlich gewesen, betonte er, zumal er im letzten Schuljahr wegen des Fußballs 50 Tage gefehlt habe.
Uli Hoeneß schrieb sich für ein Lehramtsstudium in Anglistik und Geschichte ein. Mit einer allzu großen Überzeugung stand er nicht dahinter, er tat es wohl vor allem seiner Mutter Paula zuliebe, die ihn gerne als Lehrer gesehen hätte und besonders stolz auf die Schulpreise war, die er in den Sprachen abgeräumt hatte. Die Eltern, so Hoeneß, hätten immer größten Wert auf eine solide Ausbildung gelegt. Vor allem die Mutter, die in der Familie die starke Person gewesen sei, habe sich auf Fußball nie verlassen. »Sie hat viel mehr Wert darauf gelegt, dass wir das Abitur machten. Eine Karriere als Fußballer war ja längst nicht das wie heute. Es war gar nicht im Bereich des Vorstellbaren.«
Die Mutter bestand auch darauf, dass die Söhne nach dem Abitur an die Uni gingen, damit aus ihnen »was G’scheit’s« werde. So nahmen beide Söhne ein Lehramtsstudium auf, wobei Uli weniger Kondition bewies. Zwei Jahre später war dem zum Nationalspieler avancierten Profi das Nebeneinander von Studium und Fußball zu viel geworden, und er konzentrierte sich, trotz der Skepsis der Mutter, voll auf seine sportliche Karriere. Paula Hoeneß verließen ihre Zweifel auch nicht, als er auf den Managerposten gewechselt war und nun das Kaufmännische im Vordergrund stand. »Nach jeder Niederlage fürchtete sie, ich werde entlassen«, berichtete er über ihre Existenzängste. Irritieren ließ sich der Sohn davon aber nicht, und er war froh darüber. »Ohne Fußball wäre ich wohl in der Provinz der Stadt Ulm untergegangen. Ich wäre vielleicht Lehrer.« Überhaupt hatte Uli Hoeneß vor den Studierten wie vor dem Studium als solchen nicht allzu viel Respekt. »Wenn ich Mathematikprofessor oder Physiker werden will, brauche ich ein Studium«, meinte er. »Aber um einen kaufmännischen Beruf auszuüben, in dem jeden Tag etwas Neues passiert, muss ich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag studieren.« Der stets am realen Geschehen orientierte Tatmensch fand seine Lebensmaximen nicht im Pauken trockenen Bücherstoffes, sondern in der täglichen Praxis des »learning by doing«.
Auf jedem Gebiet allerdings funktionierte das Prinzip des »Lernens durch Handeln« nicht. Der Schüler Hoeneß lag wohl ganz richtig, als er bei der Schülerzeitung nicht die Stelle des Chefredakteurs anstrebte, denn der Versuch, sich selbst als Hobby-Journalist bei der »Südwest Presse« zu profilieren, endete wenig glücklich. Am 4. November 1972 erschien seine erste Kolumne in der Ulmer Heimatzeitung mit dem Titel: »Das meine ich«. Pro Artikel erhielt der Nachwuchsstar des FC Bayern, der in der Schule stets gut benotete Deutschaufsätze abgeliefert hatte, 150 DM. Die Serie erschien mit einem Foto des Autors, das ihn hinter einer Schreibmaschine sitzend zeigt, den Kopf im Denkergestus auf die Hand gestützt. Er nutzte den Raum vorwiegend zur Selbstdarstellung und zu recht belanglosen Betrachtungen. Einen Blick hinter die Kulissen des FC Bayern, den sich die Blattmacher eigentlich versprochen hatten, gewährte er nicht. Und so wurde die Kolumne schon bald ersatzlos gestrichen.
Der Zimmergenosse und Geschäftspartner
»Uli Hoeneß und ich haben uns 1967 bei einem Turnier der süddeutschen Jugendauswahl kennen gelernt«, berichtete Paul Breitner über den Beginn einer langjährigen Freundschaft. Die beiden Fünfzehnjährigen waren damals auf ein Zimmer gelegt worden. Kurz darauf trafen sie sich in der deutschen Jugendnationalmannschaft wieder, und als sie gleichzeitig beim FC Bayern anheuerten, waren sie erneut beisammen. In München bewohnten die beiden ein gemeinsames Appartement in Trudering, bei Trainingslagern und Auswärtsspielen schliefen sie in einem Doppelbett. Das Verhältnis war eng zwischen den beiden, sehr eng. So eng, dass sie schon bald als »siamesische Zwillinge« bezeichnet wurden. »Jeder kannte von dem anderen alles«, so Breitner. »Es war so, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt haben: Es ist eigentlich egal, wer ans Telefon geht, wenn’s läutet. Weil: Beide wissen sowieso, worum’s geht, beide können für den anderen antworten.«
Читать дальше