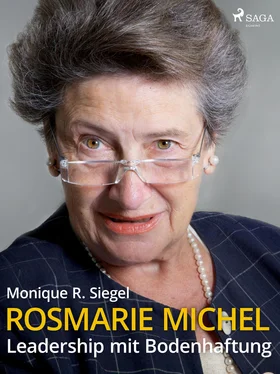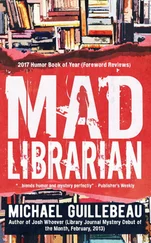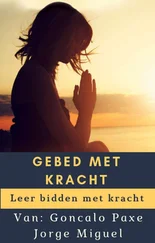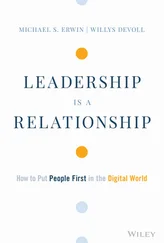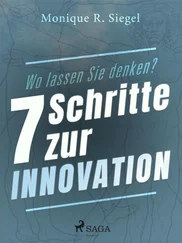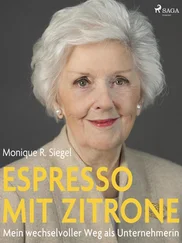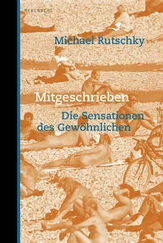Letzteres hat ihm dann doch noch die Liebe seines Lebens beschert. Als er Trudy Schurter bittet, seine Frau zu werden, lehnt sie ab. Der junge Mann, acht Jahre älter als sie, ist als Hotelier mit internationaler Ausrichtung tätig, und sie möchte Zürich nicht verlassen. Enttäuscht sucht er Trost im entfernten Ägypten: In Luxor ist er Direktor der Upper-Egypt Hotels. Doch sie wird ihn vermissen, so sehr, dass sie nach seiner Rückkehr die Initiative ergreifen wird ...
Nach einem Versuch, sich im Schurterschen Geschäft zu betätigen, zieht es ihn wieder in seinen angestammten Beruf, die Gastronomie. Er übernimmt als erster Pächter das renommierte Zürcher Gesellschaftshaus «Zum Rüden». Seine Frau ist einverstanden, auch wenn sie dafür ein Haus mit Seeanstoss in Meilen verkaufen muss. Hinzu kommt, dass sie jetzt alle Arbeiten für die Confiserie alleine bewältigen und zusätzlich noch Aufgaben hinter den Kulissen des Restaurants übernehmen muss. Für ihren Mann ist es jedoch der richtige Schritt, und sie wird ihn unterstützen, bis er Mitte der 50er-Jahre krank wird und nicht mehr voll arbeiten kann.
Mein Vater war der Inbegriff eines korrekten, weltgewandten, international tätigen Hoteliers, immer im dreiteiligen Anzug und mit Hut. Er war ein sehr guter Ehemann, der meine Mutter geliebt und verwöhnt hat, und ein liebevoller Vater. Wir waren eine Vierereinheit, ein kompaktes Team, und wir haben jedes Jahr wunderschöne Ferien zu viert verbracht.
Meine Eltern hatten allerdings sehr verschiedene Interessen, die sie ganz unabhängig verfolgten. So war zum Beispiel meine Mutter eine begeisterte Bergsteigerin, die in den Ferien am liebsten jeden Schweizer Berg erklommen hätte, während mein Vater dem nichts abgewinnen konnte, dafür aber seine grossen, bequemen Autos liebte. Der demokratische Beschluss: Wir Kinder verbrachten in den Bergferien meistens einen Tag mit dem Aufstieg zu irgendeiner Bergspitze – wobei das Einkehren in einer Berghütte natürlich nicht fehlen durfte – und den nächsten in Papis Auto. Da er Cabriolets liebte, wurden mein Bruder und ich «verkleidet», mit eng anliegender Kappe und den sogenannten Staubmänteln, genossen aber sowohl die Fahrt selbst als auch die Aufmerksamkeit, die man dem schönen Auto seitens der Fussgänger entgegenbrachte.
Die andere grosse Leidenschaft meines Vaters war das Filmen, wobei er dort, wie bei den Autos auch, wenn möglich das Neueste haben musste, was an Produkten auf dem Markt war. Diese Liebe zum Technischen habe ich auch von ihm mitbekommen. Am Central gibt es immer noch ein grosses Archiv von Filmen, hauptsächlich von der Familie. Nein, eigentlich hauptsächlich von meinem Bruder. Als ich dann kam, war das Aufregende an diesen filmischen Familiendokumentationen wohl schon vorbei; jedenfalls hat man um mich viel weniger Aufhebens gemacht.
Andererseits: Offenbar hatte mein Vater viel Vertrauen in mich als Autofahrerin. Ich habe sehr früh meinen Fahrausweis gemacht, und ich war die Einzige, die ausser meinem Vater das Auto benutzen durfte. Beide Eltern haben mir vertraut, wenn ich am Steuer sass, und in späteren Jahren konnte ich meiner gehbehinderten Mutter die grösste Freude machen, wenn ich sie durch die Gegend chauffierte.
Rosmarie Michel ist auch heute noch eine hervorragende Autofahrerin, egal ob es Links- oder Rechtsverkehr zu bewältigen gilt; sie hat Mutproben in den verschiedensten Orten auf der Welt mit Wagen unterschiedlichster Qualität bestanden und wird hoffentlich noch lange nicht auf den geliebten fahrenden Untersatz verzichten müssen. Beim Fahren ist sie grosszügig, flucht nicht und hält sich im Grossen und Ganzen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber in Bezug auf ihr Auto kommt eine ihrer Macken zum Vorschein: Sie erträgt es nicht, wenn jemand in ihrem Auto hinter ihr sitzt (mit ganz wenigen Ausnahmen), und versucht ziemlich erfolgreich zu vermeiden, dass sie Leute mitnehmen muss. Nie würde sie daher ein viertüriges Auto fahren, und wer sich auf dem Beifahrersitz befindet, ist sich des Privilegs, bei ihr mitfahren zu dürfen, bewusst. Die Macke hat aber auch eine positive Seite: Wenn sie grössere Strecken alleine fährt, kann sie in Ruhe über ein anstehendes Problem nachdenken; zur Überraschung aller kommt sie dann meistens ganz entspannt an ihrem Zielort an, weil sie unterwegs eine Lösung erarbeitet hat.
Die Liebe zum Fahren verbindet sie mit ihrem Vater, der damals schon wusste, wie sehr sich der Charakter eines Menschen beim Autofahren zeigt: Wenn ein junger Mann sich im Leben seiner Tochter so weit bewährt hatte, dass er nach Hause eingeladen wurde, musste er schon bald einen Charaktertest beim Autofahren ablegen ...
Es ist der Vater, der die Richtung der Ausbildung seiner Tochter bestimmen wird: Sie wird die renommierte Lausanner Hotelfachschule besuchen. Als sie bei der Abschlussfeier einen Preis bekommt, den die Tochter übrigens eher auf das Renommee der Hoteliersfamilie als auf ihre Leistungen zurückführt, sieht sie Tränen in den Augen des Vaters. Es wird ihm gut getan haben zu sehen, wie auch das väterliche Erbgut in den Genen der Tochter zu finden ist – etwas, was sich dann später bei ihrem von ihm arrangierten Stage im Londoner Hotel Dorchester an der Park Lane sehr deutlich manifestieren wird. Fritz Michel stirbt viel zu früh im Alter von 71 Jahren; seine Witwe wird ihn um 26 Jahre überleben, und die liebevolle, wenn auch nicht konfliktfreie Beziehung zwischen einer autonomen Mutter und einer willensstarken Tochter wird diese Zeit prägen und über den Verlust hinweghelfen.
Es gibt vieles, was an Rosmarie Michel erstaunt. Die meisten ihrer Aktivitäten und Entwicklungen stehen auf den ersten Blick in pointiertem Gegensatz zu ihrer Herkunft, Kindheit und Jugend, allen voran die Tatsache, dass sie weltweit tätig sein wird. Denn dies war ihr wirklich nicht an der Wiege gesungen worden, und hätte man es dem kleinen Mädchen prophezeit, es wäre wohl in seinen eigenen Tränen ertrunken. Weinen ist zwar nicht das operative Wort im Leben von Klein-Rosmarie, aber wenn ihre Lebensumstände bedingen, dass sie auch nur ein paar Hundert Meter vom Haus am Central entfernt ist – ohne Eltern oder Kinderschwester –, öffnen sich die Schleusen, die sich erst schliessen, wenn sie wieder glücklich zu Hause ist.
Sie fasst den Begriff «Heimweh» sehr eng, und sämtliche Versuche, ihn zu erweitern, sind zum Scheitern verurteilt. Mit Kinderschwester Anna zu deren Eltern in den Nachbarkanton Aargau zu fahren ist in Ordnung, solange man am selben Tag wieder zurückkehrt. Dasselbe gilt für das Haus in Meilen, wo man im Kreise von Verwandten schöne Sommertage verbringen kann – das Kind outet sich früh als Wasserratte, lässt sich einfach in den See plumpsen, um dort mit einem Gummiring stundenlang herumzuschwimmen – und das Landleben geniesst, aber eben nur am Tage: Übernachten kommt nicht in Frage!
Diese Kindheitsphobie nimmt mehrmals dramatische Ausmasse an, und wenn auch die Erwachsene heute selbstironisch darüber lachen kann, hat die Kleine diese Anlässe alles andere als lustig gefunden.
Man vergisst es immer wieder, aber die Schweiz hat Anfang der 40er-Jahre eine kurze Bedrohungsphase erlebt, auf die die Regierung mit einer Art Evakuierungskampagne reagierte: Der Bevölkerung wurde geraten, die Städte zu verlassen und sich aufs Land zurückzuziehen. Wer in der Stadt bleiben musste oder wollte, sollte wenigstens nicht in der Nähe von besonders gefährdeten Lokalitäten wie zum Beispiel Industrieanlagen oder Bahnhöfen bleiben. Da das Haus am Central in Spucknähe des Zürcher Hauptbahnhofs liegt, beschliessen die besorgten Eltern, wenigstens ihre Kinder bei Tante Lydia an der Bellerivestrasse hinter dem Opernhaus, also einen guten Kilometer vom Central entfernt, unterzubringen, selbst aber im eigenen Haus zu bleiben. Rosmarie ist inzwischen im frühen Teenageralter, ihr drei Jahre älterer Bruder fast schon ein junger Mann.
Читать дальше