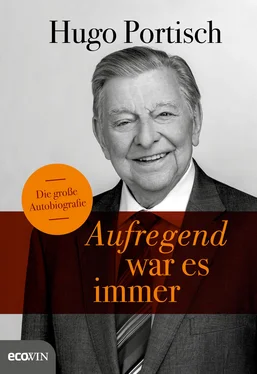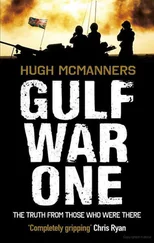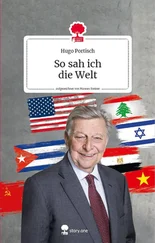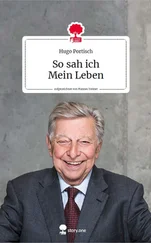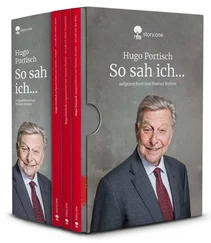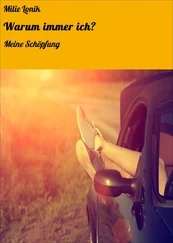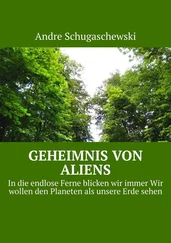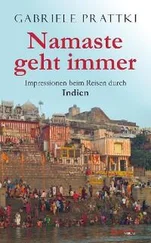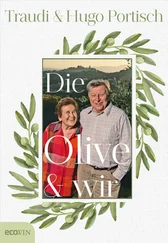Preßburg und die Slowakei blieben bei Ungarn bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. 1918, als die österreichisch-ungarische Monarchie zerbrach, wurden Preßburg und die Slowakei Teile der tschechoslowakischen Republik.
Die Dreisprachigkeit war der Stadt also mit auf den Weg gegeben. Genau genommen kam noch eine vierte Sprache hinzu. Vor dem Antisemitismus und den Pogromen in Galizien und der Ukraine flohen immer wieder jüdische Bürger nach Preßburg wie nach Wien, wo sie Schutz suchten und unter den Kaisern und Königen der Habsburger auch fanden. Jiddisch wurde also vielfach auch in Preßburg gesprochen. Dieses Neben- und Miteinander von drei, ja vier Ethnien gab der Stadt einen ganz besonderen Charakter. Miteinander auszukommen, sich gegenseitig zu respektieren, war nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Selbstverständlichkeit. Wenn es dennoch zu Spannungen zwischen den Sprachgruppen kam, dann wurden diese von außen hereingetragen: 1918, als man das österreichisch-ungarische Erbe im Sinne der neuen tschechoslowakischen Staatlichkeit verdrängen wollte. Danach durch die Forderungen Ungarns, die neue Grenzziehung rückgängig zu machen. Und 1938, als mit dem Münchner Abkommen das Deutsche Reich an das andere Donauufer vis-à-vis der Stadt rückte. Das waren die Rahmenbedingungen, unter denen bis 1939 die »Preßburger Zeitung« erschien.
Mein Vater Emil, aufgewachsen in St. Pölten, 1918 heimgekehrt aus der russischen Kriegsgefangenschaft, antwortete auf ein Inserat der »Preßburger Zeitung« und nahm dort die Stelle eines Redakteurs an. 1920 heiratete er meine Mutter Hedi. 1924 wurde mein Vater Chefredakteur der Zeitung, 1921 kam mein Bruder Emil, 1927 kam ich zur Welt.
Im Jahr 2012 ließ die ungarische Nationalbibliothek, mit Unterstützung der Preßburger Universitätsbibliothek und unter der Leitung von Jan Schrastetter aus München, die »Preßburger Zeitung« vom ersten Tag ihres Erscheinens 1764 an digitalisieren. Mit einem Festakt an der Universität in Preßburg-Bratislava wurde das große Unterfangen gewürdigt und dabei des ersten und des letzten Chefredakteurs der »Preßburger Zeitung« gedacht. Der letzte war mein Vater. Ich war eingeladen, die Festrede zu halten, und nutzte die Gelegenheit, viele der Leitartikel zu lesen, die mein Vater für diese Zeitung geschrieben hatte. So konnte ich nachvollziehen, welche Linie mein Vater dieser Zeitung vorgegeben hatte und mit welcher Haltung er sich den politischen Stürmen der damaligen Zeit stellte. Und die war eindeutig, aber für ein deutschsprachiges Blatt in der Tschechoslowakei gar nicht so selbstverständlich.
Denn die Mehrzahl der deutschsprachigen Bürger Preßburgs trauerte noch der österreichisch-ungarischen Monarchie nach und hätte es lieber gesehen, wenn Preßburg nicht tschechoslowakisch geworden, sondern ungarisch geblieben wäre. Nicht mein Vater. Das Wichtigste für ihn war die Demokratie und damit die tschechoslowakische Republik – mit Ausnahme der Schweiz bald die einzige Demokratie in Mitteleuropa. Immer wieder forderte er von seiner Leserschaft daher auch dieses Bekenntnis zur Republik. Aber er mahnte gerade deshalb auch die Prager Regierung, nicht die Fehler der Habsburgermonarchie zu wiederholen, nämlich die nationalen Minderheiten zu beherrschen, statt sie mitregieren zu lassen. Dieses Recht auf Gleichberechtigung forderte er für alle Minderheiten in der Republik ein, für die Slowaken, die Deutschen und die Magyaren. In allen drei Volksgruppen gab es zunehmend Auflehnung gegen den Prager Zentralismus.
Den Slowaken war im sogenannten Vertrag von Pittsburgh in Pennsylvania, USA, 1918 vom künftigen Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomáš G. Masaryk, die volle Autonomie im tschechoslowakischen Staat zugesichert worden. In Pennsylvania gab es eine große slowakische Volksgruppe, die vielen Slowaken und deren Nachfahren, die aus der ungarischen Unterdrückung nach Amerika ausgewandert waren. Sie hatten politischen Einfluss. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson setzte sich nicht zuletzt deshalb auch für die Gründung der Tschechoslowakei ein. Masaryk wurde der erste Präsident dieser neuen Republik. Am 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages von Pittsburgh, 1938, erhoben die Slowaken die Forderung nach voller Autonomie, die ihnen zugesichert, aber bisher von Prag nicht gewährt worden war. Die in der Slowakei lebenden Ungarn stimmten zur gleichen Zeit in den Chor der Nationalisten in Ungarn ein: »Nein, nein, niemals!« und »Alles zurück«, mit dem sie die ehemals ungarischen Gebiete der Monarchie zurückforderten, zumindest jene Teile, in denen vor allem Ungarn lebten. Also Teile der Slowakei.
Die Deutschen in den Sudetengebieten, in Mährisch-Schlesien und Südmähren, die 1918/19 bei Österreich bleiben wollten, aber nicht durften, stellten zwar im Prager Parlament mehr Abgeordnete als jede der anderen Parteien, wurden jedoch zur Mitwirkung an der Regierung nicht eingeladen. Und schon gab es Lock-rufe der Nationalsozialisten, wie sie auch in Österreich zu hören waren: »Heim ins Reich.«
All das beunruhigte meinen Vater sehr. Leitartikel um Leitartikel schrieb er zur Verteidigung der Republik und der Demokratie. Als Hitler, Mussolini, der britische Premierminister Chamberlain und der französische Ministerpräsident Daladier im Herbst 1938 ohne Beiziehung der Tschechoslowakei in München die Abtretung der Sudetengebiete an Hitlerdeutschland beschlossen, schrieb mein Vater in seinem Leitartikel in der »Preßburger Zeitung«: »In dieser finstersten Stunde gibt es keinen ehrlichen Demokraten, der durch die in München besiegelte Regelung des tschechoslowakischen Problems nicht aufs Tiefste erschüttert wäre. Trauer herrscht nicht allein in den Herzen der Demokraten aller Nationen, die in der Tschechoslowakei leben, ehrliches Mitempfinden strömt uns auch von den wahren Demokraten in ganz Europa zu.«
Doch es sollte viel schlimmer kommen. Für Hitler war die Abtretung der deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei nur der erste Schritt. Im März 1939 beorderte Hitler den tschechoslowakischen Präsidenten Emil Hácha nach Berlin und drohte ihm mit Krieg, wenn er sich seinen Forderungen nicht beugen würde. Diese dramatische Unterredung endete mit der Erklärung Háchas, er lege das »Schicksal des tschechischen Volkes in die Hände des Führers und Reichskanzlers des Deutschen Reiches«. Zur gleichen Zeit forderten der Gauleiter von Wien, Baldur von Schirach, und Hitlers Statthalter in Österreich, Seyß-Inquart, den Ministerpräsidenten der slowakischen Regionalregierung, Jozef Tiso, auf, die Selbstständigkeit der Slowakei zu reklamieren und sie als eigenen Staat auszurufen. Die Zerschlagung der Tschechoslowakei war also eine koordinierte, von Berlin und Wien ausgeführte Aktion. Am 15. März 1939 marschierten Hitlers Truppen in Böhmen und Mähren ein, in Preßburg erklärte Tiso die Slowakei zum selbstständigen Staat.
Zu dieser Katastrophe konnte mein Vater in der »Preßburger Zeitung« nicht mehr Stellung nehmen. Er war zwar deren Chefredakteur, nicht aber ihr Eigentümer. Eigentümer war jene Gruppe von Verlegern, zu denen auch das angesehene »Prager Tagblatt«, das »Brünner Tagblatt« und die Mährisch-Ostrauer »Morgenpost« zählten. Die Verleger waren jüdisch. Diese Zeitungen wurden über Nacht enteignet, mein Vater als Chefredakteur der »Preßburger Zeitung« abgesetzt und das Erscheinen der Zeitung eingestellt.
Ich weiß nicht, ob es noch am gleichen oder erst am nächsten Tag war, jedenfalls erschienen einige Männer in ziviler Kleidung in unserer Wohnung und führten eine Hausdurchsuchung durch. Ich sehe noch die aufgerissenen Schubladen und Kastentüren vor mir und wie die Männer Kleider und Wäsche auf den Boden warfen. Mein Vater war nicht zu Hause, er kam erst Stunden später aus der Redaktion zurück, in der er sich von seinen Mitarbeitern verabschiedet hatte. Drei der zwölf Redakteure waren Juden, zwei von ihnen, Löwy und Bauer, flohen noch am selben Tag und schafften es später nach Palästina – das allerdings erfuhren wir erst nach dem Krieg, als sie uns Briefe aus Israel schickten. Der Dritte, Donath, schaffte es nicht und wurde später in einem der Vernichtungslager ermordet.
Читать дальше