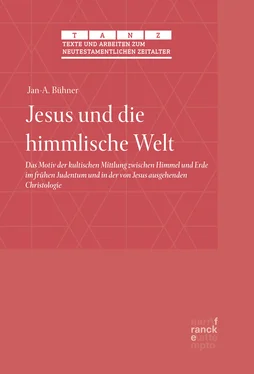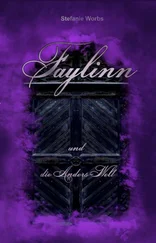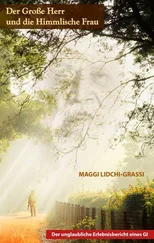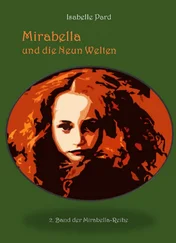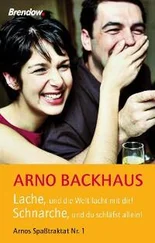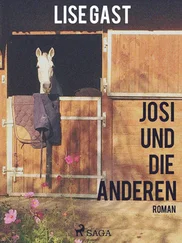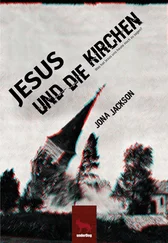Somit ergibt sich:
Die Bedeutung der Gegenwart wird – im Rahmen einer historischen Jesus-Darstellung! – durch die theologische Aussage der Nähe Gottes bestimmt und philosophisch als Ermöglichung von Entscheidung gefasst; sie bleibt aber religionsgeschichtlich ungedeutet. Hermeneutisch fehlt der Versuch, Jesus positiv aus seiner Zeit heraus zu verstehen.
Hatte der Liberalismus die Kategorie des Raumes aus seinem theologisch relevanten Weltbild entlassen und hatte die konsequent-eschatologische Exegese versucht, den immanenten Geschichtsprozess mit der Transzendenz des Reiches an einem rein zukünftigen Punkt kollidieren zu sehen, so löst sich die dialektisch-existentiale Interpretation ganz von einem religiösen, u.d.h. in der Anschauung von Raum und Zeit festgemachten, Bezugsfeld. Es entsteht die Gefahr, Jesus nicht wirklich geschichtlich zu verstehen; sie zeigt sich im wohl höchst zeitgebundenen und theologisch einseitigen14 Bild vom Souverän.
3. Das Ergebnis der religionsgeschichtlichen Betrachtung: Himmlischer Raum und eschatologische Zeit als Dimension des Kultes
Wer in Hinblick auf ein historisches Verständnis von Handlung und Botschaft Jesu nach einer religionsgeschichtlich verantworteten Aufnahme der räumlichen Kategorie ‚Himmel‘ und der durch sie bestimmten der Gegenwart – ‚das Reich Gottes ist nahe‘ – sucht, muss die Fragestellung der konsequenten Eschatologie und ihrer Nachfolger verlassen. Als forschungsgeschichtliche Alternative verbleibt der Ansatz der älteren religionsgeschichtlichen Forschung, die eine kultgeschichtliche Betrachtung des NT forderte.1
Schon in unserem ersten Hinweis auf Bousset wurde deutlich, dass kultische Frömmigkeit, mit der Bousset für die hellenistische Gemeinde rechnet, an einem grundsätzlich mehr vertikalen Weltbild ausgerichtet ist. Die Kategorien des ‚Himmlischen‘ und der aus dem Bezug zum Himmlischen qualifizierten ‚Gegenwart‘ gehören zu einer kultischen Weltdeutung.
Bousset dachte als religionsgeschichtliche Basis für den Christus-Kult des (hellenistischen) Urchristentums an die am Sterben und Auferstehen chthonischer Gottheiten orientierten Mysterien.
Andererseits partizipiert auch der Kult in Jerusalem an der Grundlage der Kult-Symbolik des Alten Orients. Im Bau des Tempels liegt eine kosmische Symbolik, so dass vom Tempel als dem Mittelpunkt des Kosmos Himmel und Erde als die beiden Sphären kultischen Weltverständnisses ineinandergreifen. Im Tempel ist gleichsam der Himmel auf Erden,2 hier ist der Zugang zu Gottes Heiligkeit.3 Entsprechend schrieb Lietzmann über den urkirchlichen Gottesdienst: „Das Herz des christlichen Lebens ist der Gottesdienst der Gemeinde. Da ist die Stätte, wo die Kräfte der jenseitigen Welt in die Christenheit einströmen und sie zu dem neuen Volk der Gotteskinder machen, das nicht mehr von dieser Welt ist, sondern schon hier in wundersamer Gemeinschaft mit den himmlischen Bürgern des Gottesreiches lebt.“4
Es ergeben sich aus dieser nur angedeuteten forschungsgeschichtlichen Konstellation für unsere Fragestellung folgende Grundprobleme:
Sind eschatologisch-geschichtliches und kultisch-räumliches Denken unvereinbar?
Steht das Kultverständnis der neutestamentlichen Gemeinde religionsgeschichtlich nur in Nähe zu den Mysterien oder kann man mit traditionsgeschichtlichem Nachwirken des Tempelkultes in Jerusalem und seiner Theologie rechnen?
Ist forschungsgeschichtlich der Versuch vorgezeichnet, die Jesusfrage von der kultgeschichtlichen Betrachtung her anzugehen?
Die kultgeschichtliche Betrachtung ging aus von einer Parallelisierung des urchristlichen Sakramentsgottesdienstes mit den hellenistischen Mysterien-Feiern. Die Mysterienkulte bildeten sich um die Verehrung chthonischer Götter. An deren den Wechsel der Jahreszeiten ausprägendem Vergehen und Wiedererstehen will der Myste Anteil bekommen. Es geht um die Befreiung von kosmischen Kräften und um die Versicherung eines Gott-gemeinschaftlichen Lebens im Jenseits. Ist schon das griechische Denken überhaupt an einem zyklischen Geschichtsbild orientiert, so verdichtet sich dieses in den Mysterien zu einer ausgesprochen individuell-soteriologischen Grenzüberschreitung. Sie ist unabhängig vom äußeren Weltlauf jederzeit möglich, sofern der Kultus mit seinem je eigenen Kairos dazu die Möglichkeit gibt.5 Das Denken der Mysterienkulte ist uneschatologisch.
Der Verweis auf die Mysterienkulte und ihre Bedeutung für die urchristliche Religion untersteht von Haus aus dem von F. Chr. Baur eingeführten Schema des doppelten Ansatzes, in dem sich die individuelle Vater-Frömmigkeit Jesu6 bzw. die eschatologische Frömmigkeit Jesu7 und der – auch in Bezug auf die Lehrbildung – geordnete Kult der hellenistischen Gemeinde gegenüberstehen. Die Spannung zwischen Juden- und Heidenchristen ermöglichte die Klarheit einer echten These-Antithese-Bildung. Diese Grundposition des klassischen ‚doppelten Ansatzes‘ wirkt bekanntlich nach bis hin zu Bultmanns Aufriss der Theologie des NT, ja seiner Eliminierung der zukünftig-eschatologischen Passagen im Johannesevangelium.
Kommt nach dieser These mit dem an den Mysterien orientierten Christus-Kult etwas Fremdes in das Christentum hinein, das ihm himmlische, uneschatologische, mystische und christologisch-dogmatische Perspektiven erschließt, so ist die kultgeschichtliche Betrachtung in einem anderen Zweig der Forschung gerade auf eine Harmonisierung von Jesus-Evangelium und Kultfrömmigkeit ausgerichtet gewesen. „Unsere heilige Urgeschichte hat in Wirklichkeit darin ihren inneren Fortschritt, dass die durch das Evangelium Jesu entstandene messianische Bewegung mit ihrer völligen praktischen Eingestelltheit auf das nahe Weltende und die nahe Zukunft des Gottesreiches sich zuletzt als Kult historisch konsolidiert, als Kult Jesu des Herrn; anders ausgedrückt: dass das Evangelium sich umsetzt in Christentum.“8 Das Christentum bildet sich nach Deissmann als Kult ‚reagierenden Typs‘, insofern der galiläische Fischer Simon durch Offenbarung am Messiasbewusstsein Jesu teilbekomme. Jesus selbst habe keinen neuen Kultus gestiftet, sondern die neue Zeit verkündet; aber durch sein gewaltiges Ich-Bewusstsein habe er gemeinschaftsbildend gewirkt und damit die Entstehung des Felsens ermöglicht, auf dem dann die Gemeinde entstand. Jesu eschatologisches Ich-Bewusstsein habe als gemeinschaftsbildendes kultinitiatorische Kraft gehabt, so dass von Anfang an, schon in der apostolischen Urkirche Palästinas, der Bezug auf Jesus den Messias kultisch ausgeprägt sei, wie es sich deutlich im palästinischen Gebetsruf „Maranatha“ zeige. Mit dieser von Deissmann als organische Entwicklung postulierten Bewegung kontrastiert nun jedoch, dass der Kultus selbst in seinen Denkformen ganz aus hellenistischer Tradition stammen soll: „Das Evangelium Jesu verbindet die Anfänge unserer Religion aufs engste mit seiner Mutterreligion, dem Judentum. Der apostolische Jesuskult wirft dann, eben mit dem Kultischen, wie es ihm eigentümlich war, ein jedenfalls dem amtlichen Judentum wesensfremdes Element in den Schmelztiegel … Durch das Kultische tritt die andere der providentiellen Kräftegruppen der praeparatio evangelica in schöpferische Tätigkeit: die antike Welt der ‚Völker‘.“9
Deissmann behält also die grundlegende religionsgeschichtliche Herleitung des Christus-Kultes aus den Mysterien bei und bleibt damit auch bei dem theoretischen Gegensatz von Kultus und Eschatologie stehen. Was nach dem klassischen ‚doppelten Ansatz‘ des Evangeliums sauber auf zwei Gemeinde-Typen und Epochen verteilt wurde, erscheint hier als bereits im palästinischen Christentum verschmolzen. Deissmann baut dabei auf zwei Voraussetzungen: Jesu messianisches Ich-Bewusstsein wirke gemeinschaftsbildend und dadurch kultinitiatorisch; ferner sei Palästina zur Zeitenwende bereits so stark hellenisiert, dass man auch hier die jenseits des Judentums stehenden, hellenistischen Kultformen gekannt habe. Kultus und Eschatologie bleiben also religionsphänomenologisch in einem Gegensatz, der im NT ausnahmsweise überwunden werde.
Читать дальше