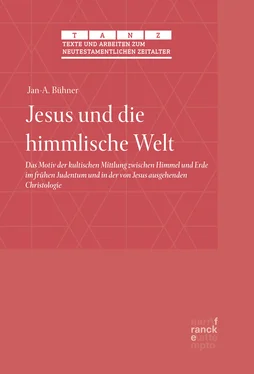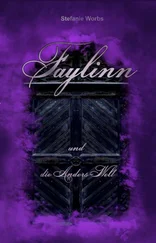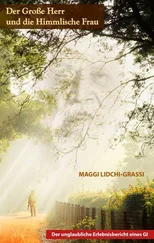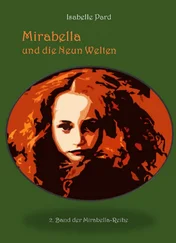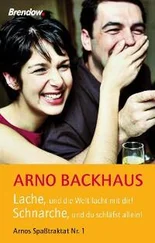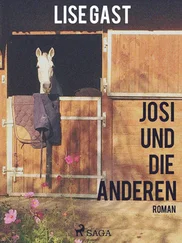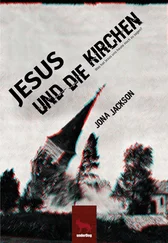Der Fixpunkt für die urchristliche Eschatologie liegt in der durch das Pneuma gewährten Beziehung der Gemeinde zu ihrem himmlischen Herrn. Daraus ergibt sich die Erwartung, dass auch die Reich-Gottes-Ansage Jesu ihren eigenen Fixpunkt in seinem gegenwärtig-pneumatischen, personhaften Einbezogensein in das Reich Gottes findet. Jesus blickte dann nicht nur auf eine zukünftige Realisierung des Reiches. Mehr noch ist es eine Größe, die aus der himmlischen Verborgenheit in die Wirklichkeit der neuen Schöpfung eintritt.
Diese Konsequenz zog M. Dibelius in seinem Jesusbuch: „… eine (scil. Jesu) Verkündung des unbedingten Gotteswillens hat das Kommen des Reiches zur Voraussetzung; die Art, wie er die Menschen vor die Wirklichkeit Gottes stellt, ist begründet in der Aussicht, dass diese himmlische Wirklichkeit demnächst irdische Wirklichkeit werden solle.“14
Jesus kennt die Basileia als himmlische Wirklichkeit und weiß darum, dass diese himmlische Wirklichkeit sich anschickt, nach der Erde auszugreifen. Ändert man den etwas vagen Ausdruck der ‚Aussicht‘ bei Dibelius zu dem der pneumatischen Gewissheit, so ergibt sich unausweichlich, dass Jesus mit dieser himmlischen Wirklichkeit einen intensiven Kontakt gehabt haben muss, ja zu ihr gehört hat. Urchristlicher Pneumatismus mit der Vielzahl seiner Phänomene als Haftpunkt urchristlicher Eschatologie verlangt als begründende Analogie ein Jesusverständnis, nach dem er Pneumatiker gewesen ist, der schon als Irdischer der himmlischen Basileia zugehörte.
Für eine hermeneutisch nicht eingeschränkte historische Forschung15 scheint es also aus mehreren Gründen notwendig zu sein, die Dimension des Himmlischen als Raum der angrenzenden Transzendenz weder aus der neutestamentlichen Christologie noch aus dem historisch erkennbaren Bild vom irdischen Jesus zu entlassen:
die räumliche Dimension der biblischen Lehre von der in Himmel und Erde getrennten Schöpfung wehrt sich heftiger gegen alle Versuche, das Transzendente in den irdischen Geschichtsablauf einzubinden, als eine rein zeitliche Eschatologie. Die Rede vom ‚Himmel‘ benötigen wir, um Eschatologie vor dem Versinken in Immanenz zu bewahren.
Auf der Folie der räumlichen Kategorie ‚Himmel‘ werden die mit der Religionsgeschichte unlösbar verbundenen pneumatischen Phänomene wieder erkennbar und als Zeichen präsentischer Eschatologie deutbar.
Neutestamentlich ergibt sich aus diesem in die biblische Schöpfungslehre eingebundenen Rückgriff auf den ‚Himmel‘, dass Jesus als Pneumatiker deutbar wird. Wenn er der Anfänger der Bewegung ist, die die eschatologische Neuschöpfung mit dem gegenwärtigen Pneuma-Besitz verschränkt, dann gehört er bereits als Irdischer auch zur himmlischen Welt.
B) Aspekte der Forschungsgeschichte: Von der ‚konsequenten Eschatologie‘ zur ‚kultgeschichtlichen Betrachtung‘
1. Eschatologische Zukunft und religiöse Hochstimmung: die konsequente Eschatologie
Der Umbruch in der modernen Jesusforschung wird gewöhnlich mit dem Buch von Johannes Weiss ‚Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes‘, 1. Aufl. 1892, (2. Aufl. 1900) verbunden.1 Weiss übernimmt die systematisch-theologische Vorentscheidung der liberalen Tradition, wonach Jesus und das Christentum letztlich nur von der Reich-Gottes-Verkündigung her zu verstehen seien.2 Gegen seine liberalen Väter betont Weiss jedoch, dass das Reich Gottes kein sittliches Gut und keine die geschichtliche Entwicklung der Menschheit betreffende Größe sei, sondern als streng endgeschichtliches, nur zu erhoffendes, aus der Zukunft her kommendes, transzendentes, geschenktes Gut zu verstehen sei.
Dieser antiliberale Ansatz, den Weiss vor allem in der 1. Auflage programmatisch betonte, bleibt nun aber an zwei Punkten der älteren aufklärerisch-liberalen Tradition verhaftet:
Er übernimmt in der Grundlage doch das Programm einer Verortung der christlichen Religion in der menschlichen Geschichte. Transzendierend ergänzt er, dass das Reich Gottes in Jesu Verkündigung zwar der unverfügbaren Zukunft, jedoch grundsätzlich als eine dem menschlichen Geschichtsempfinden qua Antizipation zuwachsende Größe angehört.3
Mit dem grundsätzlichen Verbleib auf der Ebene eines linearen Geschichtsbildes gemäß aufklärerisch-liberaler Tradition hängt zusammen, dass Weiss Jesus weiterhin in den Bahnen der heroischen Vorbildchristologie sieht. Jesus lebe aus religiösen Stimmungen; er sei – gemäß der liberalen Propheten-Anschluss-Theorie – der größte Prophet;4 Weiss stößt im letzten bei Jesus auf religionspsychologisch zu deutende Phänomene, die in ihrem subjektiven Erlebnischarakter auch die von ihnen abhängigen Momente einer Gewissheit der Nähe des Reiches tragen. Auch Jesu Berufung und seine Gewissheit, dass er den Teufel zeichenhaft überwinden kann, ist religiöse Stimmung. Nur negativ gelte: Wie das Reich Gottes eine rein zukünftige Größe sei, so sei es Jesus verwehrt, seine messianische Würde außerhalb individueller religiöser Stimmungen5 zwischen Hoffnung und Glauben festzumachen. Auch die Aussage einer Vollmacht vom Himmel her, mit der Weiss für die hinter dem Tauf- und Verklärungsbericht stehende Wirklichkeit rechnet,6 bleibe eingefangen in die Spannung zwischen einer bloß subjektiven Gewissheit und dem ontologisch allein dominierenden Element endgeschichtlicher Erfüllung, in der die Transzendenz sich dem Maßstab irdischer Geschichtsevidenz anpassen wird.7
Weiss nennt exegetische Beobachtungen, die über die Vorentscheidung hinausweisen, letztlich die irdische Geschichtslinie zum Kriterium theologischer Evidenz zu machen. Das Reich Gottes sei ursprünglich Begriff himmlisch-transzendenter, kultischer Theokratie.8 Keine Religion könne auf Dauer ohne Qualifizierung der Gegenwart auskommen.9 Jesus und die neutestamentliche Zeit seien im Grund nicht an einem linearen Geschichtsbild orientiert, sondern an einem Himmlisches und Irdisches umfassenden Orientierungsrahmen.10 Diese ergänzenden Bemerkungen, die das Programm der ‚konsequenten Eschatologie‘ eigentlich in Frage stellen, kann Weiss verständlicherweise nicht positiv aufnehmen.
Forschungsgeschichtlich aufgenommen und weitergeführt wurde der eschatologische Ansatz bei W. Bousset. Bousset übernimmt in seinem 1904 erschienenen Buch zur Jesusfrage die Grunderkenntnis, dass Jesus auf zukünftiges Gericht und zukünftiges Heil verweise und dadurch die Gegenwart seines Auftretens zur Zeit der Scheidung mache. Dabei bleibt dieser, auch bei ihm streng eschatologisch-zukünftig gedachte, Ansatz verbunden mit einem liberalen, religiös-psychologischen und bei der Aufnahme der entscheidenden Begriffe höchst zeitgebundenen Jesusbild.11 Die Ankündigung der eschatologischen Wende realisiert sich bei Jesus folgendermaßen: „und in allem die starke, königliche Natur, das Bewusstsein, die Dinge zu Ende zu führen und das letzte, entscheidende Wort zu reden, diese Zuversicht der allernächsten Nähe seines himmlischen Vaters, die starke königliche Kraft, mit der er die Seelen der Seinen zwang und das Höchste von ihnen forderte …“12. Es ist auffällig, dass antiliberaler Impetus in der Darstellung des Reiches Gottes und ein betont religionsgeschichtlich-kritischer Ansatz sich mit einem für heutige Betrachtung äußerst unkritischen, zeitgebundenen Jesusbild verbinden können. In ihm scheint Jesus dem Ideal eines monarchischen Souveräns angeglichen. Sollte dies daran liegen, dass die rein zukünftige Fassung des Reiches Gottes keinen echten religionsgeschichtlichen und im tiefsten religiösen Bezugspunkt für die Beschreibung Jesu zulässt und deshalb die angeblich bei Jesus nicht vorhandene Kategorie der religiös gefüllten Gegenwart außerhalb exegetischer und theologischer Kontrolle eingetragen wird?
In seinem forschungsgeschichtlich bedeutenden Buch ‚Kyrios Christos‘ zieht Bousset weitere Konsequenzen. Während Jesus und die palästinische Urgemeinde für die jeweils kurze Zeitspanne ihrer Geschichte bei der brennenden und rein zukünftigen Naherwartung bleiben konnten, ‚füllt‘ die heidnisch-hellenistische Gemeinde vor Paulus die himmlische Welt mit dem Kyrios Jesus als ihrem Kultgott. Die palästinische Gemeinde lebte aus der reinen Zukunft des kommenden Menschensohnes, wobei der Himmel nur den bloß vorstellungsmäßig notwendigen Aufbewahrungsraum Jesu, jedoch keine irgendwie die Gegenwart qualifizierende Größe abgab.13
Читать дальше