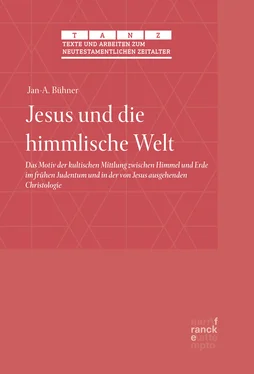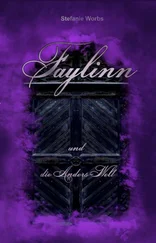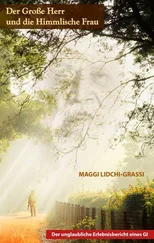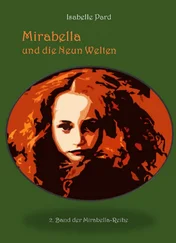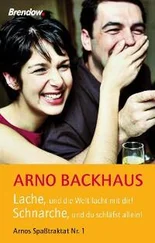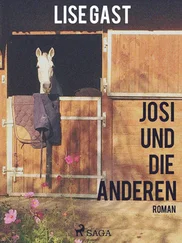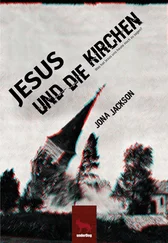6. Hillel und Schammai (um 30 v. Chr.)
Mit Hillel (und Schammai) endet in MAb 1,15 die vormischnische Sammlung1, die in etwa an die vorneutestamentliche Zeit heranführt. Hillel wurde Vorsteher des Sanhedrin 100 Jahre vor der Zerstörung des Tempels (b Schab 15a), also im Jahre 30 v. Chr.
Begann dieser vorrabbinische Traditionsblock mit dem Hohenpriester Simon der Gerechte, so endet er bei Hillel in einem Leitspruch (MAb 1,12), der die pharisäische Gelehrtenbewegung betont in die Tradition des aaronidischen Priestertums stellt. Erinnert sei daneben nochmals an das vor Hillel und Schammai auftretende Lehrerpaar Schemaja und Abtalion, das beanspruchte, in Wahrheit den Dienst Aaarons zu versehen.2
„Sei von den Jüngern Aarons, den Frieden liebend und nach Frieden strebend; die Menschen liebend und sie der Tora zuführend.“ (MAb 1,12)
ARN A 12 (24b) führt dieses Bild vom Priester aaronidischer Art als Friedensmehrer auf Mal 2,6 zurück. Mal 2,5-7 enthalten, neben Sach 3, das nachexilische, biblische Idealbild des Priesters aus dem Bunde Gottes mit Levi. שלום ist hiernach Kennzeichen des Stehens im Priesterbund Levis; שלום ist Segnung dieses Bundes und Kennzeichen des priesterlichen Wandels. Mit dem Jüngertum Aarons verbindet Hillel die Liebe zur בריאות. Gegen die Einschränkung in ANR A auf Israel spricht hier ein Wissen darum, dass Priesterdienst und Kultus sich im Horizont der ganzen Schöpfung vollziehen. Entsprechend trägt der pharisäische Aaron-Jünger Verantwortung gegenüber der ganzen Menschheit. In diesem priesterlich-kultischen Urelement, auf das der Kernspruch Hillels verweist, liegt also die Verpflichtung gegenüber dem Heidentum, die bekannterweise Hillel auch sonst betont.3 Dass Friedensdienst und Liebe zur Schöpfung sich im Zuführen zur Tora vollziehen, entspricht der Forderung von Mal 2,7. Auch die Kennzeichnung des Levi-Bundes als ein ‚Bund des Lebens‘ (Mal 2,5) klingt in MAb 1,13 nach: „Wer nicht lernt, ist des Todes schuldig“; der pharisäische Aaron-Jünger kann nur dann seinem Friedens- und Lebensdienst entsprechen, wenn er Tora gibt, Tora-Gelehrter ist. Der gottgefällige Priester nach Mal 2,5 beugt sich in Ehrfurcht vor dem Gottesnamen; entsprechend warnt Hillel nach MAb 1,13: „wer sich der Krone bedient, ist des Todes schuldig“; ARN A 12 Ende (28b) formt um: „wer sich des geheimen Gottesnamens bedient, hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt“. Wenn der Priester, der den Namen Gottes ‚verwaltet‘, zur Ehrfurcht ihm gegenüber gerufen ist, so muss der pharisäische Aaron-Jünger, der als Tora-Gelehrter sich auf das Geheimnis des Namens versteht, ebenfalls davor gewarnt werden, den Gottesnamen zur Erlangung besonderer ‚mystischer‘ Erkenntnis oder zur Vollbringung von Wundern zu verwenden.4
Hillel erinnert daran, dass die besondere Heilsaufgabe des pharisäischen Gelehrten sich in Erfüllung der Aaron-Jüngerschaft vollzieht. Vermittlung von Frieden und Leben, Liebe zur בריאות, Heranführen an die Tora – das sind die dem alten Ideal des Priesterdienstes entsprechenden Kennzeichen des pharisäischen Lehrers. Damit kommt der pharisäische Aaron-Jünger in eine Stellung zwischen himmlischer und irdischer Welt, die ehemals der Priester als מלאך היי wahrnahm. Bereits Hillel nach MAb 1,13 lehnt eine theurgische Benutzung dieser Stellung ab, deutet damit aber auf eine Möglichkeit (und Gefahr) hin, die im späteren Judentum immer bedeutsamer wurde.
Die auf eine ältere, in sich geschlossene Sammlung zurückgehende Spruchfolge MAb 1,1-15 umreißt die theologische Entwicklung des palästinischen Judentums chasidisch-pharisäischer Prägung aus rabbinischem Blickwinkel. Abgedeckt wird die Zeitspanne von ca. 200 v. Chr. bis zur Zeitenwende, also die Epoche, die im Besonderen den Hintergrund für Jesus und das Neue Testament bildet.
Der hier sichtbar werdende, vorrabbinische Pharisäismus ist geprägt durch die Aufnahme und Umsetzung priesterlicher Aufgaben und Ideale; dazu gehört auch die Erwirkung einer Verbindung von himmlischer und irdischer Welt, welche die Grundlage des vom Kult ausgehenden Segens und der priesterlichen Offenbarung bildete.
Die priesterlichen Ideale werden im frühen Pharisäismus zunächst von Priestern formuliert und hochgehalten; doch schon im priesterlichen Pharisäismus deutet sich an, dass die kosmische, Himmel und Erde verbindende, Bedeutung des Kultes sich vom Priestertum, welches durch stammesmäßige Herkunft definiert ist, löst und vom gelehrten Frommen wahrgenommen werden kann. Der Schriftgelehrte ist der wahre Aaron-Jünger, ohne aus priesterlichem Geschlecht stammen zu müssen. Wenn so die Ordensgemeinschaft חבורהan die Stelle der Priesterschaft כהונה tritt, so ist es im Besonderen die Figur des Hohenpriesters, die an einem in ihr liegenden Anspruch gemessen wird, der sich in der Gestalt des pharisäischen Chasid neu verwirklicht.
Man stößt auf einen Grundzug in der Theologie dieses priesterlichen Pharisäismus, der das Gehaltensein der Schöpfung durch die חסד Gottes betont und so in der Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber den vorzüglichen Ausdruck seiner Frömmigkeit findet. Offenbar ist dabei weniger die Erwartung des zukünftigen Gerichtes Grundlage, als vielmehr das Wissen in einer jetzt schon mit dem Himmel verbundenen Welt zu leben: Der priesterliche Pharisäer dient dem שלום; er erwirkt gesegnetes Leben für Israel und die Schöpfung; er besitzt mit der Tora eine kultisch-kosmische Größe, die dem Tempel-Ritual überlegen ist; der geheime Gottesname, der bis zur Zeit des ‚Simon der Gerechte‘ im Kultus öffentlich verwendet wurde, wird dem Vollzug im Allerheiligsten vorbehalten und gleichzeitig dem pharisäischen Aaron-Jünger anvertraut. Aus dem Versuch, den Gottesnamen zu schützen, ergibt sich andererseits der Beleg für die Gefahr einer ‚mystischen‘ oder ‚magischen‘ Verwendung bereits in vor-mischnischer Zeit.
Neben der Verwendung des ‚Namens‘ deuten sich andere Möglichkeiten des priesterlichen Kontaktes zur himmlischen Welt an, die nun der pharisäische Aaron-Jünger übernimmt: die priesterliche Verklärung, der Empfang der Himmelsstime בת קול, die Hinwendung zur Gestalt der Gottheit und die Entrückung in der Todesstunde.
C) Die apokalyptische Rezeptionslinie: der himmlische Hintergrund des Kultes als Ausgangspunkt einer eschatologischen Neuordnung der verklärten Schöpfung
Die vorrabbinische, pharisäische Tradition war nach MAb 1,2-15 im Zentrum bemüht um die Wahrnehmung der Segenskräfte des Kultes für das Volk Gottes, ja für die ganze Schöpfung. Der Pharisäer versteht sich als der wahre Aaron-Jünger, der Frieden und Barmherzigkeit als die kultischen Segenskräfte für die Schöpfung erwirkt.
Das Zentrum dieser vorrabbinischen, pharisäischen Kultrezeption ist nicht eschatologisch ausgerichtet. Es geht um die kultische Bestimmung der alten Schöpfung durch eine neue, priesterlich-pharisäische Frömmigkeit.
Neben der priesterlich-pharisäischen Rezeption des Kultanspruchs steht eine Linie priesterlich-apokalyptischer Verdichtung. Hier blickte man nicht so sehr auf eine Laisierung priesterlicher Frömmigkeit, als vielmehr auf das vom Kult erschlossene Geheimnis des himmlischen Teils der Schöpfung, von dem aus man auf eine eschatologische Neuordnung der ganzen Schöpfung wartet. Hanson1 wies die Anfänge der apokalyptischen Bemühung um eine Enthüllung des himmlischen Schöpfungsteils priesterlichen Außenseiterkreisen zu. Die spätprophetische Zionseschatologie hätten sie durch visionäre Enthüllung der ‚Vorbereitung im Himmel‘ verstärkt.
Wir untersuchen diese apokalyptische Rezeption des Kultanspruchs am Beispiel des 1Hen, weil diese Schrift die genannte Konzeption besonders deutlich zeigt. Zudem umgreift das kontinuierliche traditionsgeschichtliche Wachsen dieses Blocks die für das Neue Testament entscheidende Epoche von ca. 200 v. Chr. bis in die nachneutestamentliche Zeit.2
Читать дальше